Holdes Bienchen, du irrst! Dort winkt dir blühend der Lorbeer,
Sprich, was umsurrst du denn mir emsig die Wang′ und den Mund?
Honig entsaugst du mir nicht, du seist denn ein schelmisches Mädchen,
Das sich vermummte, und dann komm in der wahren Gestalt!
Sinnst du mir aber ein Arges, gedenkst du, dafür mich zu strafen,
Daß ich ein Mensch nur bin, nimmer die Rose des Tals,
Oder bin ich dir gar aus alter Zeit noch verschuldet,
Hab′ ich als Blume vielleicht einst dir geweigert den Trunk:
O, besieh mich vorher, ob nicht mit schärferem Stachel
Dich ein stärkerer Feind lange an mir schon gerächt;
Sieht, du setztest dich leicht auf eine Narbe, denn manche
Hab′ ich, ich zuckte dir kaum, aber du littest den Tod.
Auf eine Biene in der Villa Medicis
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
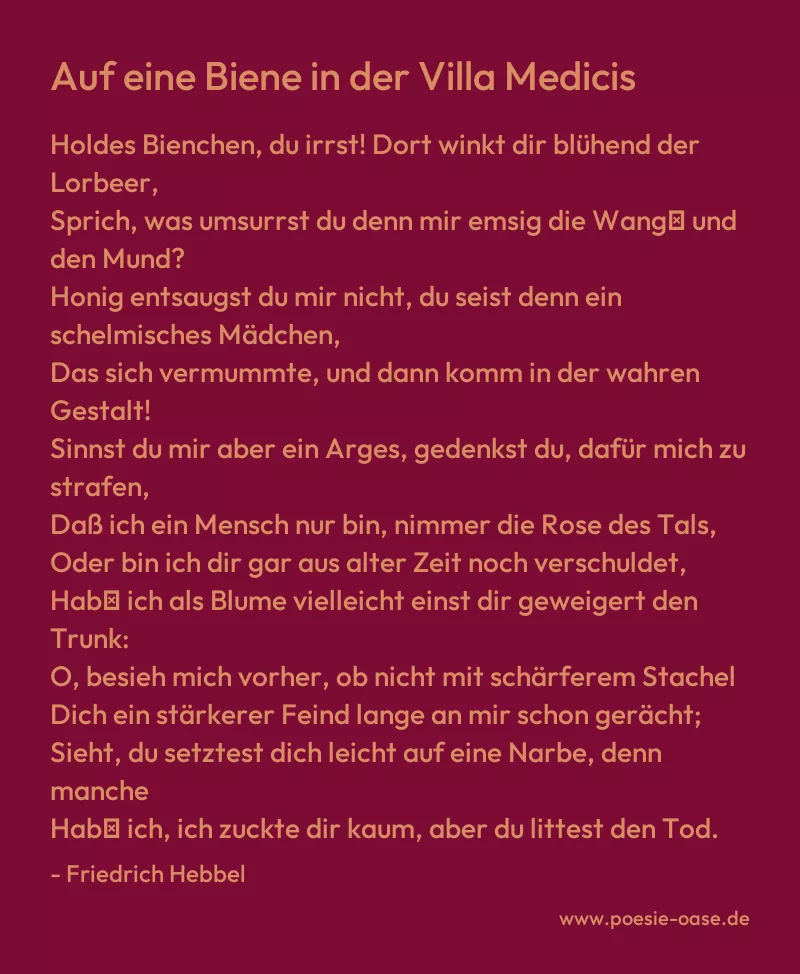
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Auf eine Biene in der Villa Medicis“ von Friedrich Hebbel ist eine spielerische Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit, der Liebe und der menschlichen Erfahrung, verpackt in einem Dialog mit einer Biene. Der Sprecher, der sich in der malerischen Umgebung der Villa Medicis aufhält, richtet sich direkt an das Insekt und beginnt mit einer freundlichen, fast neckischen Ansprache. Er fragt, warum die Biene ihn umschwirrt und stellt eine Verbindung zu einer möglichen weiblichen Gestalt her, die sich hinter der Maske der Biene verbergen könnte. Diese kokette Andeutung deutet auf die Möglichkeit einer Liebesbeziehung hin und wirft die Frage nach den Absichten der Biene, beziehungsweise der verborgenen Person, auf.
Die zweite Strophe des Gedichts verlagert den Ton von spielerischer Neugier hin zu einer ernsthafteren Reflexion. Der Sprecher spekuliert über die möglichen Gründe für das Verhalten der Biene und deutet an, dass diese möglicherweise eine Art „Strafe“ für ihn bereithält, möglicherweise weil er ein Mensch ist und nicht die unberührte Schönheit einer Rose. Er deutet auch auf eine Schuld aus der Vergangenheit an, als ob er der Biene einst etwas verwehrt hätte. Diese Zeilen offenbaren eine tiefere Melancholie und die Erkenntnis der Unfähigkeit des Menschen, die reine Schönheit der Natur zu erreichen. Der Sprecher reflektiert die Ungleichheit zwischen Mensch und Natur, die in den Augen des Sprechers zu einer Art Schuldgefühl führt.
Die dritte Strophe nimmt die zuvor angedeutete Vergänglichkeit und das Leid als Thema auf und vertieft die Botschaft des Gedichts. Der Sprecher warnt die Biene davor, ihn zu stechen, da er bereits von einem „stärkeren Feind“ verwundet wurde. Er weist auf die Narben hin, die er als Mensch davongetragen hat, und deutet damit auf erlebte Schmerzen, Verluste und Erfahrungen hin. Die Metapher der Narbe wird hier zu einem Symbol für die Verletzlichkeit des Menschen. Das Gedicht gipfelt in der Erkenntnis, dass das kleine Insekt, wenn es sticht, selbst stirbt.
Das Gedicht ist also eine Reflexion über die menschliche Existenz im Angesicht der Natur und der Liebe, die in der malerischen Umgebung der Villa Medicis zum Ausdruck kommt. Es verwebt spielerische Elemente mit tiefgründigen Gedanken über Vergänglichkeit, Schuld und die Ungleichheit zwischen Mensch und Natur. Die Biene dient als Vehikel, um die Komplexität menschlicher Emotionen und Erfahrungen zu erforschen. Hebbel gelingt es, mit einfachen Worten eine tiefe Botschaft zu vermitteln, die den Leser zum Nachdenken über die eigene Existenz und die Beziehung zur Welt anregt.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
