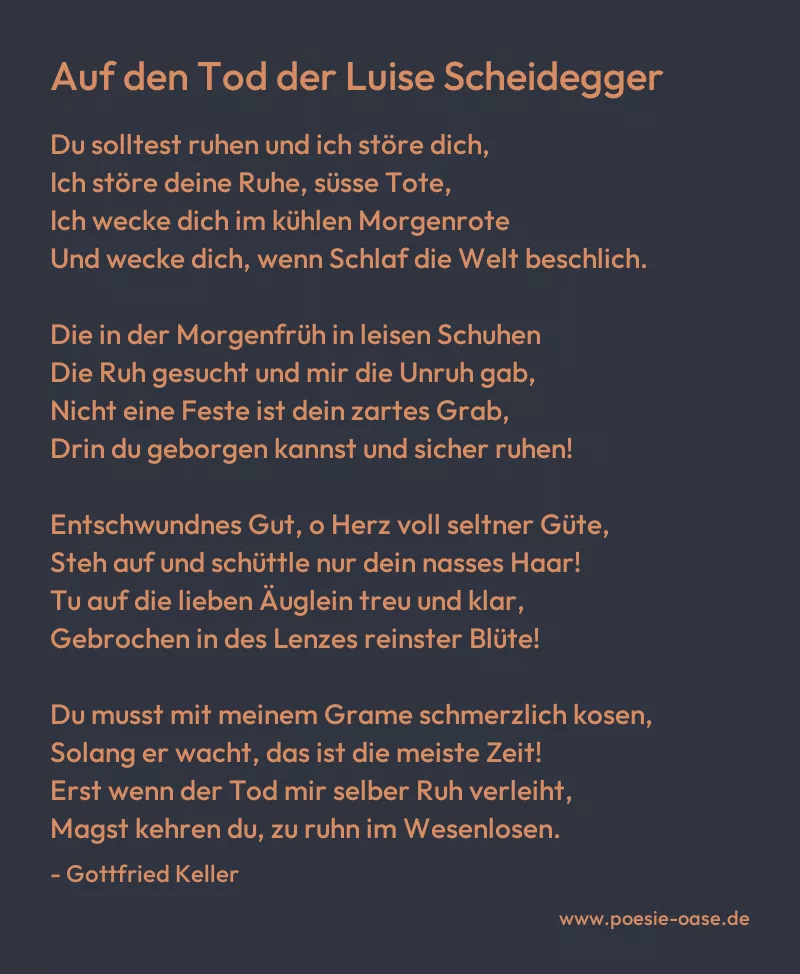Auf den Tod der Luise Scheidegger
Du solltest ruhen und ich störe dich,
Ich störe deine Ruhe, süsse Tote,
Ich wecke dich im kühlen Morgenrote
Und wecke dich, wenn Schlaf die Welt beschlich.
Die in der Morgenfrüh in leisen Schuhen
Die Ruh gesucht und mir die Unruh gab,
Nicht eine Feste ist dein zartes Grab,
Drin du geborgen kannst und sicher ruhen!
Entschwundnes Gut, o Herz voll seltner Güte,
Steh auf und schüttle nur dein nasses Haar!
Tu auf die lieben Äuglein treu und klar,
Gebrochen in des Lenzes reinster Blüte!
Du musst mit meinem Grame schmerzlich kosen,
Solang er wacht, das ist die meiste Zeit!
Erst wenn der Tod mir selber Ruh verleiht,
Magst kehren du, zu ruhn im Wesenlosen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
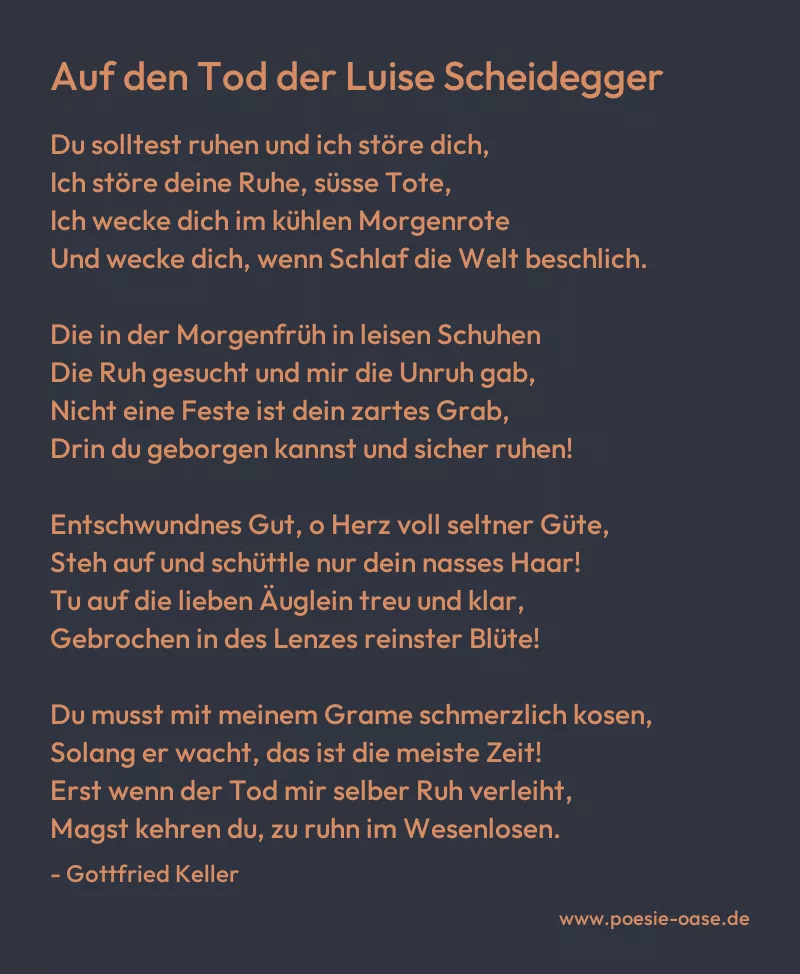
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Auf den Tod der Luise Scheidegger“ von Gottfried Keller ist eine bewegende Elegie, die die Trauer des Dichters über den Tod einer geliebten Person, Luise, zum Ausdruck bringt. Es ist ein tief empfundenes Bekenntnis der Trauer, der Sehnsucht und des Schmerzes, das durch die direkte Ansprache der Verstorbenen und die intime Sprache eine besondere Nähe zum Leser herstellt. Der Dichter stellt sich als denjenigen dar, der die Verstorbene im Tode nicht in Ruhe lassen kann, da er von Trauer überwältigt ist.
Die ersten beiden Strophen beschreiben die Störung der Totenruhe und die damit verbundene Unfähigkeit des Dichters, die Verstorbene loszulassen. Das lyrische Ich sieht sich gezwungen, die Tote zu „wecken“ – sei es im Morgengrauen oder in der Nacht. Dieses „Wecken“ symbolisiert nicht nur die ständige Präsenz des Andenkens an Luise, sondern auch die Unfähigkeit des Dichters, Frieden zu finden. Der Hinweis auf das „nasse Haar“ in der dritten Strophe ist ein besonders eindrückliches Bild, das die Vergänglichkeit und das Schicksal der Toten unterstreicht. Die Erwähnung des „zarten Grabs“ und die Sehnsucht nach einer ewigen Ruhe, die Luise verwehrt bleibt, verstärken das Gefühl des Verlustes.
Die dritte Strophe, die mit dem Ausdruck „Entschwundnes Gut“ beginnt, offenbart die tiefe Wertschätzung des Dichters für Luise. Er beschreibt sie als Person „voll seltner Güte“ und bittet sie, sich ihm noch einmal zuzuwenden. Die Zeile „Gebrochen in des Lenzes reinster Blüte!“ ist besonders ergreifend, da sie das frühe Ableben in der Blüte des Lebens thematisiert. Der Tod, der Luise ereilte, wird als ein unnatürlicher Abbruch in der Zeit des Aufbruchs und der Erneuerung gesehen, was die Tragik des Verlusts noch verstärkt.
Die letzte Strophe ist der Höhepunkt der Trauer und zeigt eine düstere, aber ehrliche Sichtweise auf den Zustand des Dichters. Er ist zu einer untrennbaren Verbundenheit mit seinem Schmerz verurteilt, die ihn dazu zwingt, mit Luise in Gedanken zu „kosen“. Erst wenn er selbst stirbt und die Ruhe des Todes findet, so die letzte Zeile, wird Luise endlich im „Wesenlosen“ – also in der ewigen Stille – ruhen können. Dieser Schlusssatz verdeutlicht die tiefe Verzweiflung des Dichters und die Erkenntnis, dass der Schmerz erst mit dem eigenen Tod enden wird. Das Gedicht ist ein ergreifendes Zeugnis der Trauer und ein berührender Ausdruck menschlicher Verlustangst.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.