Ich kann nicht immer vor der Scheibe stehn.
Meine Haare wachsen auf einmal weich aus dem Kinn.
Ich habe Menschengesichter nie angesehn.
Mein Anzug wird so weit. Ich versinke drin.
Die Pflasterkugeln sind heiß, der Stein rutscht unter mir weg.
Ich bin ja ganz klein. Wer sieht mich? Wer weiß von mir?
Mauern wölben sich auf die Augen wie hohle Hände voll Dreck.
Gelb kreisen Lichtersäulen. Fernher droht Stank von Bier.
Bärte zittern spitz. Ein Kneifer fällt, sicher klirrt′s auf dem Tische.
Hab ich mich neulich mit dieser grünen Hure gerollt?
Über schwarze Bäuche streichen Daumen dick und still wie weiße Fische.
Träge Zähne schnappen im Rauch. Da schweben unerschwingliche Plomben von Gold.
Es riecht nach Zwiebeln. Ich habe in allen Weibern gesteckt.
Wo ist die Straße hin? Ich stehe im dunklen Gang.
Ein schwarzes Loch weicht auf. Das Licht drüben ist dünn und verfleckt.
Mir ist kalt. Die Scheibe ist hoch und dick. Alles dauert so lang.
Ein heller Glaskreis spritzt Licht, rund um mich sind glänzende Scheiben.
Unter den Tischen drängen Schuhe und Röcke und verfließen am Rand.
Alle Leute sind klein wie ich. Ich strecke mich hoch. Wo soll ich bleiben?
Wo sind meine Füße? Die Menschen sind ruhig. Finde ich meine Hand?
Die Wimpern werfen mir trübe Netze über den Blick.
Goldene Nägel flitzen hin und her durch die Nacht.
Die Menschen im Café sitzen faul und dick.
Es ist heiß. Mein Herz platzt. Mein Schuh kracht.
Ich stehe fest. Hinter dieser Scheibe kann ich sie wie im Regen sehn.
Ich atme aufs Glas. Meine Hände sind fort. Räder fahren vorbei.
Aus der Eisenbahn sah ich am Wege Windmühlenflügel drehn.
Jetzt fliegt die Bombe. Schnell. Es ist noch still. Kein Schrei.
Attentat in der Rue – –
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
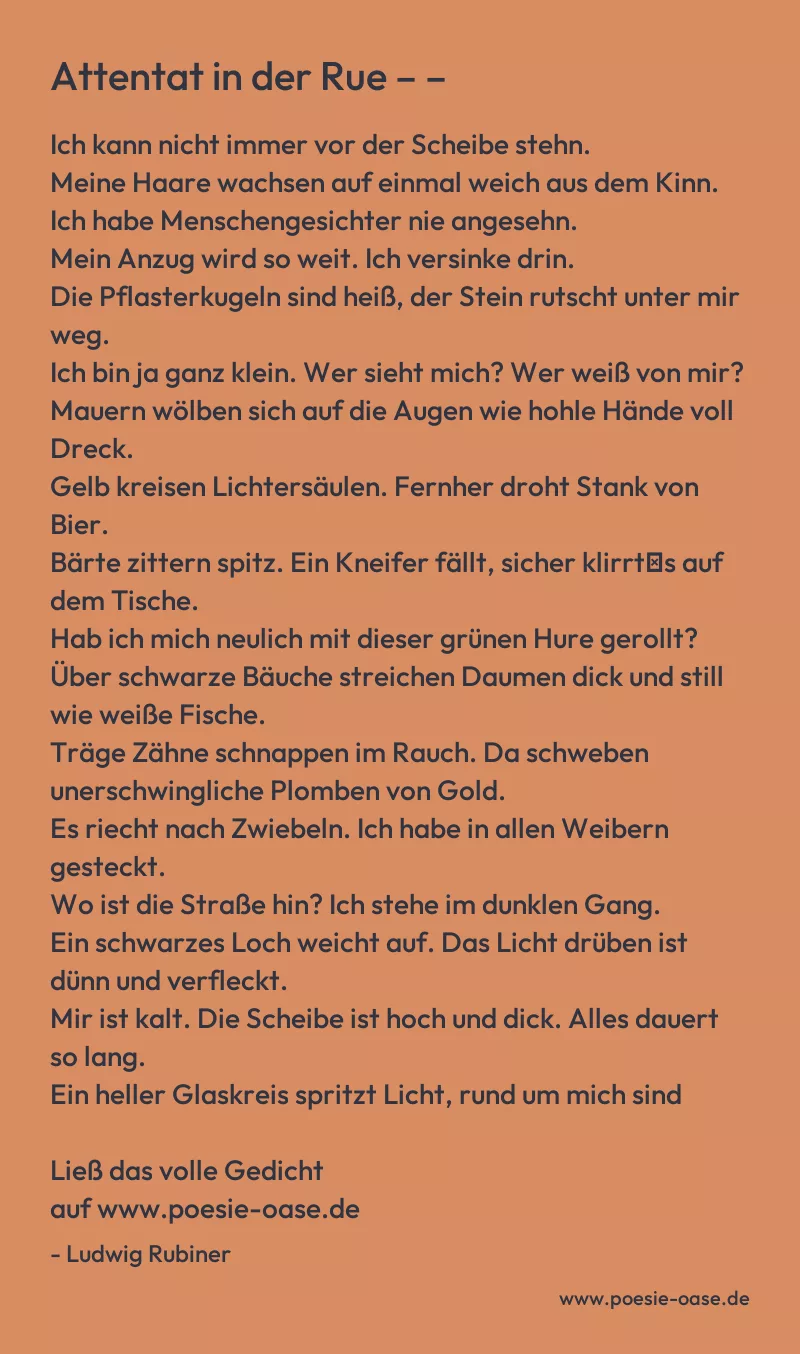
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Attentat in der Rue – –“ von Ludwig Rubiner ist eine impressionistische Momentaufnahme, die die innere Erfahrung eines Beobachters kurz vor oder während eines Anschlags einfängt. Die fragmentierte Sprache und die sinnlichen Eindrücke vermitteln ein Gefühl von Verwirrung, Angst und Entfremdung. Der Titel selbst, der auf einen konkreten Schauplatz verweist, deutet auf die politische und soziale Dimension des Gedichts hin, die jedoch durch die subjektive Wahrnehmung des Sprechers gefiltert wird.
Das Gedicht beginnt mit der Unfähigkeit des Sprechers, dem Geschehen zu entgehen („Ich kann nicht immer vor der Scheibe stehn“). Es folgen rasch wechselnde Eindrücke von körperlicher Veränderung und sozialer Isolation. Der Sprecher nimmt seine eigene, scheinbar verletzliche und unauffällige Existenz wahr („Ich bin ja ganz klein. Wer sieht mich? Wer weiß von mir?“). Die Umgebung wird als bedrohlich und entfremdet geschildert, mit Bildern von „Mauern“, „Gelb kreisenden Lichtersäulen“ und dem „Stank von Bier“. Dies deutet auf ein Milieu von Ungesundheit, vielleicht auch auf einen Ort der Dekadenz und der Gewalt. Die Erinnerungen an vergangene Erlebnisse, wie die Frage nach der „grünen Hure“ oder dem „Stecken in allen Weibern“ verleihen dem Gedicht eine erotische Komponente.
Der Fokus des Gedichts verlagert sich auf das Wahrnehmungsfeld des Sprechers. Die Umgebung wird durch die beschriebenen Sinneseindrücke und deren assoziative Verknüpfungen zu einer beängstigenden und unheimlichen Szenerie, in der der Sprecher sich verloren und unsicher fühlt. Die Sprache ist oft fragmentarisch und unvollständig, was die innere Unruhe und das Gefühl der Desorientierung des Sprechers widerspiegelt. Die Aufzählung verschiedener Sinneseindrücke wie Gerüche („Es riecht nach Zwiebeln“), Geräusche („Bärte zittern spitz. Ein Kneifer fällt, sicher klirrt′s auf dem Tische.“) und taktile Wahrnehmungen („Über schwarze Bäuche streichen Daumen dick und still wie weiße Fische“) trägt zur Schaffung einer intensiven Atmosphäre bei.
Das Gedicht endet mit der Erwartung und dem Ausbruch der Gewalt. Die Szene im Café wird durch die „Scheibe“ getrennt wahrgenommen. Der Sprecher fühlt sich durch die schützende Scheibe abgetrennt vom eigentlichen Geschehen („hinter dieser Scheibe kann ich sie wie im Regen sehn“). Der Übergang zur Gewalt („Jetzt fliegt die Bombe. Schnell. Es ist noch still. Kein Schrei.“) erfolgt abrupt, wobei die Stille und das Fehlen eines Schreis die unmittelbare Katastrophe noch verstärken. Damit verdeutlicht Rubiner die Zerrissenheit des Sprechers, die zwischen Beobachtung, Angst und der unmittelbar bevorstehenden Gewalt liegt.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
