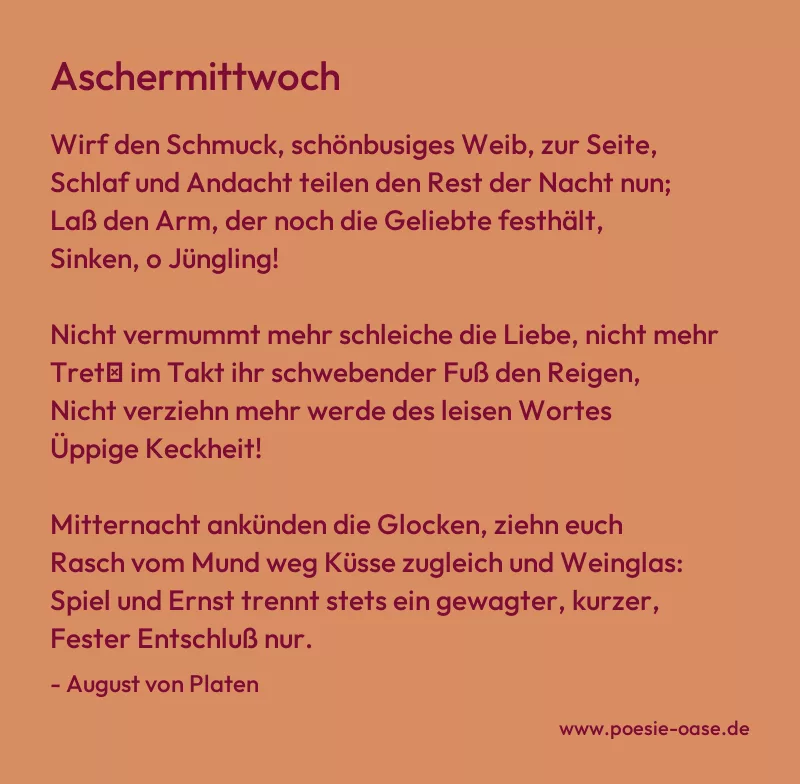Aschermittwoch
Wirf den Schmuck, schönbusiges Weib, zur Seite,
Schlaf und Andacht teilen den Rest der Nacht nun;
Laß den Arm, der noch die Geliebte festhält,
Sinken, o Jüngling!
Nicht vermummt mehr schleiche die Liebe, nicht mehr
Tret′ im Takt ihr schwebender Fuß den Reigen,
Nicht verziehn mehr werde des leisen Wortes
Üppige Keckheit!
Mitternacht ankünden die Glocken, ziehn euch
Rasch vom Mund weg Küsse zugleich und Weinglas:
Spiel und Ernst trennt stets ein gewagter, kurzer,
Fester Entschluß nur.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
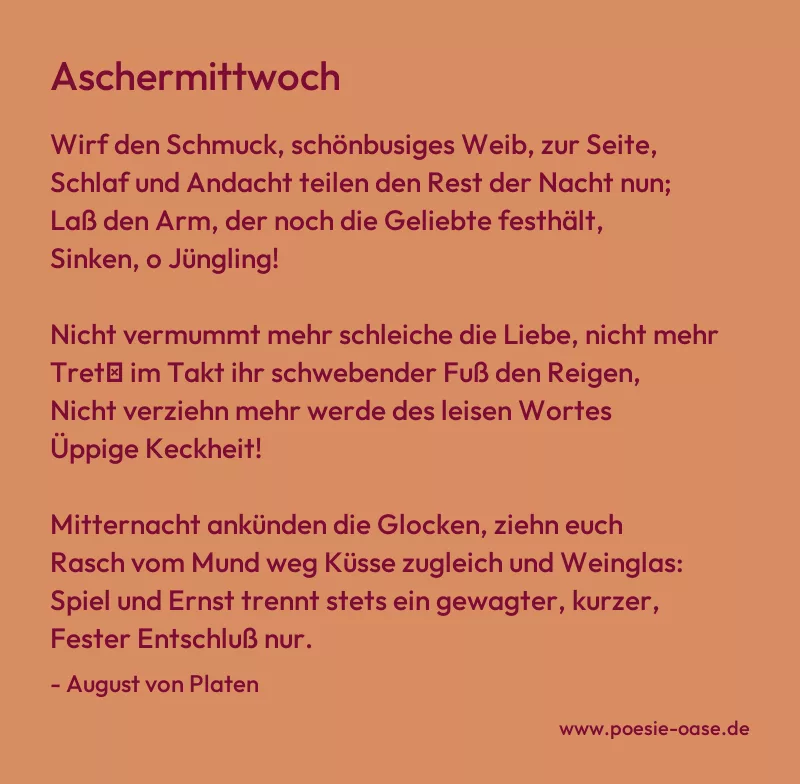
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Aschermittwoch“ von August von Platen thematisiert die Vergänglichkeit weltlicher Freuden und die Notwendigkeit der Abkehr von weltlichen Genüssen, um sich auf Spiritualität und Ernsthaftigkeit zu konzentrieren. Es ist ein Aufruf zur Selbstreflexion und zur Besinnung auf das Wesentliche, der in der Tradition des Aschermittwochs, dem Beginn der Fastenzeit, steht.
Das Gedicht wendet sich direkt an „schönbusiges Weib“ und „Jüngling“, die stellvertretend für die Welt der Sinnlichkeit und des Genusses stehen. Die erste Strophe fordert beide auf, den Schmuck, die Sinnlichkeit und die Liebe, die sie festhalten, abzulegen. Der Appell zum „Sinken“ des Arms des Jünglings verdeutlicht die Notwendigkeit, die körperliche Anziehungskraft und die sinnlichen Freuden loszulassen. Dies ist ein erster Schritt zur Reinigung und zur Vorbereitung auf eine Zeit der inneren Einkehr.
In der zweiten Strophe wird die Abkehr von der Liebeswelt und von weltlichen Freuden noch deutlicher. Die „Liebe“ soll nicht mehr „vermummt schleichen“, was suggeriert, dass die geheimen, heimlichen Aspekte der Liebe, die im Widerspruch zur öffentlichen Moral stehen, aufgegeben werden müssen. Auch das „leise Wort“ und seine „üppige Keckheit“ sollen vermieden werden, was eine Distanzierung von unbedachten Äußerungen und Handlungen impliziert, die durch die Leidenschaft getrieben sind. Die Metapher des Reigens steht hier für das freudvolle, unbeschwerte Leben, das nun zurückgelassen werden soll.
Die dritte Strophe führt die Botschaft konsequent fort. Die Glocken, die die Mitternacht ankündigen, symbolisieren den Übergang und die Notwendigkeit der Veränderung. Die Küsse und das Weinglas, Zeichen des weltlichen Genusses, müssen zurückgelassen werden. Das Gedicht schließt mit einem Aufruf zum „festen Entschluss“, der die Trennung von Spiel und Ernst beinhaltet. Dieser Entschluss, so die Kernaussage, ist der Schlüssel zur Überwindung der Vergänglichkeit und zur Hinwendung zu einem ernsteren, spirituelleren Leben. Das Gedicht verkörpert die Absicht, sich von oberflächlichen Vergnügungen abzuwenden und sich auf eine Zeit der Besinnung und Selbstreflexion vorzubereiten.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.