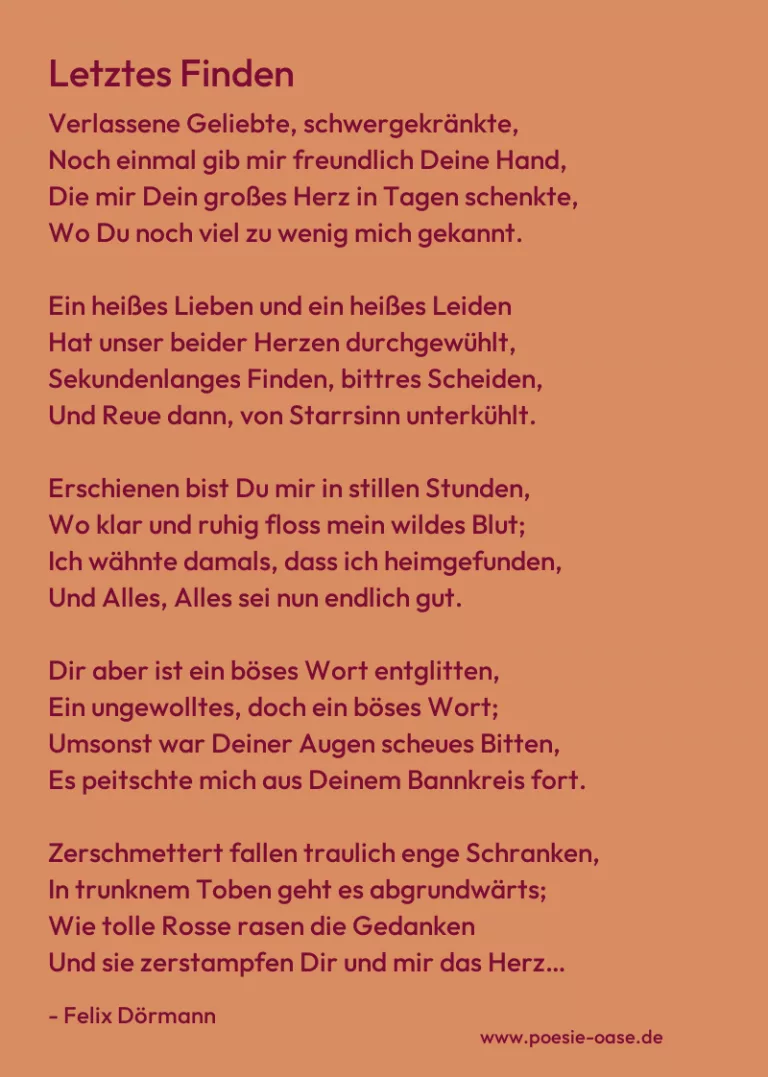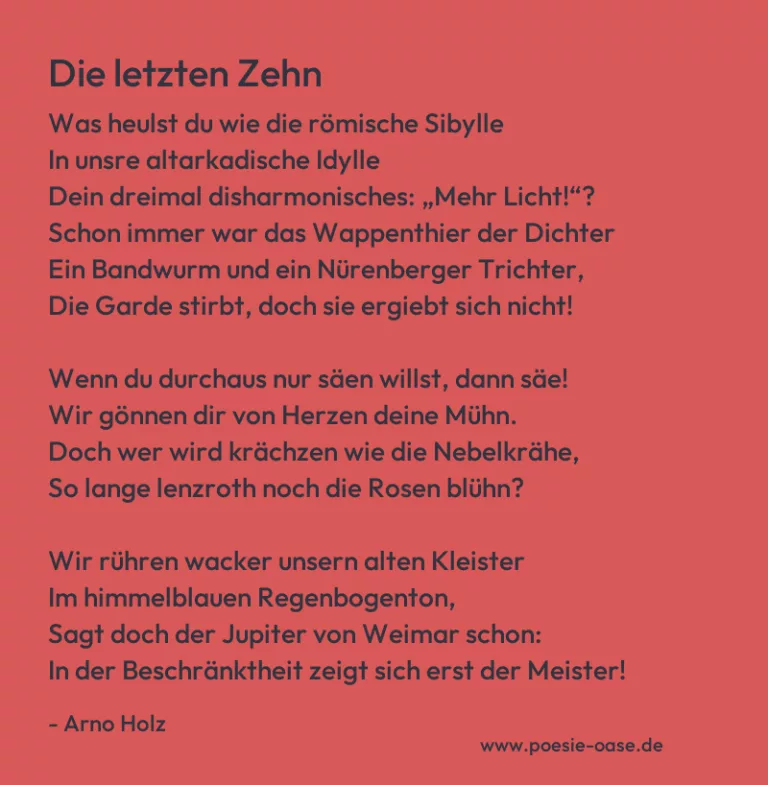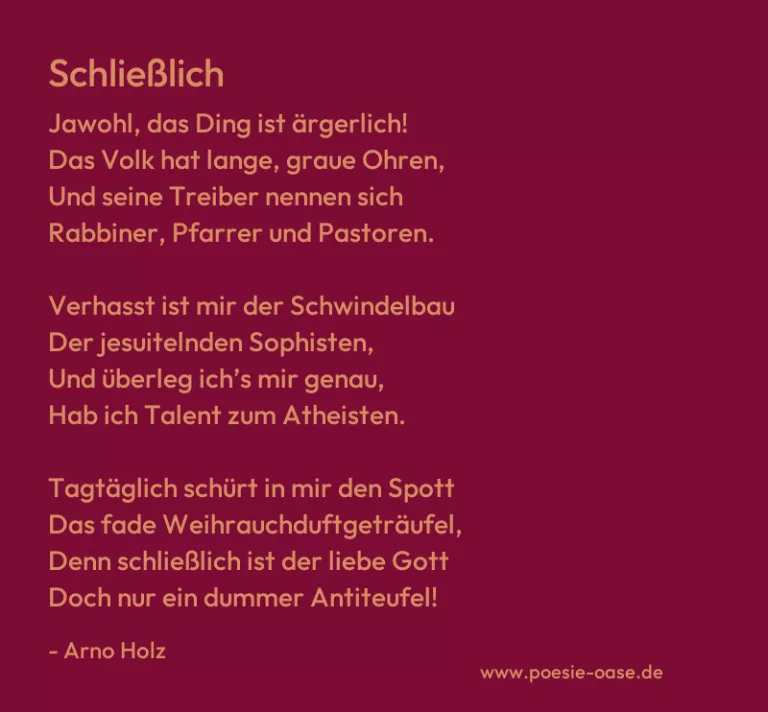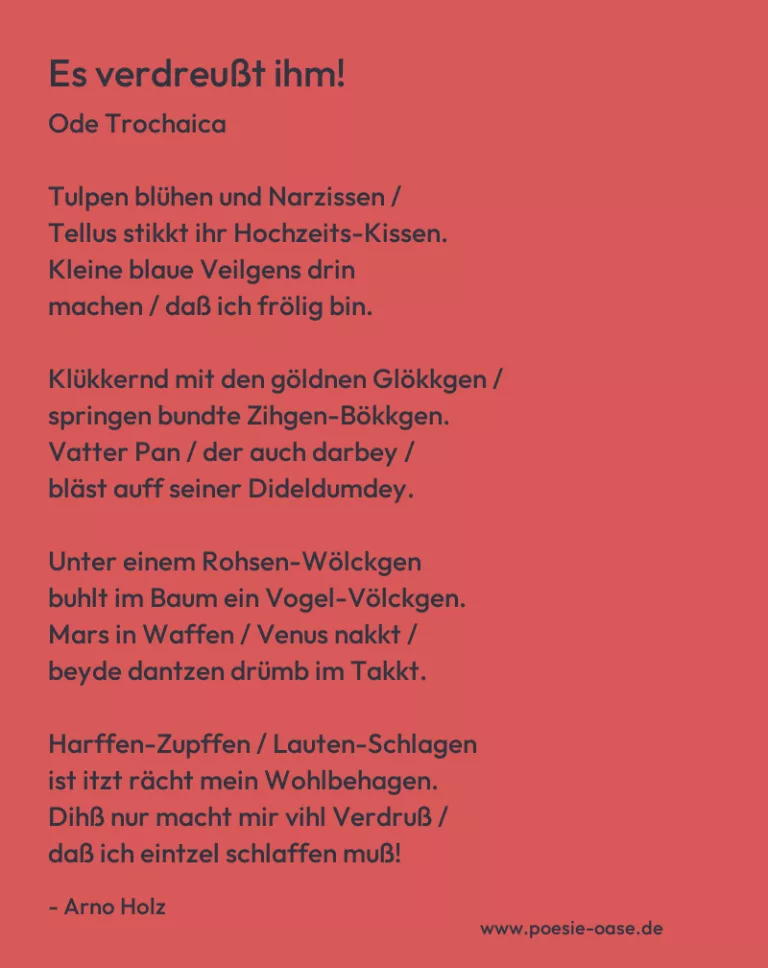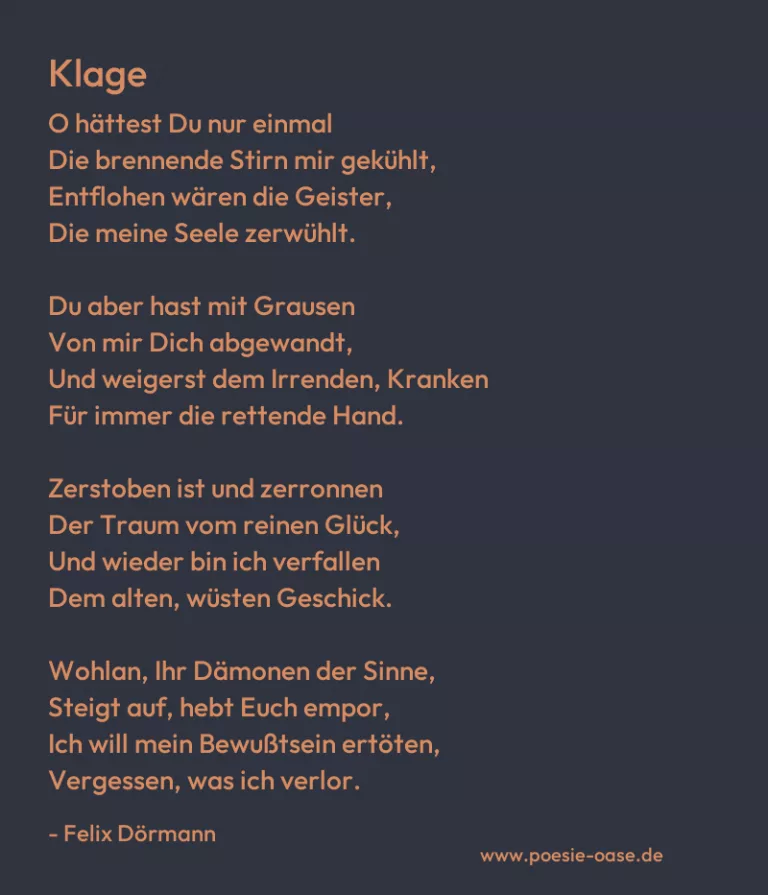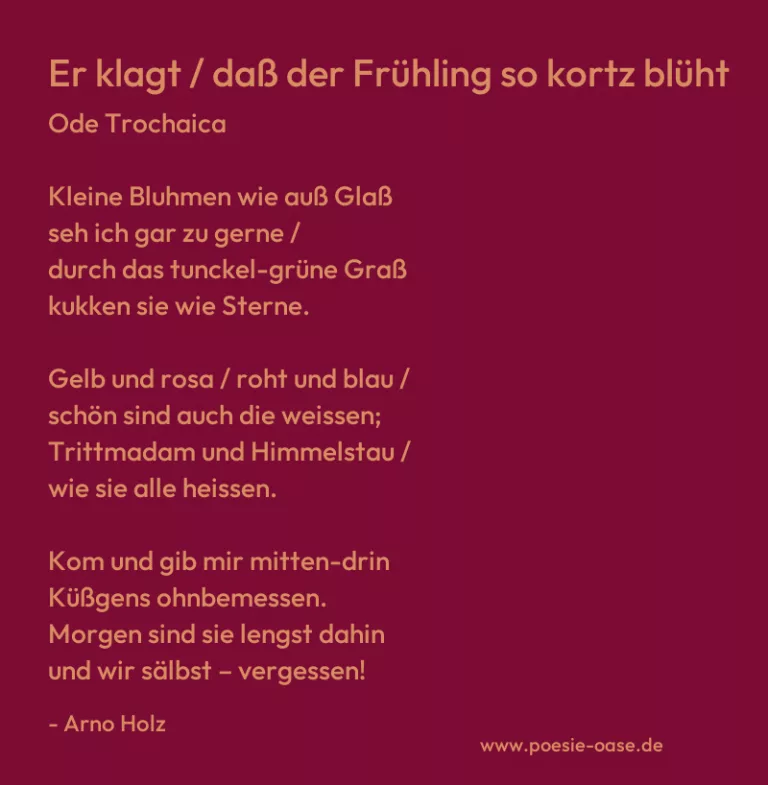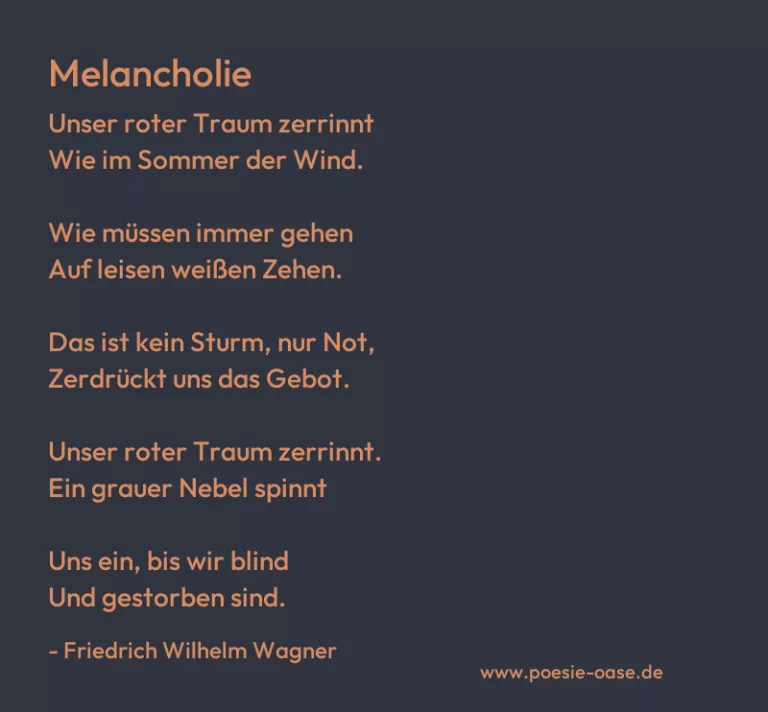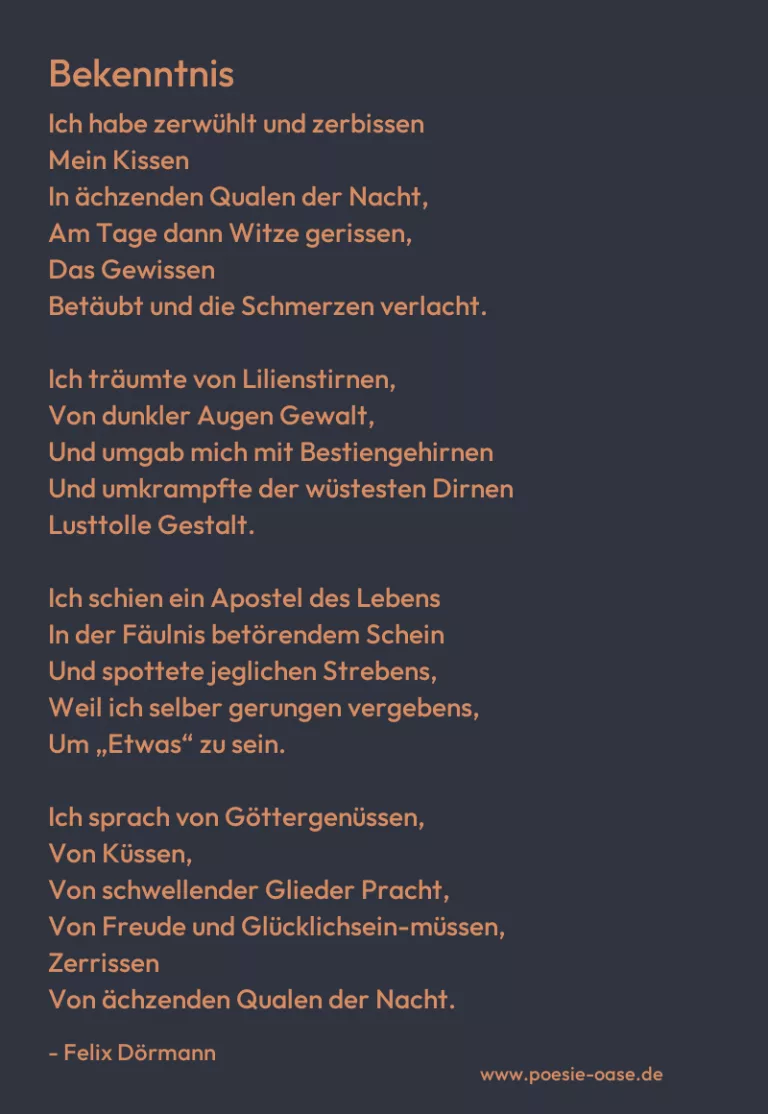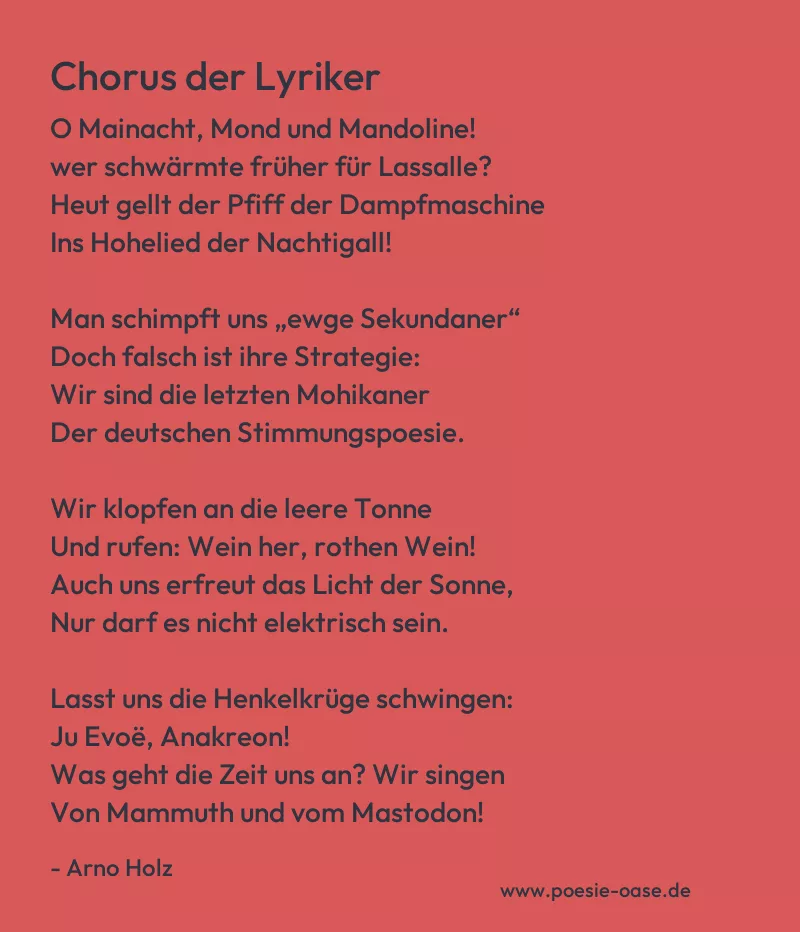Chorus der Lyriker
O Mainacht, Mond und Mandoline!
wer schwärmte früher für Lassalle?
Heut gellt der Pfiff der Dampfmaschine
Ins Hohelied der Nachtigall!
Man schimpft uns „ewge Sekundaner“
Doch falsch ist ihre Strategie:
Wir sind die letzten Mohikaner
Der deutschen Stimmungspoesie.
Wir klopfen an die leere Tonne
Und rufen: Wein her, rothen Wein!
Auch uns erfreut das Licht der Sonne,
Nur darf es nicht elektrisch sein.
Lasst uns die Henkelkrüge schwingen:
Ju Evoë, Anakreon!
Was geht die Zeit uns an? Wir singen
Von Mammuth und vom Mastodon!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
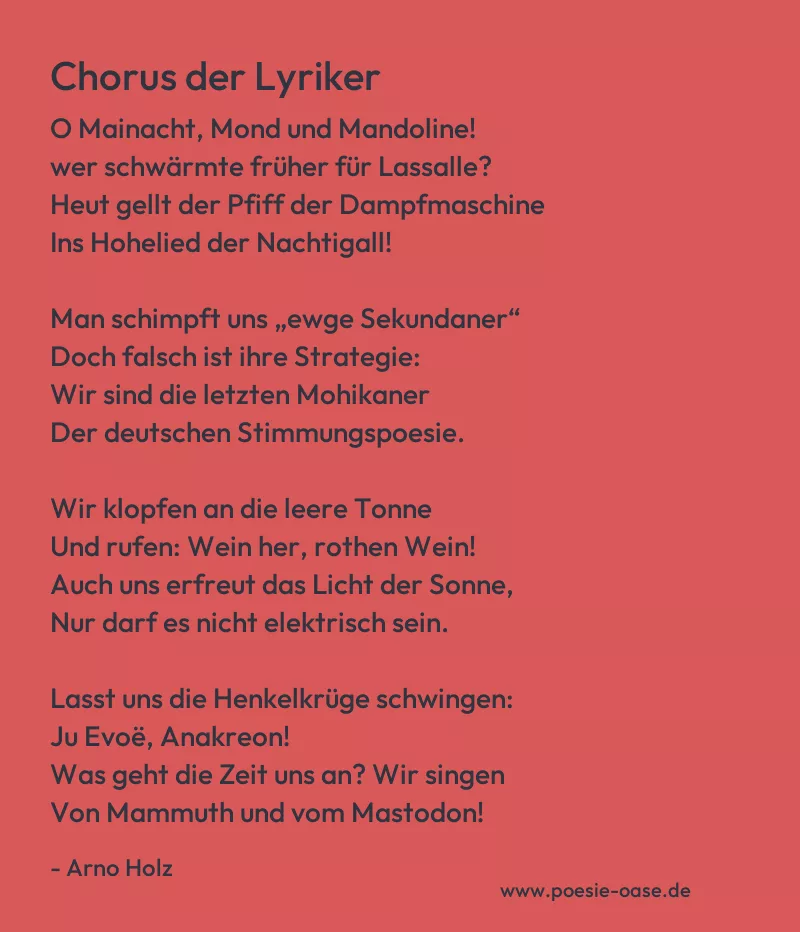
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Chorus der Lyriker“ von Arno Holz ist ein ironisches und gleichzeitig feierliches Bekenntnis zur Tradition der Lyrik und des romantischen Lebensgefühls. In der ersten Strophe setzt der Dichter das Bild der „Mainacht, Mond und Mandoline“ ein, was auf die ungebrochene Faszination für das romantische Bild der Natur und der Poesie verweist. Gleichzeitig wird der Gegensatz zur modernen Industriegesellschaft hervorgehoben, wenn „der Pfiff der Dampfmaschine“ das „Hohelied der Nachtigall“ übertönt. Hier wird die zunehmende Entfremdung von der natürlichen Welt und der Eintritt in eine mechanisierte, von Technik geprägte Ära symbolisiert.
In der zweiten Strophe reagiert der Dichter auf die Kritik an seiner Generation und ihrer vermeintlich überholten Kunst. Die „ewigen Sekundaner“ (die langsamen, alten Denker) und die falsche Strategie der Kritiker, die in dieser Haltung eine Schwäche sehen, werden abgewiesen. Der Dichter betrachtet sich als „letzter Mohikaner“ der „deutschen Stimmungspoesie“, was auf eine Art heroische Selbstverortung innerhalb einer fast verschwundenen Tradition hinweist. Diese Haltung stellt sich als Widerstand gegen die Veränderungen und den Verlust der natürlichen Poesie dar, die durch die Industrialisierung und die moderne Welt bedroht wird.
Die dritte Strophe zeigt den Dichter als einen Rebellen gegen die moderne Zivilisation. „Wir klopfen an die leere Tonne / Und rufen: Wein her, rothen Wein!“ – hier wird das Bild des einfachen, sinnlichen Lebens gefeiert, das sich von der hochentwickelten, mechanisierten Welt abwendet. Die Abneigung gegen „elektrisches“ Licht, das die „echte Sonne“ ersetzt, verstärkt den Wunsch nach Authentizität und Natürlichkeit. Der Dichter ist in seiner Feier der sinnlichen Freuden und der Vergangenheit in einer Welt der Industrialisierung und Fortschrittskritik gefangen.
In der letzten Strophe wird eine verspielte Feier des alten Lebensstils hervorgehoben, als die Lyriker „Henkelkrüge schwingen“ und „Ju Evoë, Anakreon“ rufen. Das Bild der antiken Feierlichkeiten und der Weinkultur verweist auf eine Zeit, in der die Dichter sich in Gemeinschaft und Musik und nicht in der rationalisierten Welt der Moderne verloren. Die Bezugnahme auf „Mammuth und Mastodon“ verweist auf eine epische, fast prähistorische Zeit, die noch in den Gedanken der Dichter lebt und die Gegenwart der modernen Gesellschaft in Frage stellt. So zeigt das Gedicht die Sehnsucht nach einer vergangenen, unverfälschten Zeit und einem Widerstand gegen die Rationalisierung und Mechanisierung der menschlichen Erfahrung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.