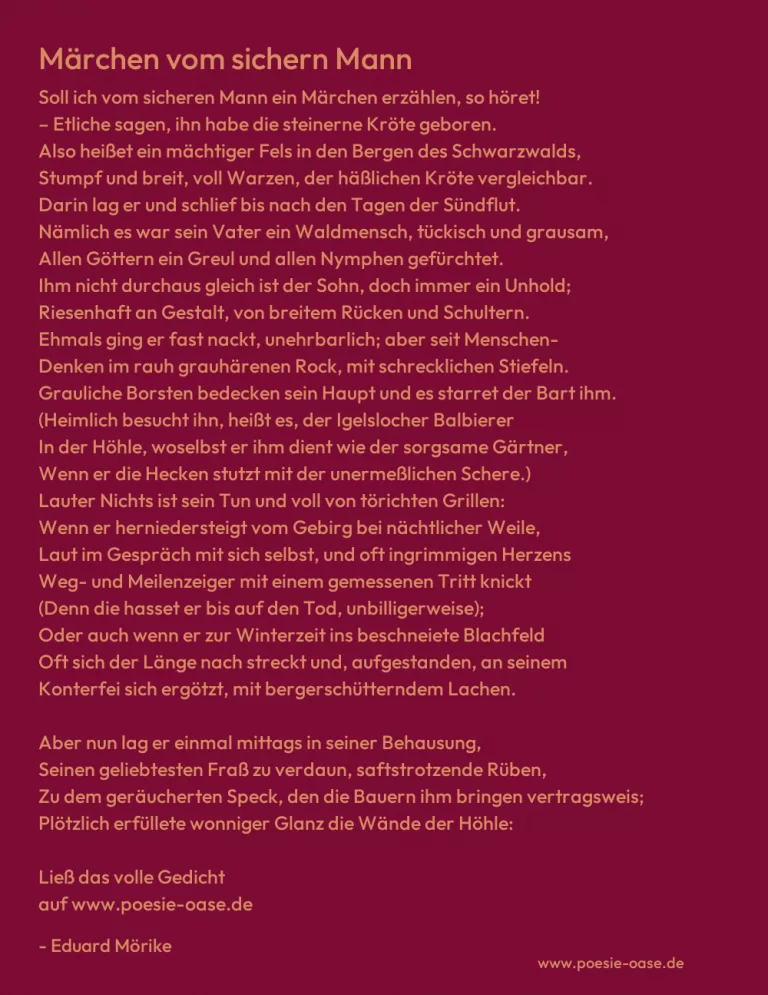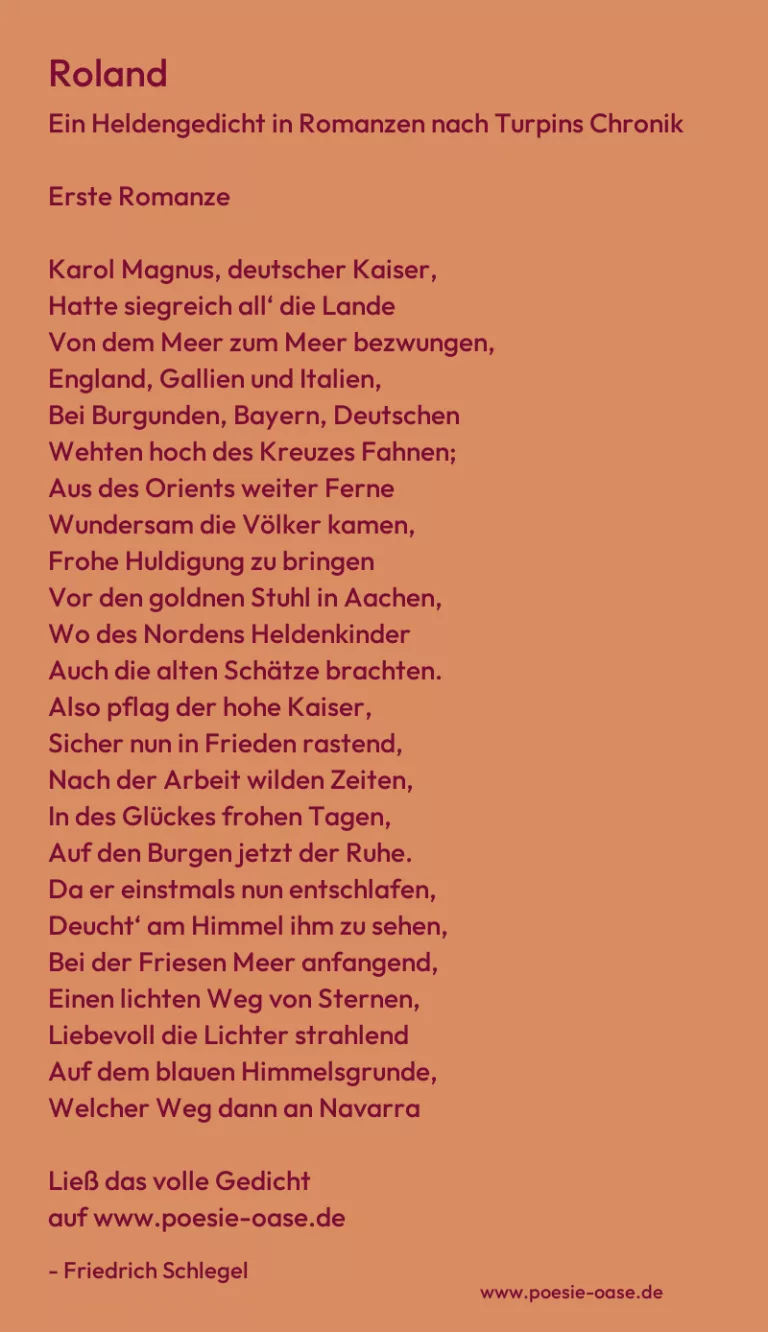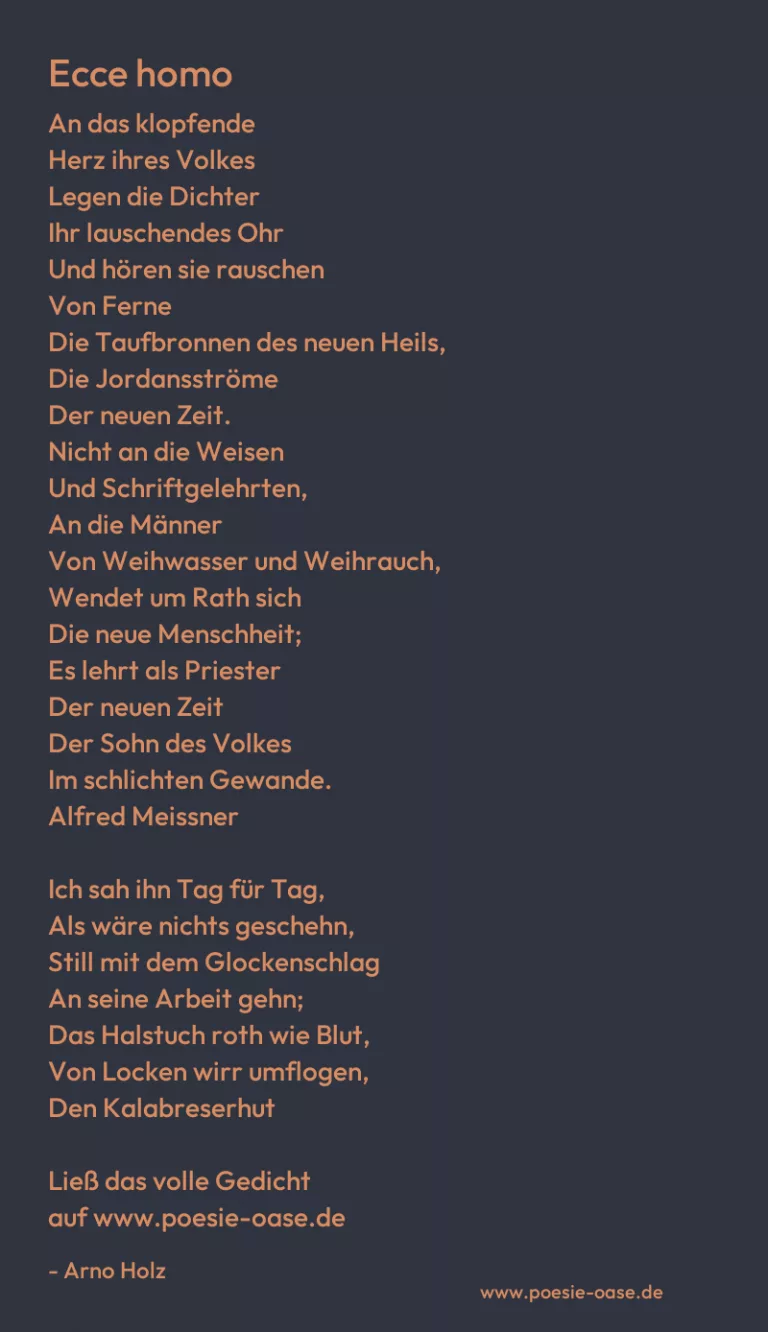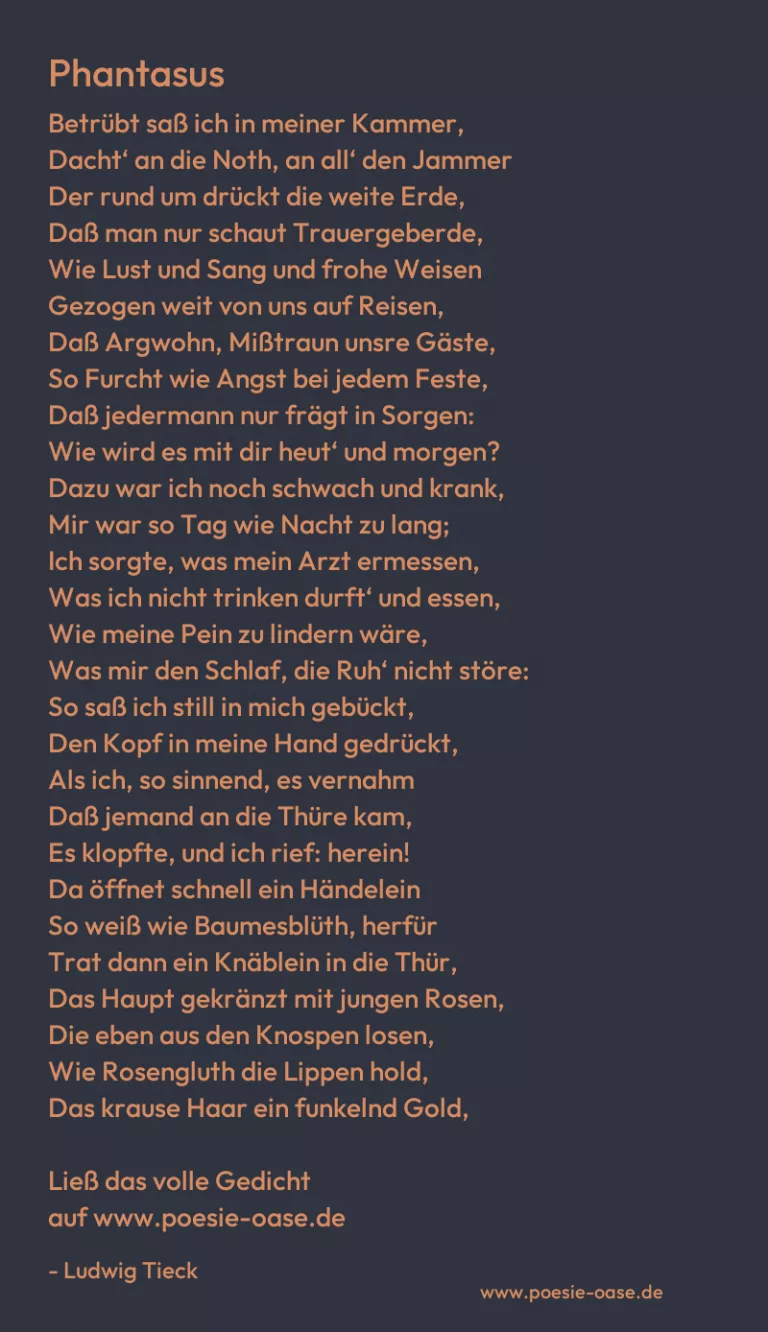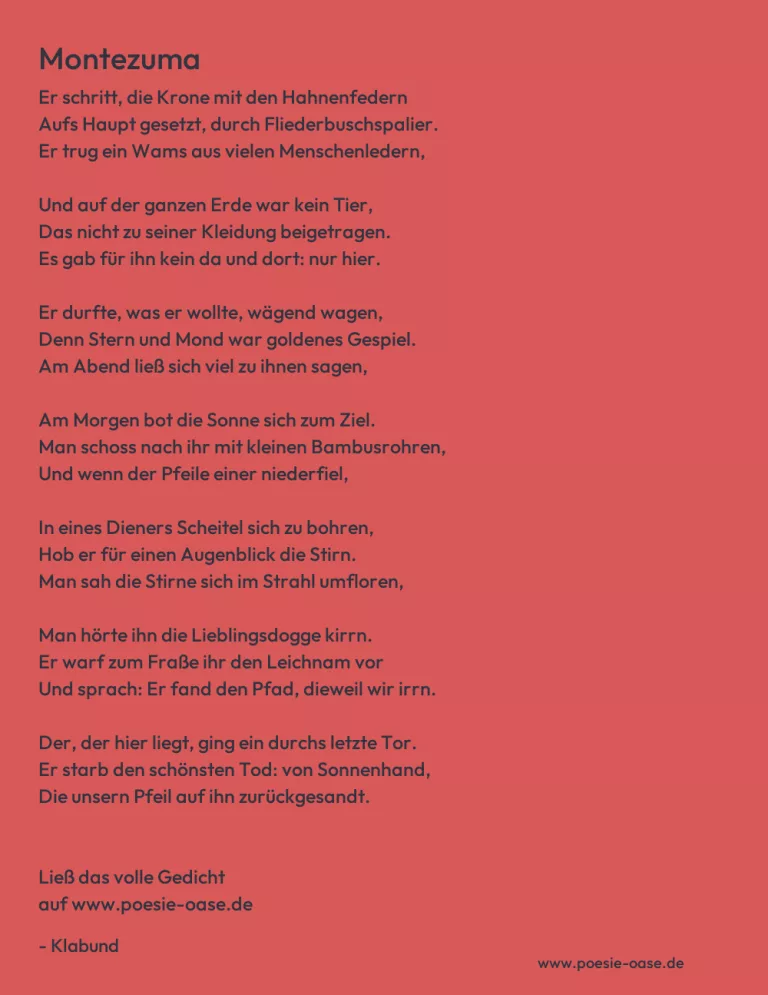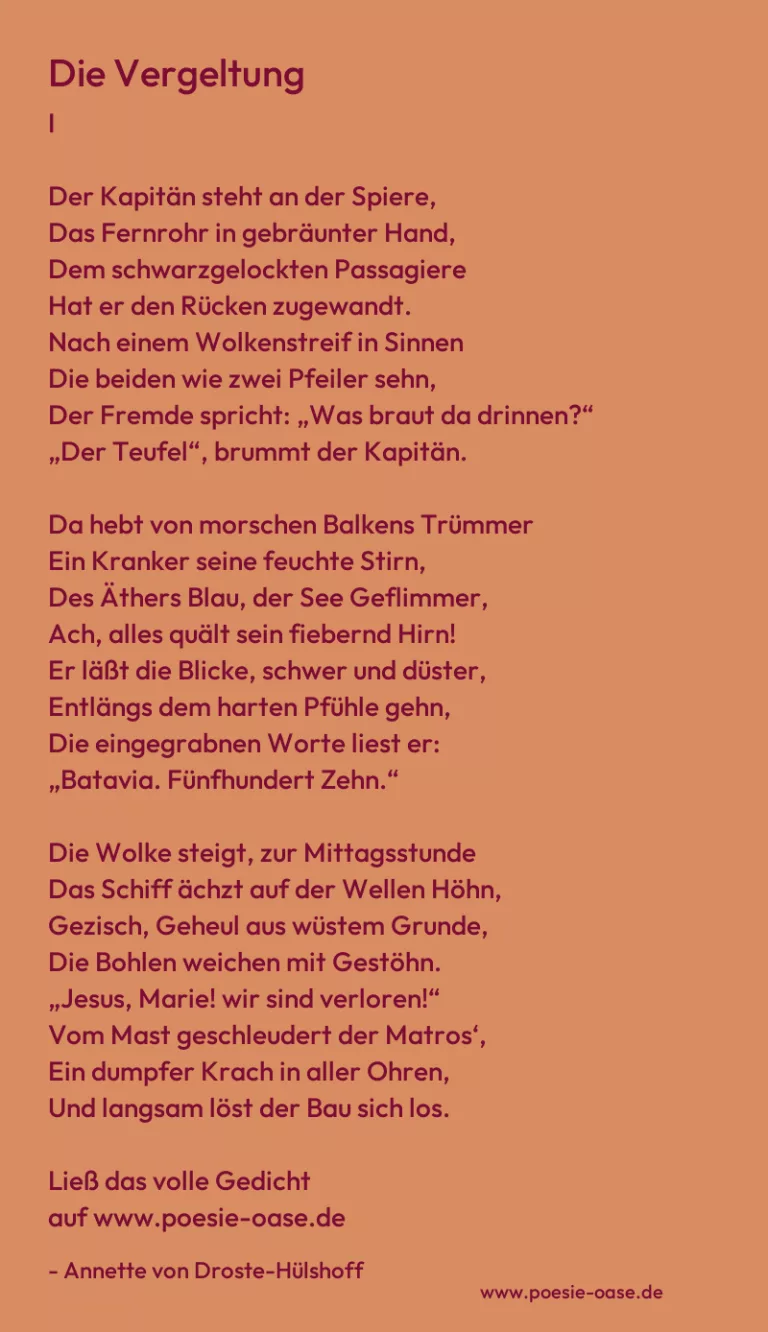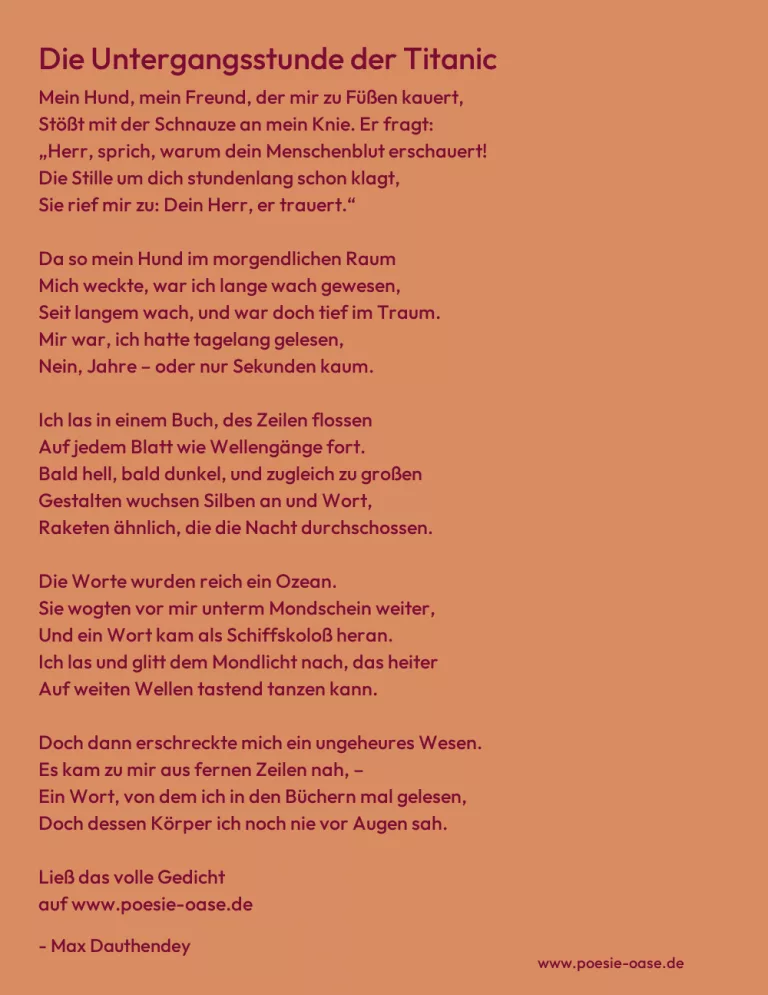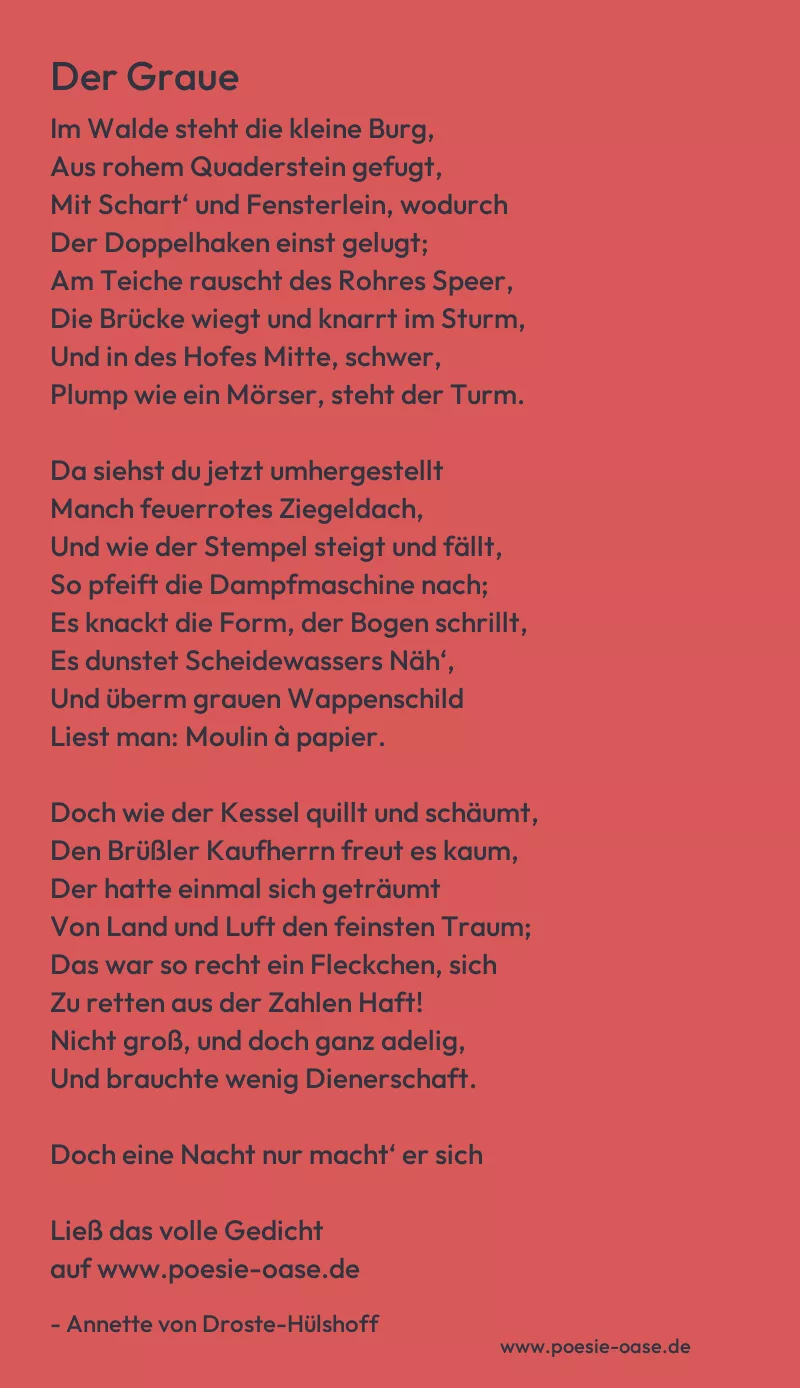Im Walde steht die kleine Burg,
Aus rohem Quaderstein gefugt,
Mit Schart‘ und Fensterlein, wodurch
Der Doppelhaken einst gelugt;
Am Teiche rauscht des Rohres Speer,
Die Brücke wiegt und knarrt im Sturm,
Und in des Hofes Mitte, schwer,
Plump wie ein Mörser, steht der Turm.
Da siehst du jetzt umhergestellt
Manch feuerrotes Ziegeldach,
Und wie der Stempel steigt und fällt,
So pfeift die Dampfmaschine nach;
Es knackt die Form, der Bogen schrillt,
Es dunstet Scheidewassers Näh‘,
Und überm grauen Wappenschild
Liest man: Moulin à papier.
Doch wie der Kessel quillt und schäumt,
Den Brüßler Kaufherrn freut es kaum,
Der hatte einmal sich geträumt
Von Land und Luft den feinsten Traum;
Das war so recht ein Fleckchen, sich
Zu retten aus der Zahlen Haft!
Nicht groß, und doch ganz adelig,
Und brauchte wenig Dienerschaft.
Doch eine Nacht nur macht‘ er sich
Bequem es – oder unbequem –
In seinem Schlößchen, und er strich
Nur wie ein Vogel dran seitdem.
Sah dann er zu den Fenstern auf,
Verschlossen wie die Sakristein,
So zog er wohl die Schultern auf,
Mit einem Seufzer, oder zwein.
Es war um die Septemberzeit,
Als, schürend des Kamines Brand,
Gebückt, in regenfeuchtem Kleid,
Der Hausherr in der Halle stand,
Er und die Gäste, all im Rauch;
Van Neelen, Redel, Verney, Dahm,
Und dann der blonde Waller auch,
Der eben erst aus Smyrna kam.
Im Schlote schnob der Wind, es goß
Der Regen sprudelnd sich vom Dach,
Und wenn am Brand ein Flämmchen schoß,
Schien doppelt öde das Gemach.
Die Gäste waren all zur Hand,
Erleichternd ihres Wirtes Müh‘;
Van Neelen nur am Fenster stand,
Und schimpfte auf die Landpartie.
Doch nach und nach mag’s besser gehn,
Schon hat der Wind die Glut gefacht,
Den Regen läßt man draußen stehn,
Champagnerflaschen sind gebracht.
Die Leuchter hatten wenig Wert,
Es ging wie beim Studentenfest:
Sobald die Flasche ist geleert,
Wird eine Kerze drauf gepreßt.
Je mehr es fehlt, so mehr man lacht,
Der Wein ist heiß, die Kost gewählt,
Manch derbes Späßchen wird gemacht,
Und mancher feine Streich erzählt.
Zuletzt von Wein und Reden glüh,
Rückt seinen Stuhl der Herr vom Haus:
„Ich lud euch zu ’ner Landpartie,
Es ward ’ne Wasserfahrt daraus.
Doch da die allerschönste Fracht
Am Ende nach dem Hafen schifft,
So, meine Herren, gute Nacht!
Und nehmt vorlieb, wie es sich trifft.“
Da lachend nach den Flaschen greift
Ein jeder. – Türen auf und zu. –
Und Waller, noch im Gehen, streift
Aus seinem Frack den Ivanhoe.
Es war tief in die Nacht hinein,
Und draußen heulte noch der Sturm,
Schnob zischend an dem Fensterstein
Und drillt‘ den Glockenstrang am Turm.
In seinem Bette Waller lag,
Und las so scharf im Ivanhoe,
Daß man gedacht, bevor es Tag
Sei Englands Königreich in Ruh.
Er sah nicht, daß die Kerze tief
Sich brannte in der Flasche Rand,
Der Talg in schweren Tropfen lief,
Und drunten eine Lache stand.
Wie träumend hört‘ er das Geknarr
Der Fenster, vom Rouleau gedämpft,
Und wie die Türe mit Geschnarr
In ihren Angeln zuckt und kämpft.
Sehr freut er sich am Bruder Tuck,
– Die Sehne schwirrt, es rauscht der Hain –
Da plötzlich ein gewalt’ger Ruck,
Und, hui! die Scheibe klirrt hinein.
Er fuhr empor, – weg war der Traum –
Und deckte mit der Hand das Licht,
Ha! wie so wüst des Zimmers Raum!
Selbst ein romantisches Gedicht!
Der Sessel feudalistisch Gold –
Am Marmortisch die Greifenklau‘ –
Und überm Spiegel flatternd rollt,
Ein Banner, der Tapete Blau,
Im Zug der durch die Lücke schnaubt;
Die Ahnenbilder leben fast,
Und schütteln ihr behelmtes Haupt
Ergrimmt ob dem plebejen Gast.
Der blonde Waller machte gern
Sich selber einen kleinen Graus,
So nickt‘ er spöttisch gen die Herrn,
Als fordert‘ er sie keck heraus.
Die Glocke summt – schon eins fürwahr!
Wie eine Boa dehnt‘ er sich,
Und sah nach dem Pistolenpaar,
Dann rüstet‘ er zum Schlafe sich.
Die Flasche hob er einmal noch
Und leuchtete die Wände an,
Ganz wie ’ne alte Halle doch
Aus einem Scottischen Roman!
Und – ist das Nebel oder Rauch,
Was durch der Türe Spalten quillt,
Und, wirbelnd in des Zuges Hauch,
Die dunstigen Paneele füllt?
Ein Ding – ein Ding – wie Grau in Grau,
Die Formen schwanken – sonderbar! –
Doch, ob der Blick sich schärft? den Bau
Von Gliedern nimmt er mählich wahr.
Wie überm Eisenhammer, schwer
Und schwarz, des Rauches Säule wallt;
Ein Zucken flattert drüben her,
Doch – hat es menschliche Gestalt!
Er war ein hitziger Kumpan,
Wenn Wein die Lava hat geweckt.
„Qui vive!“ – und leise knackt der Hahn,
Der Waller hat den Arm gestreckt:
„Qui vive!“ – ’ne Pause, – „ou je tire!“
Und aus dem Lauf die Kugel knallt;
Er hört sie schlagen an die Tür,
Und abwärts prallen mit Gewalt.
Der Schuß dröhnt am Gewölbe nach,
Und, eine schwere Nebelschicht,
Füllt Pulverbrodem das Gemach;
Er teilt sich, schwindet, das Gesicht
Steht in des Zimmers Mitte jetzt,
Ganz wie ein graues Bild von Stein,
Die Formen scharf und unverletzt,
Die Züge edel, streng und rein.
Auf grauer Locke grau Barett,
Mit grauer Hahnenfeder drauf.
Der Waller hat so sacht und nett
Sich hergelangt den zweiten Lauf.
Noch zögert er – ist es ein Bild,
Wär’s zu zerschießen lächerlich;
Und wär’s ein Mensch – das Blut ihm quillt –
Ein Geck, der unterfinge sich -?!
Ein neuer Ruck, und wieder Knall
Und Pulverrauch – war das Gestöhn?
Er hörte keiner Kugel Prall –
Es ist vorüber! ist geschehn!
Der Waller zuckt: „Verdammtes Hirn!“
Mit einmal ist er kalt wie Eis,
Der Angstschweiß tritt ihm auf die Stirn,
Er starret in den Nebelkreis.
Ein Ächzen! oder Windeshauch! –
Doch nein, der Scheibensplitter schwirrt.
O Gott, es zappelt! – nein – der Rauch
Gedrängt vom Zuge schwankt und irrt;
Es wirbelt aufwärts, woget, wallt,
Und, wie ein graues Bild von Stein,
Steht nun am Bette die Gestalt,
Da, wo der Vorhang sinkt hinein.
Und drüber knistert’s, wie von Sand,
Wie Funke, der elektrisch lebt;
Nun zuckt ein Finger – nun die Hand –
Allmählich nun ein Fuß sich hebt, –
Hoch – immer höher – Waller winkt;
Dann macht er schnell gehörig Raum,
Und langsam in die Kissen sinkt
Es schwer, wie ein gefällter Baum.
„Ah, je te tiens!“ er hat’s gepackt,
Und schlingt die Arme wie ’nen Strick, –
Ein Leichnam! todessteif und nackt!
Mit einem Ruck fährt er zurück;
Da wälzt es langsam, schwer wie Blei,
Sich gleich dem Mühlstein über ihn;
Da tat der Waller einen Schrei,
Und seine Sinne waren hin.
Am nächsten Morgen fand man kalt
Ihn im Gemache ausgestreckt;
’s war eine Ohnmacht nur, und bald
Ward zum Bewußtsein er geweckt.
Nicht irre war er, nur gepreßt,
Und fragt‘ ob keiner ward gestört?
Doch alle schliefen überfest,
Nicht einer hat den Schuß gehört.
So ward es denn für Traum sogleich,
Und alles für den Alp erkannt;
Doch zog man sich aus dem Bereich,
Und trollte hurtig über Land.
Sie waren alle viel zu klug,
Und vollends zu belesen gar;
Allein der blonde Waller trug
Seit dieser Nacht eisgraues Haar.