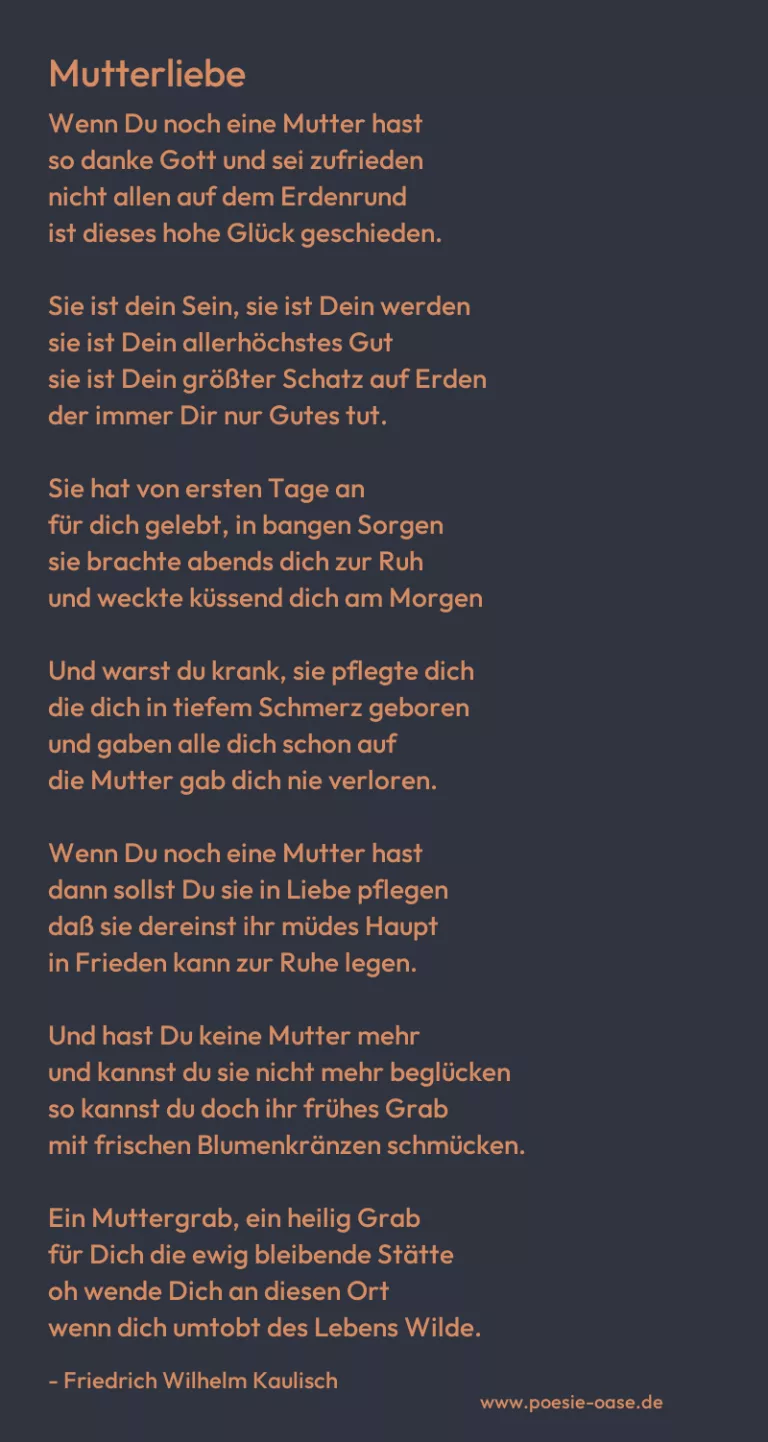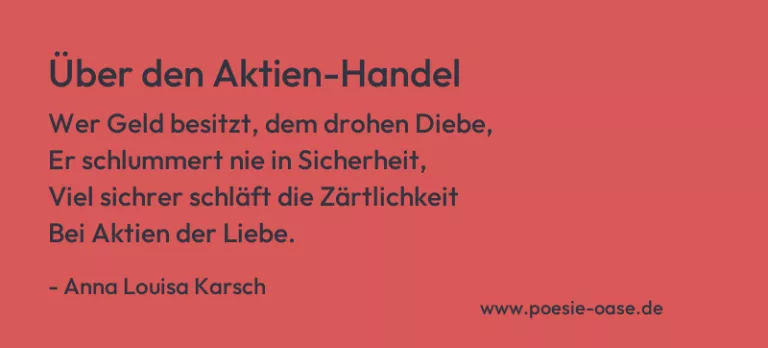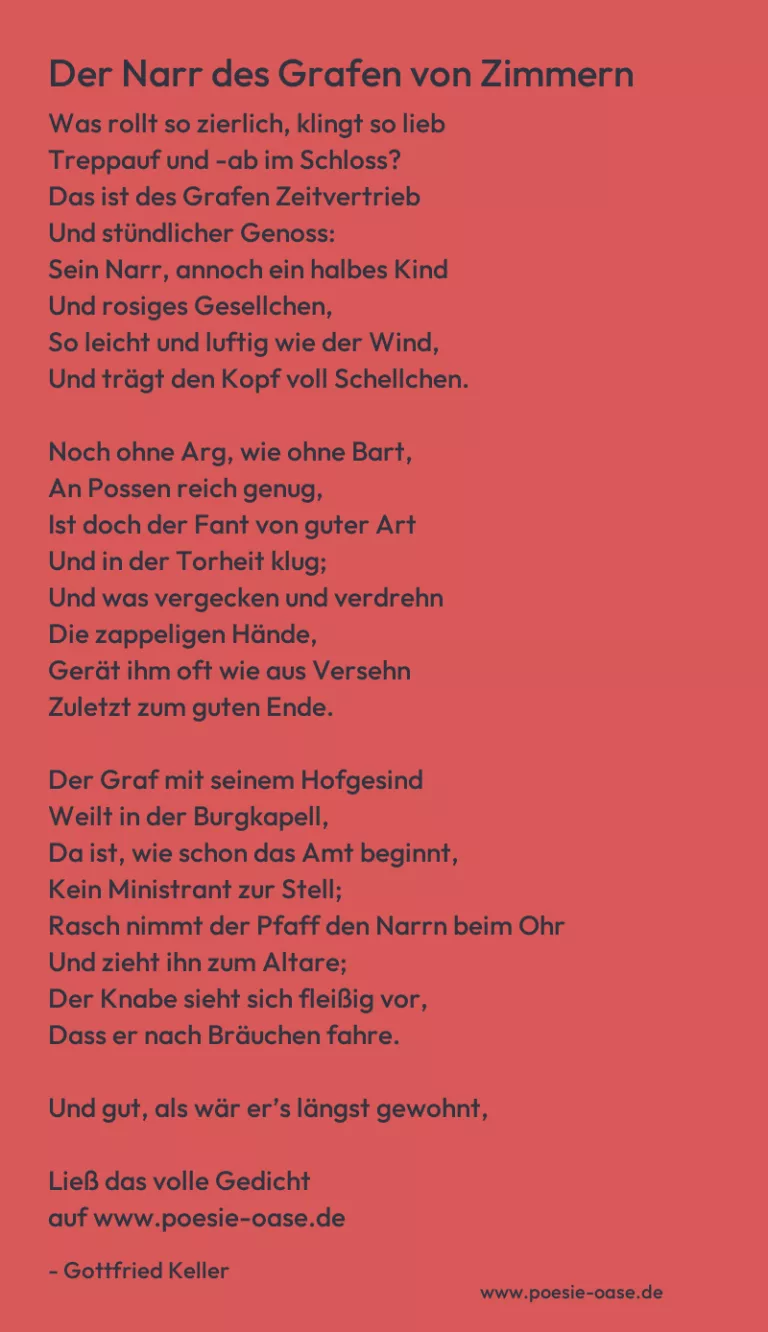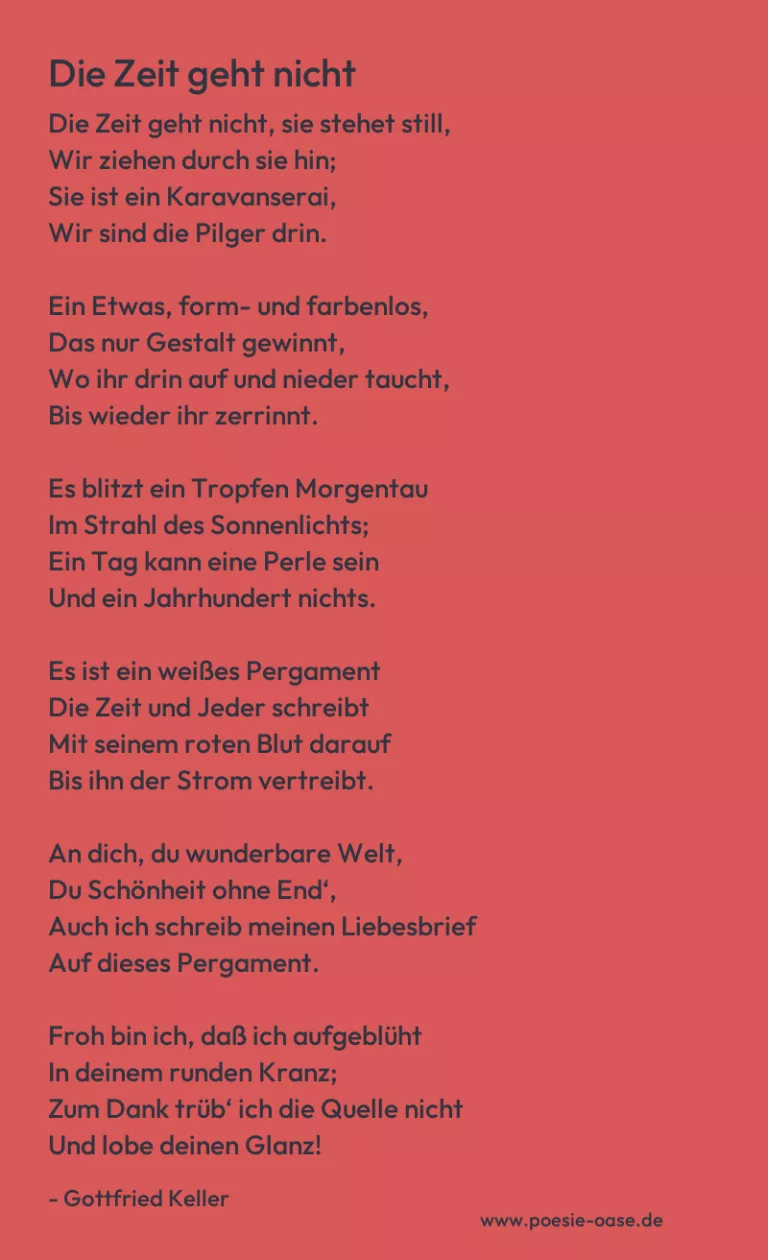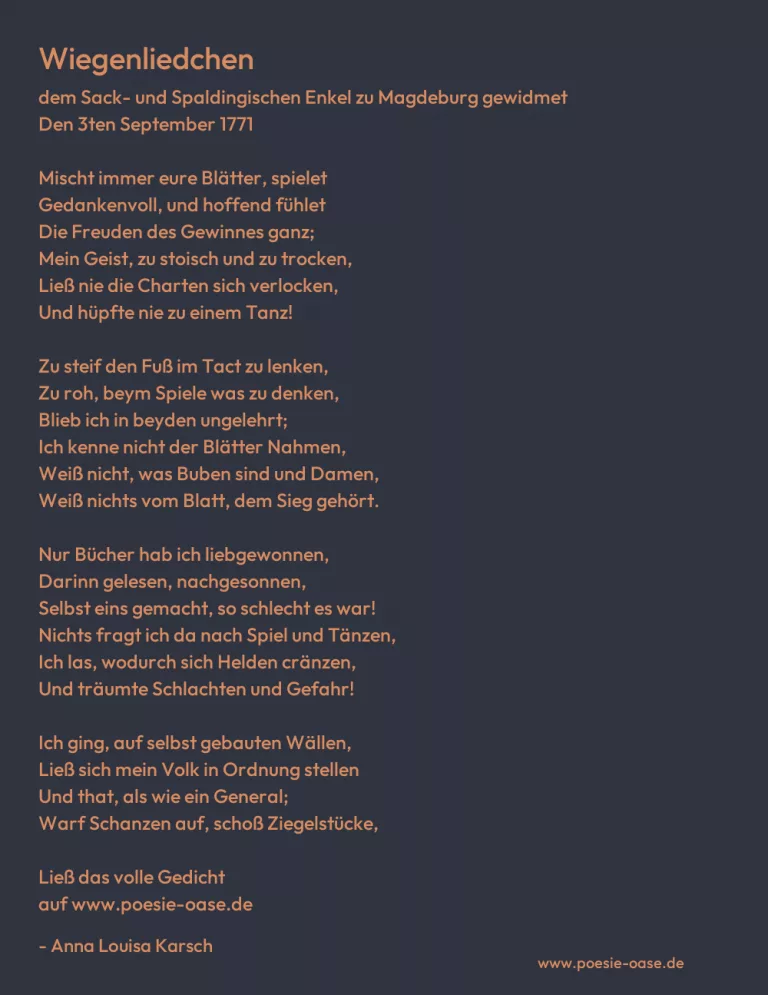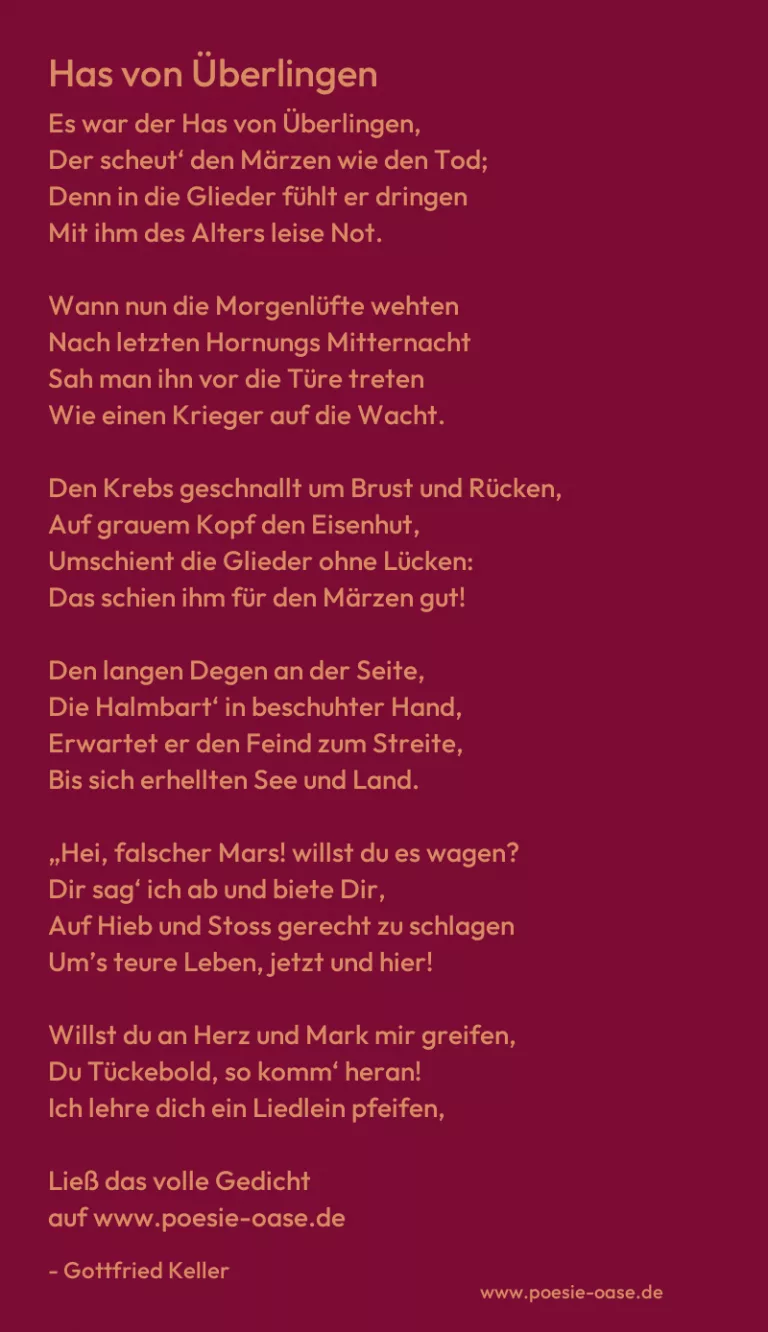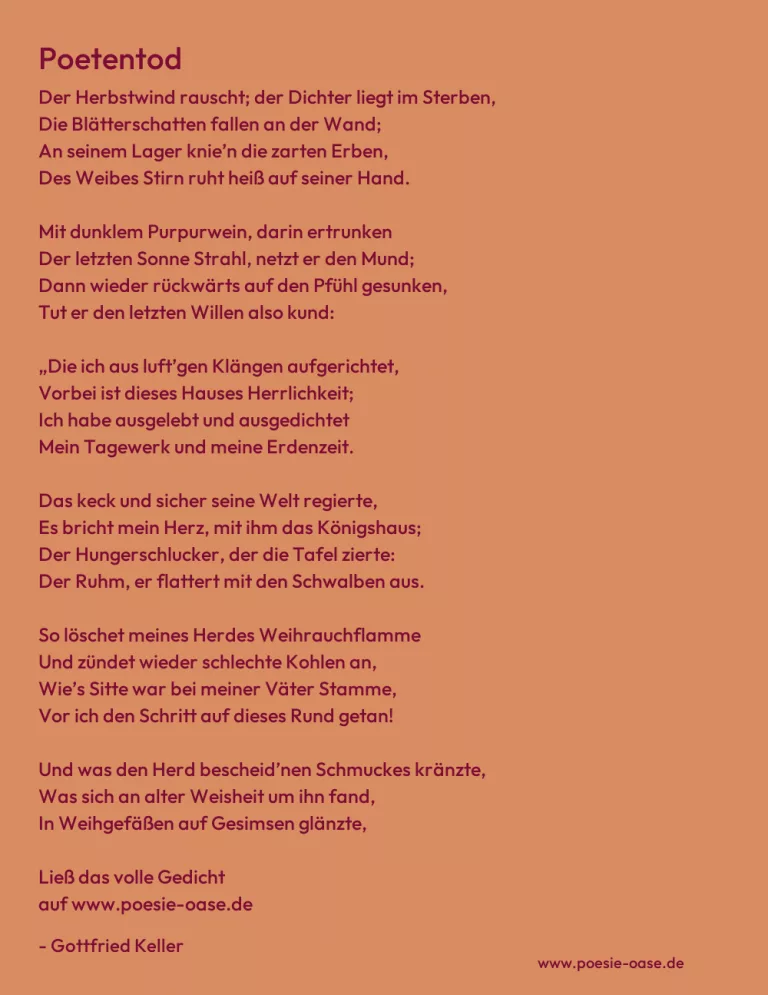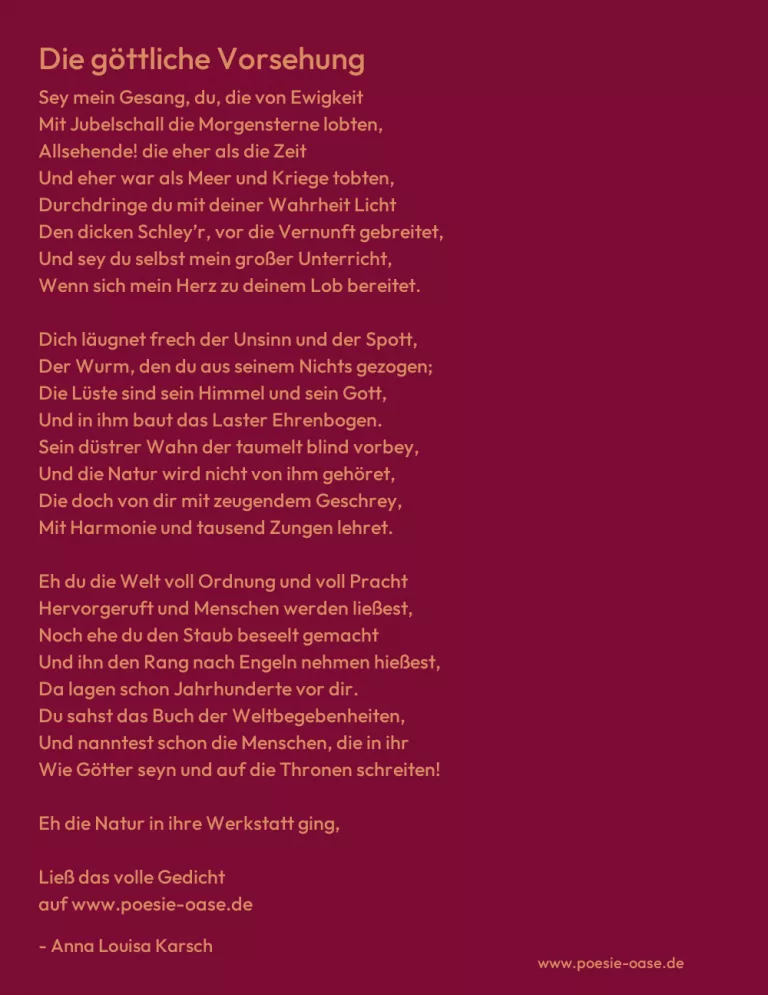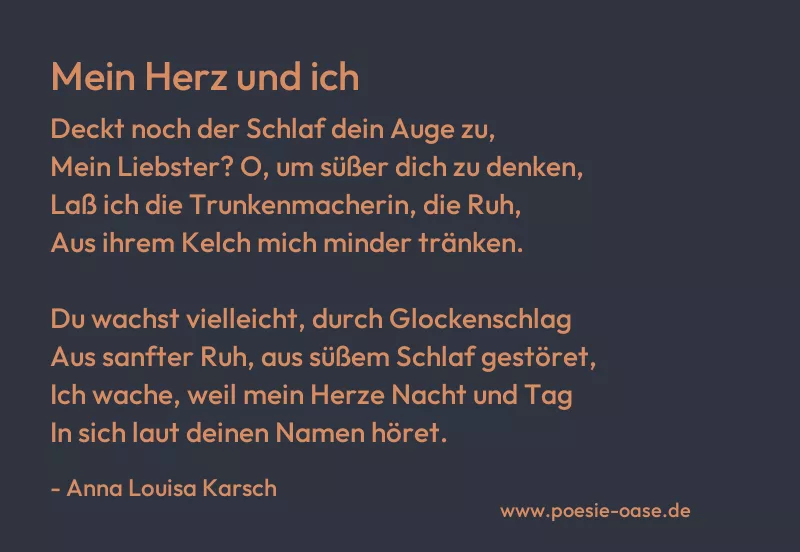Mein Herz und ich
Deckt noch der Schlaf dein Auge zu,
Mein Liebster? O, um süßer dich zu denken,
Laß ich die Trunkenmacherin, die Ruh,
Aus ihrem Kelch mich minder tränken.
Du wachst vielleicht, durch Glockenschlag
Aus sanfter Ruh, aus süßem Schlaf gestöret,
Ich wache, weil mein Herze Nacht und Tag
In sich laut deinen Namen höret.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
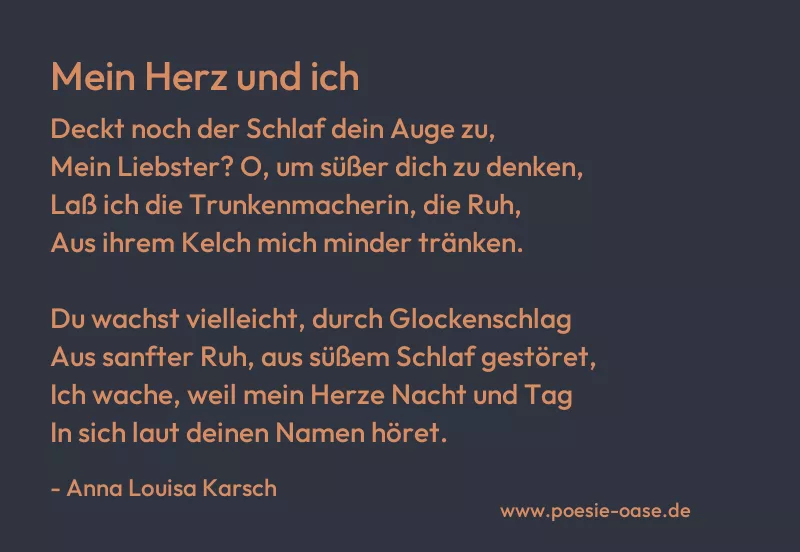
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Mein Herz und ich“ von Anna Louisa Karsch beschreibt die Sehnsucht und die Liebe der Sprecherin zu ihrem Geliebten. Zu Beginn fragt sie, ob der „Liebste“ noch schläft, und offenbart, dass ihre Gedanken bereits bei ihm sind, selbst wenn er nicht bei ihr ist. Sie vergleicht den Schlaf mit einer „Trunkenmacherin“, die sie von ihren Gedanken an ihn ablenken möchte. Doch die Liebe ist stärker als der Schlaf, und sie wünscht sich, dass der Schlaf sie weniger „tränkt“, damit sie sich ganz ihrem Liebsten zuwenden kann.
Die Sprecherin zeigt ihre tiefe Verbundenheit zu ihrem Geliebten, indem sie ihre Wachheit mit seiner Abwesenheit verknüpft. Der Glockenschlag, der ihn aus dem Schlaf wecken könnte, ist für sie kein Anzeichen der Ruhe, sondern eine Erinnerung an ihre eigene Wachsamkeit und an das ständige Hören seines Namens. Sie ist mit ihm in Gedanken immer vereint, auch wenn er nicht anwesend ist. Ihre Liebe ist so intensiv, dass sie das Gefühl hat, seinen Namen zu jeder Zeit zu hören – in der Nacht wie am Tag.
Das Gedicht zeigt die Verschmelzung von Sehnsucht und Hingabe. Die Sprecherin ist in ihren Gedanken ständig bei ihrem Geliebten, und ihr Herz ist erfüllt von seiner Nähe, selbst wenn er körperlich nicht anwesend ist. Sie schildert eine Liebe, die nicht an die Zeit gebunden ist und die auch in Momenten der Trennung lebendig bleibt. Die Sprache ist zart und innig, was die tief empfundene Sehnsucht und die romantische Hingabe der Sprecherin unterstreicht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.