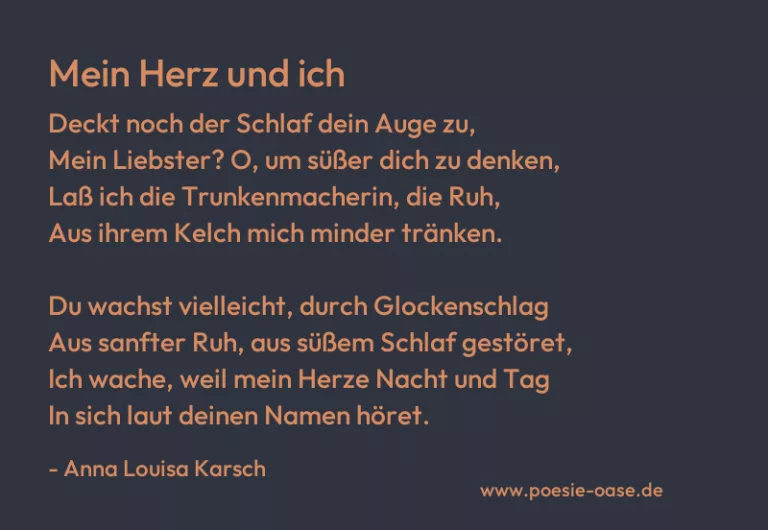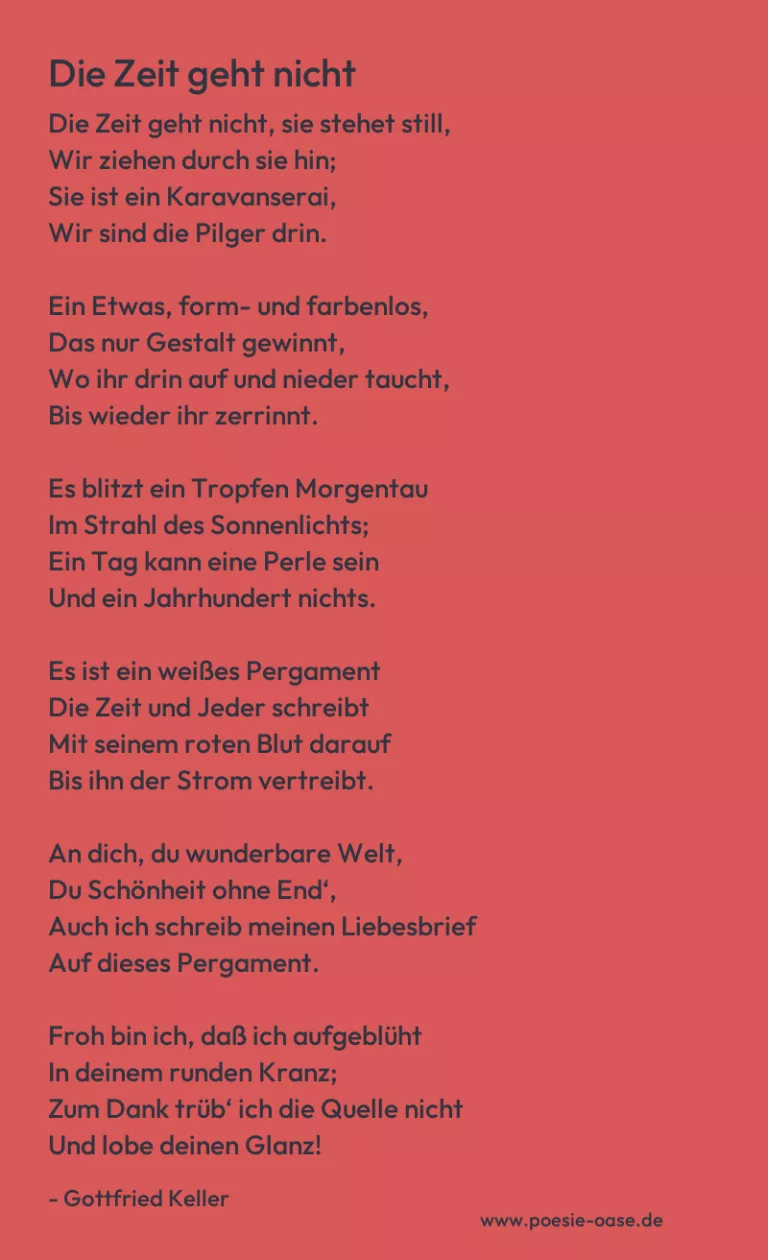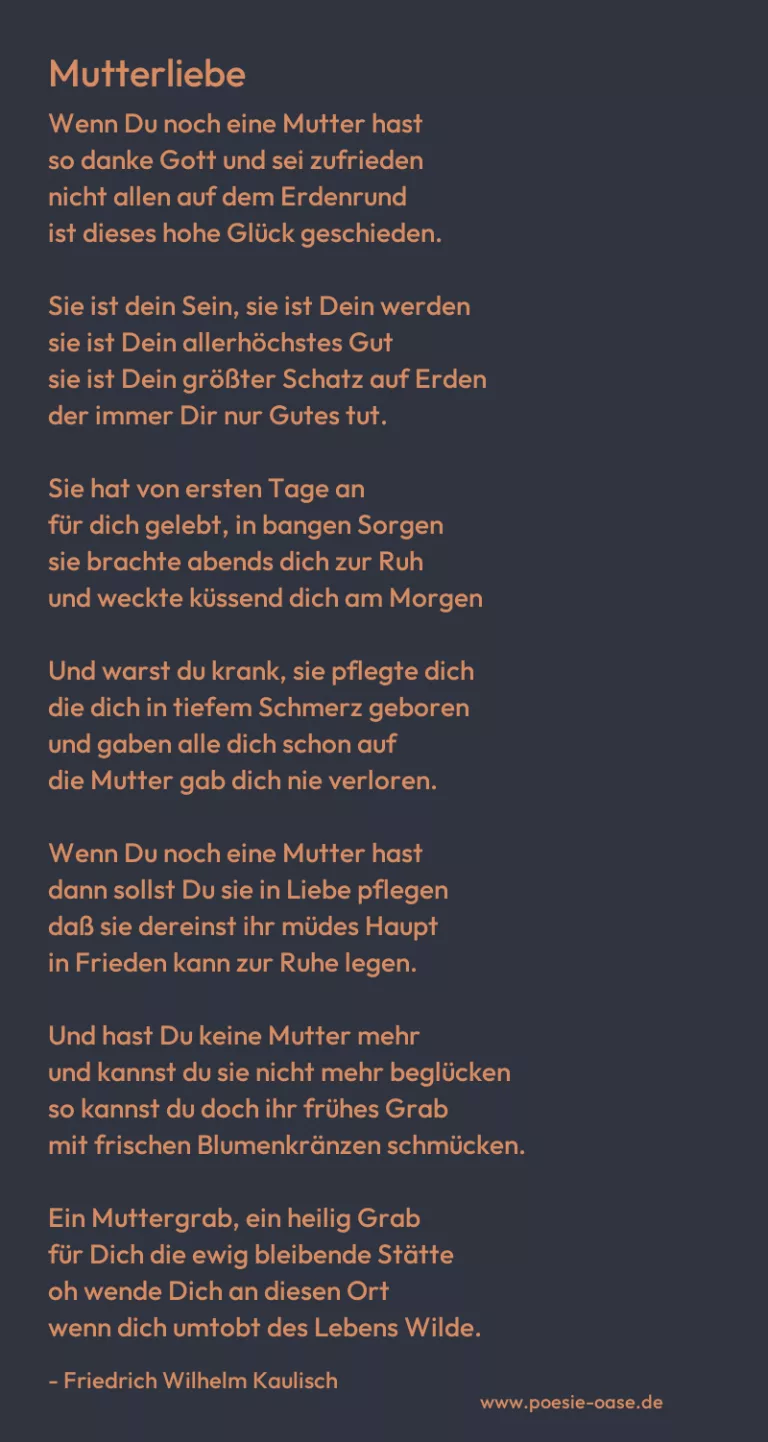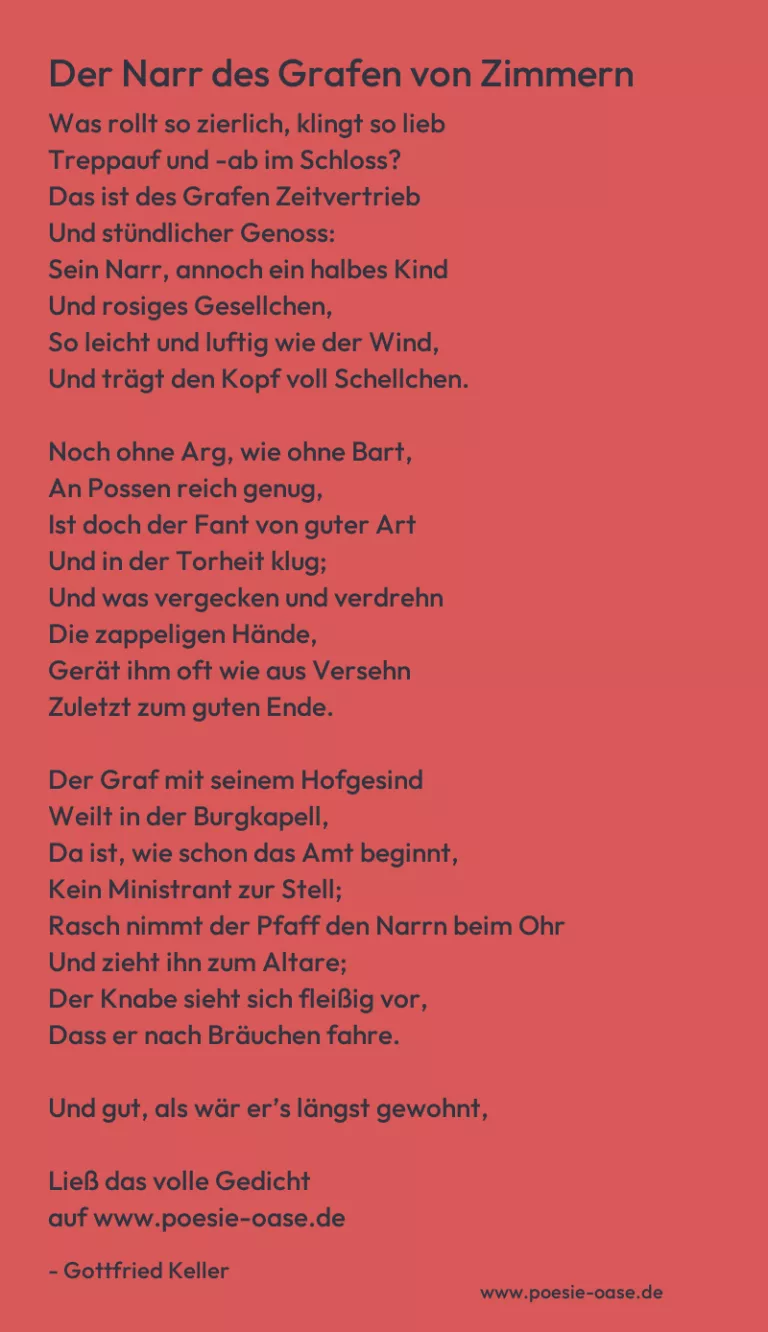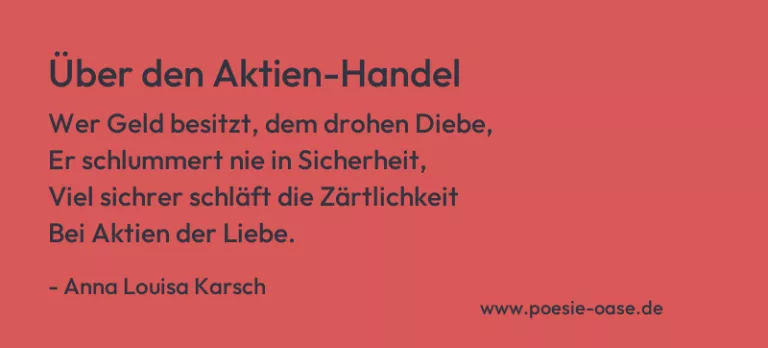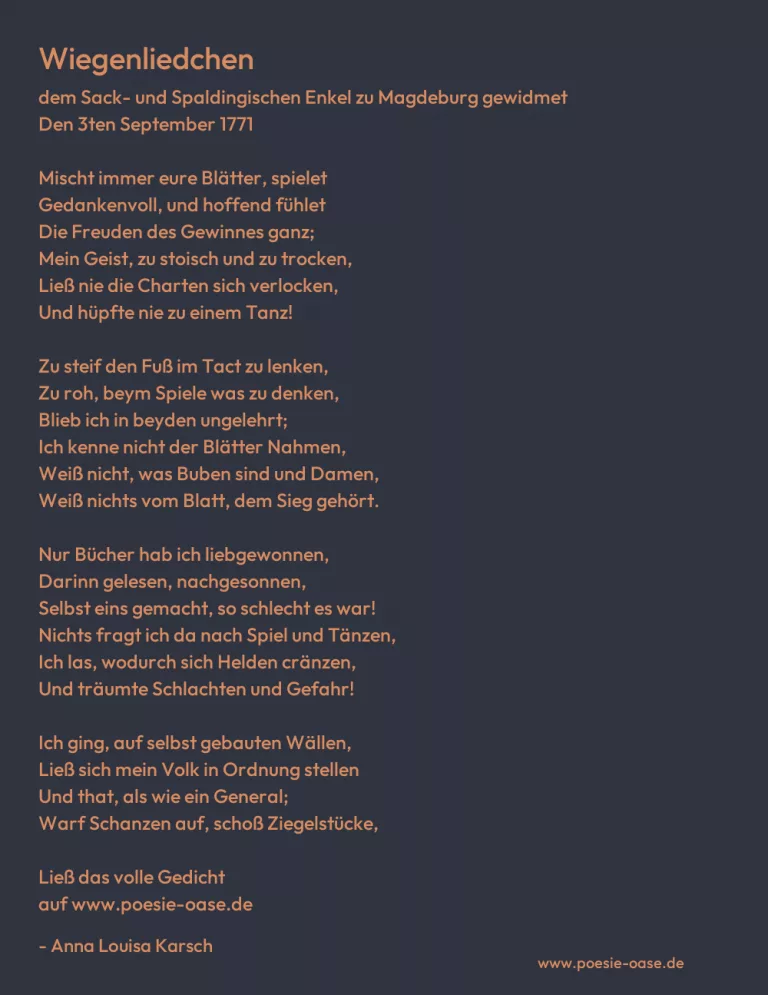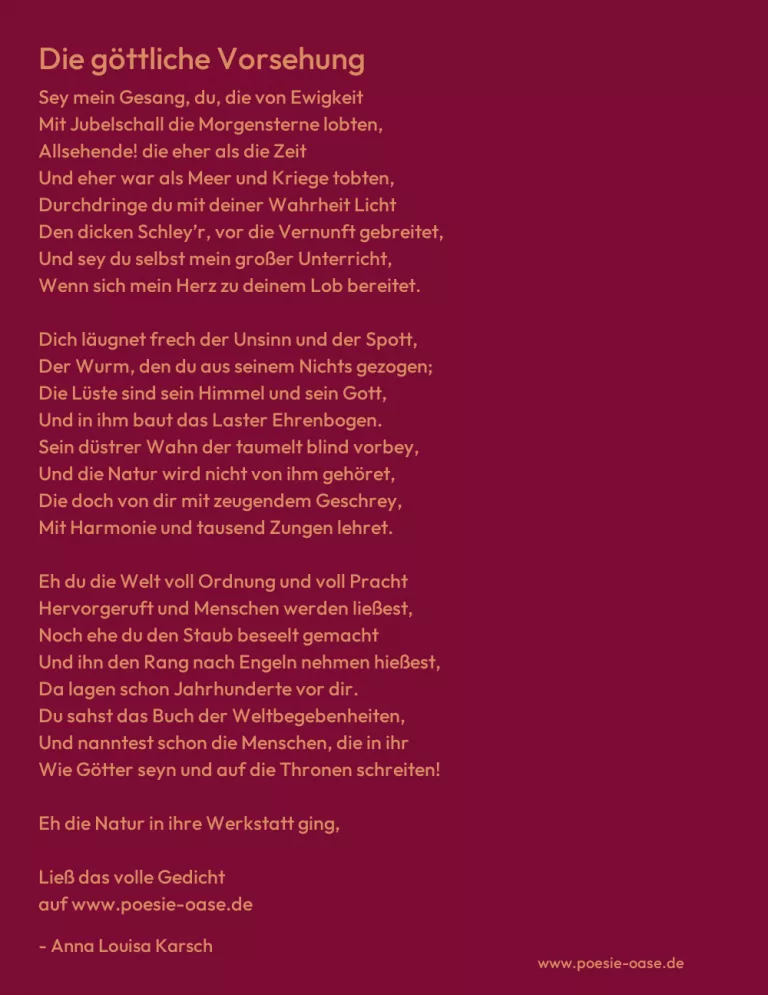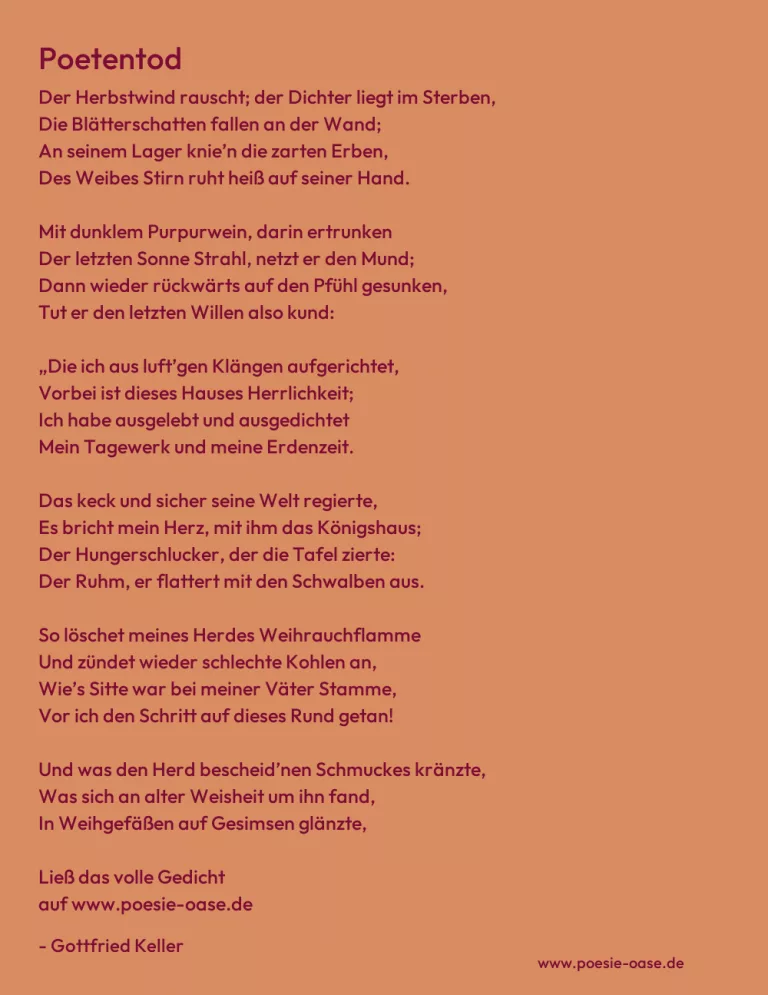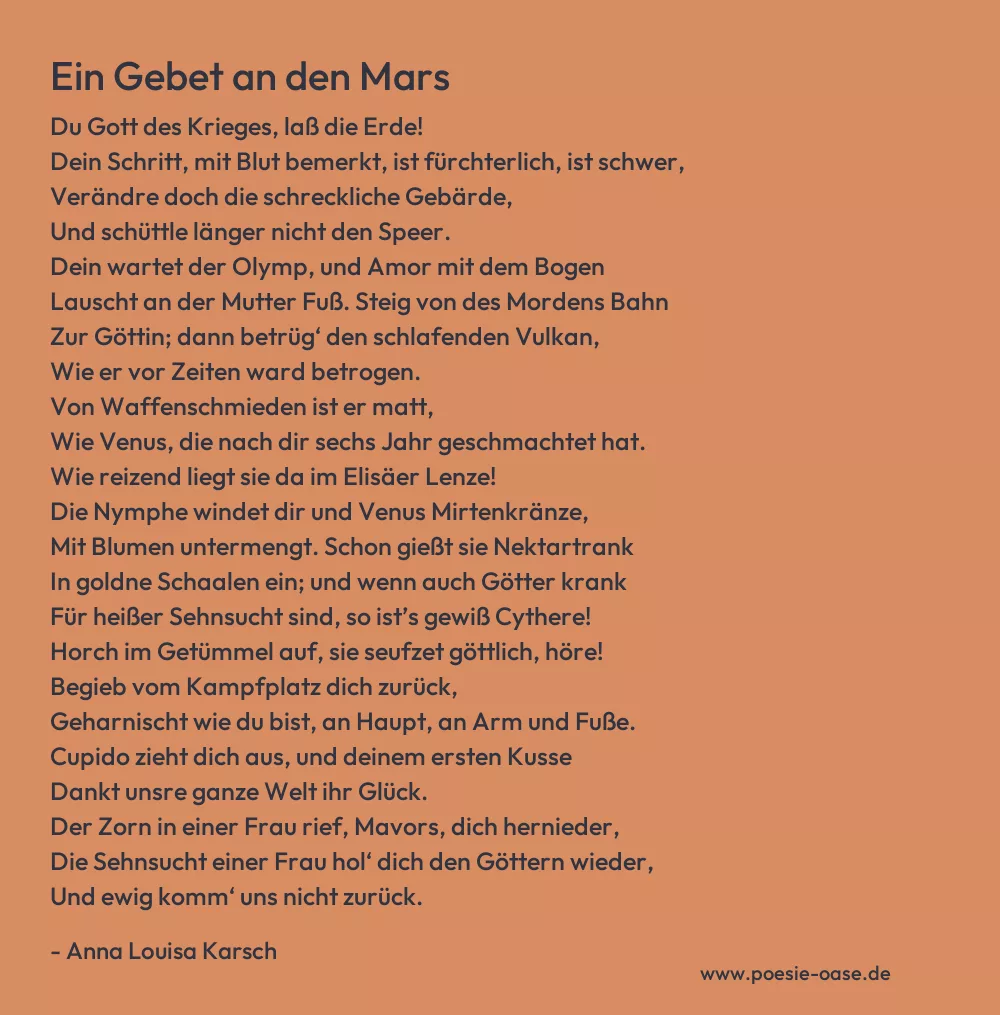Ein Gebet an den Mars
Du Gott des Krieges, laß die Erde!
Dein Schritt, mit Blut bemerkt, ist fürchterlich, ist schwer,
Verändre doch die schreckliche Gebärde,
Und schüttle länger nicht den Speer.
Dein wartet der Olymp, und Amor mit dem Bogen
Lauscht an der Mutter Fuß. Steig von des Mordens Bahn
Zur Göttin; dann betrüg‘ den schlafenden Vulkan,
Wie er vor Zeiten ward betrogen.
Von Waffenschmieden ist er matt,
Wie Venus, die nach dir sechs Jahr geschmachtet hat.
Wie reizend liegt sie da im Elisäer Lenze!
Die Nymphe windet dir und Venus Mirtenkränze,
Mit Blumen untermengt. Schon gießt sie Nektartrank
In goldne Schaalen ein; und wenn auch Götter krank
Für heißer Sehnsucht sind, so ist’s gewiß Cythere!
Horch im Getümmel auf, sie seufzet göttlich, höre!
Begieb vom Kampfplatz dich zurück,
Geharnischt wie du bist, an Haupt, an Arm und Fuße.
Cupido zieht dich aus, und deinem ersten Kusse
Dankt unsre ganze Welt ihr Glück.
Der Zorn in einer Frau rief, Mavors, dich hernieder,
Die Sehnsucht einer Frau hol‘ dich den Göttern wieder,
Und ewig komm‘ uns nicht zurück.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
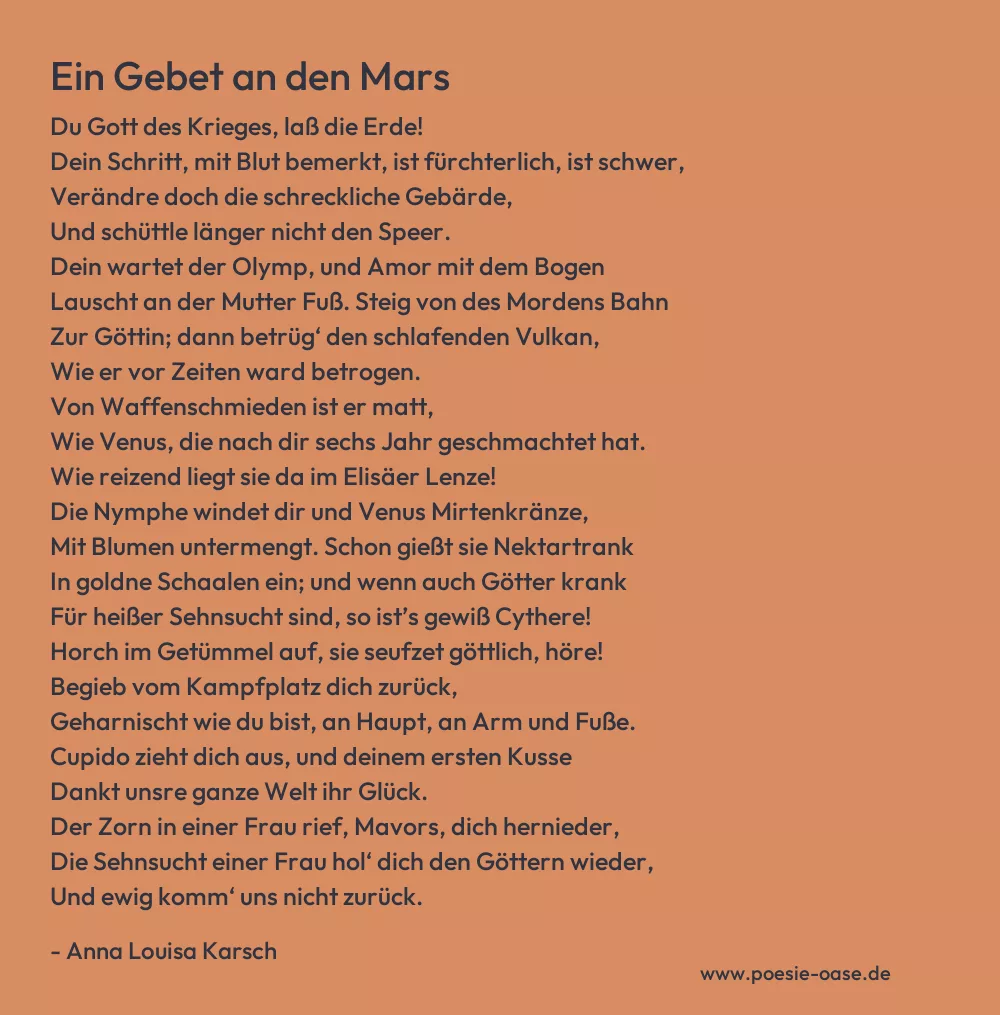
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ein Gebet an den Mars“ von Anna Louisa Karsch richtet sich an den Gott des Krieges, Mars, und bittet ihn, von seinem gewaltsamen Weg abzukehren und sich stattdessen der Liebe und der Zärtlichkeit zu zuwenden. Zu Beginn wird Mars als eine bedrohliche und furchteinflößende Gestalt beschrieben, deren Schritt „mit Blut bemerkt“ ist – ein Symbol für die Zerstörung und den Krieg, den er bringt. Die Sprecherin fordert ihn auf, seine gewaltsame „Gebärde“ zu verändern und sich von der Gewalt abzuwenden, um zu Venus, der Göttin der Liebe, zu gehen, die in diesem Gedicht als die wahre Quelle des Glücks und der Freude dargestellt wird.
Im zweiten Teil des Gedichts wendet sich die Sprecherin der Beziehung zwischen Mars und Venus zu. Sie beschreibt die Göttin Venus, die „nach dir [Mars] sechs Jahr geschmachtet hat“, und wie sie sich in einem Zustand der Sehnsucht befindet, während sie den Kriegsgott anruft. Venus wird als die schöne, verführerische Göttin dargestellt, die im „Elisäer Lenze“ – dem Paradies der Götter – in einem Zustand der Anmut und Verführung liegt. Die Blumen und der Nektar symbolisieren Liebe, Lust und ein Leben in Harmonie und Frieden. Dieser Kontrast zur kriegerischen Natur von Mars zeigt, dass die wahre Erfüllung nicht im Krieg, sondern in der Liebe zu finden ist.
Der Übergang von Mars’ kriegerischer Natur zu seiner Rolle als Liebhaber wird durch den göttlichen „Kuss“ markiert, der als Ursprung des „Glücks“ der Welt verstanden wird. Diese Einladung an Mars, sich von der gewaltsamen Welt des Krieges abzuwenden und in die Arme der Liebe zu flüchten, verleiht dem Gedicht einen heiteren, beinahe verspielten Ton. Die Welt wird als ein Ort des Glücks und Friedens beschrieben, der aus der Vereinigung von Mars und Venus hervorgeht. In dieser Vision ist es die Sehnsucht der Göttinnen, die den Gott des Krieges zurück in die Welt der Liebe ruft, was die zentrale Botschaft des Gedichts unterstreicht: wahre Freude kommt nicht aus Zerstörung, sondern aus Zuneigung und Vereinigung.
Am Ende des Gedichts wird Mars schließlich dazu aufgefordert, sich für immer von der Welt des Krieges abzuwenden und nicht wieder zurückzukehren. Die „Sehnsucht einer Frau“ hat ihn zu den Göttern gerufen, und nun soll er für immer im Reich der Liebe verweilen. Die Sprecherin wünscht sich, dass der Gott des Krieges für immer in den Frieden und die Schönheit der Liebe eintaucht, anstatt in den blutigen Konflikten des Krieges. Die abschließende Forderung nach dem endgültigen Verlassen des Kampfplatzes und der ewigen Abkehr von der Gewalt stellt einen Appell an die übergeordnete Macht der Liebe dar, die in dieser Welt alles andere übertrifft.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.