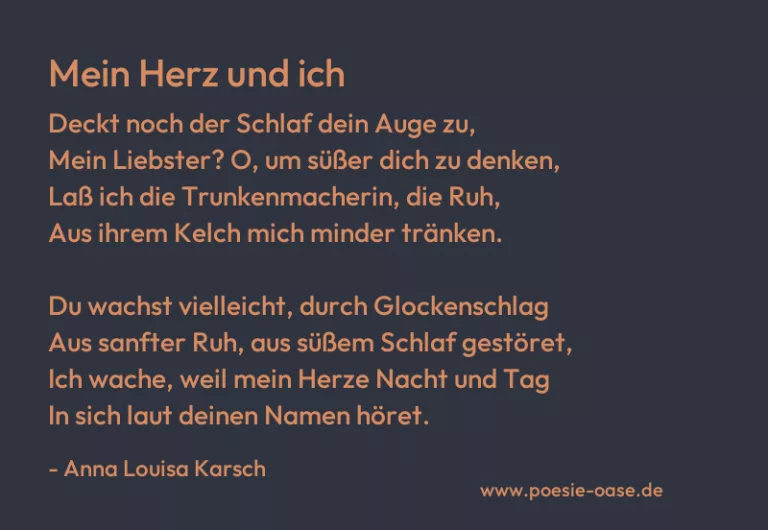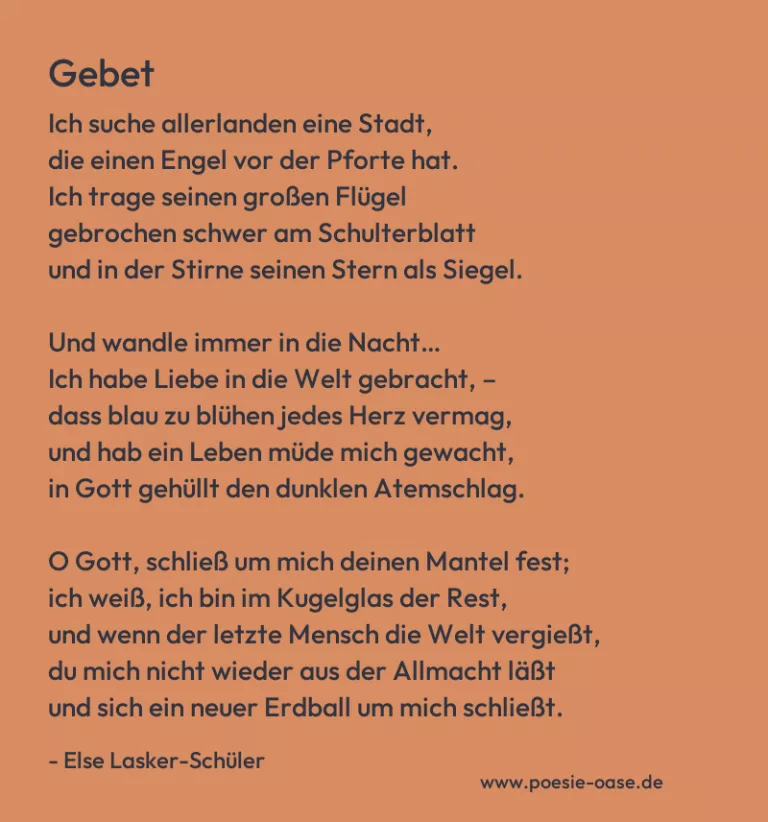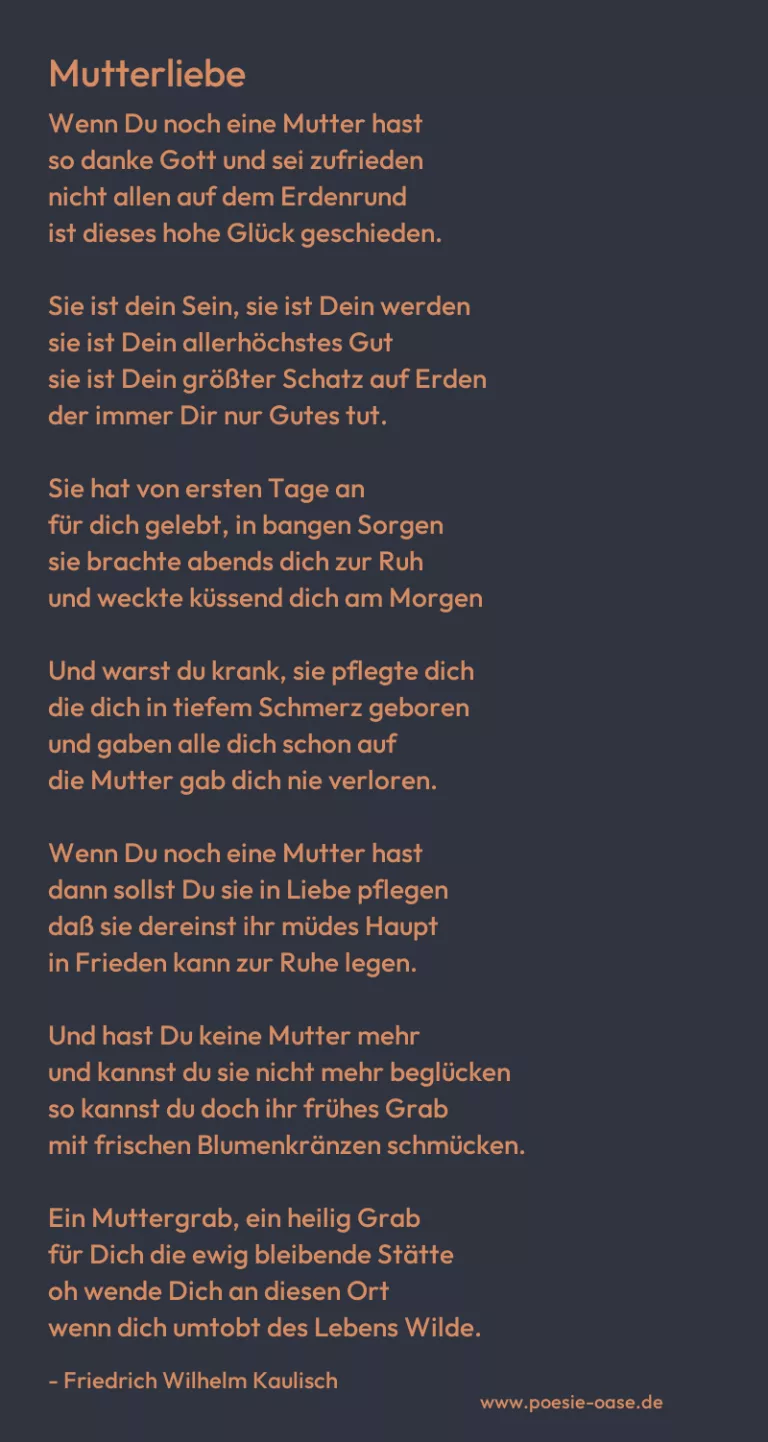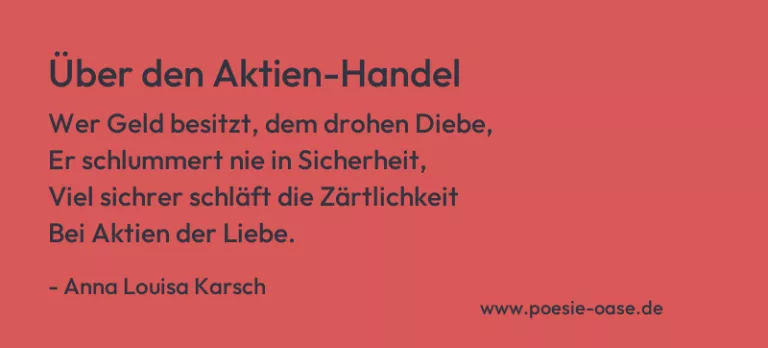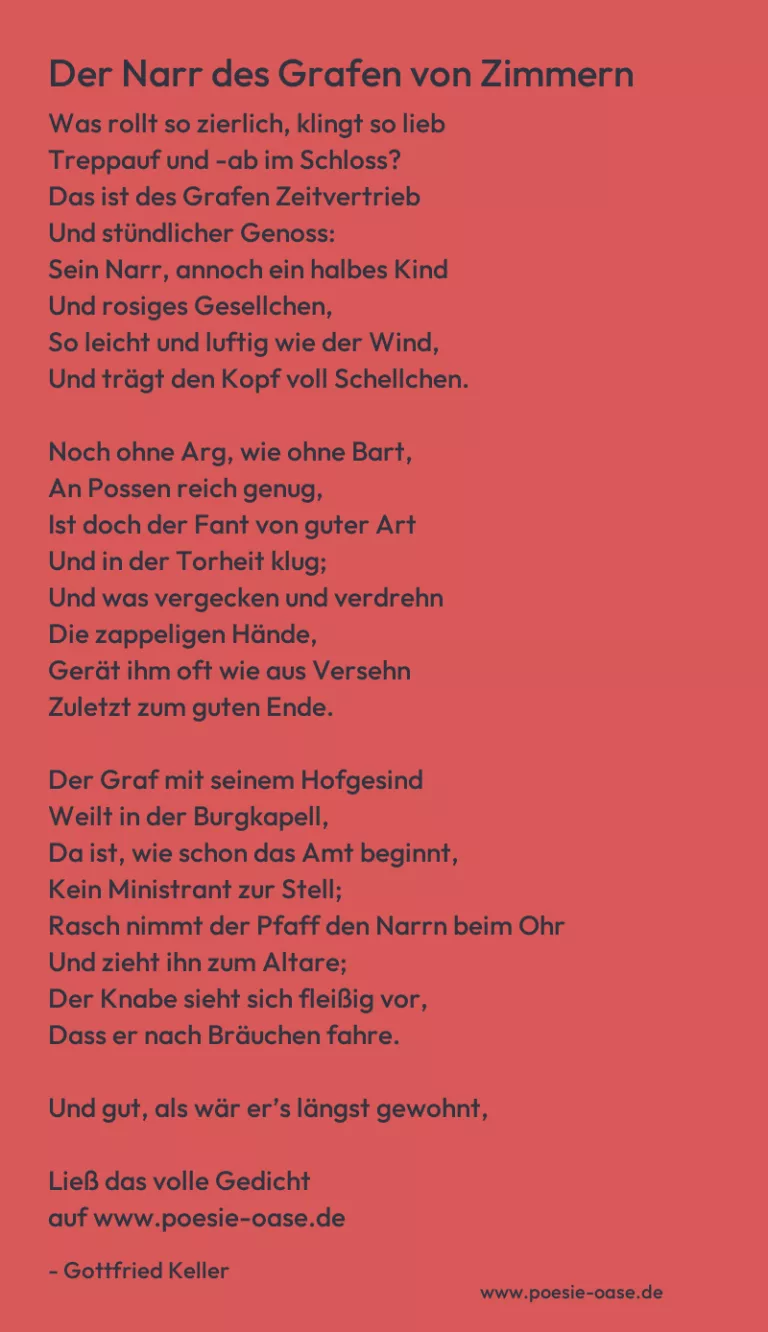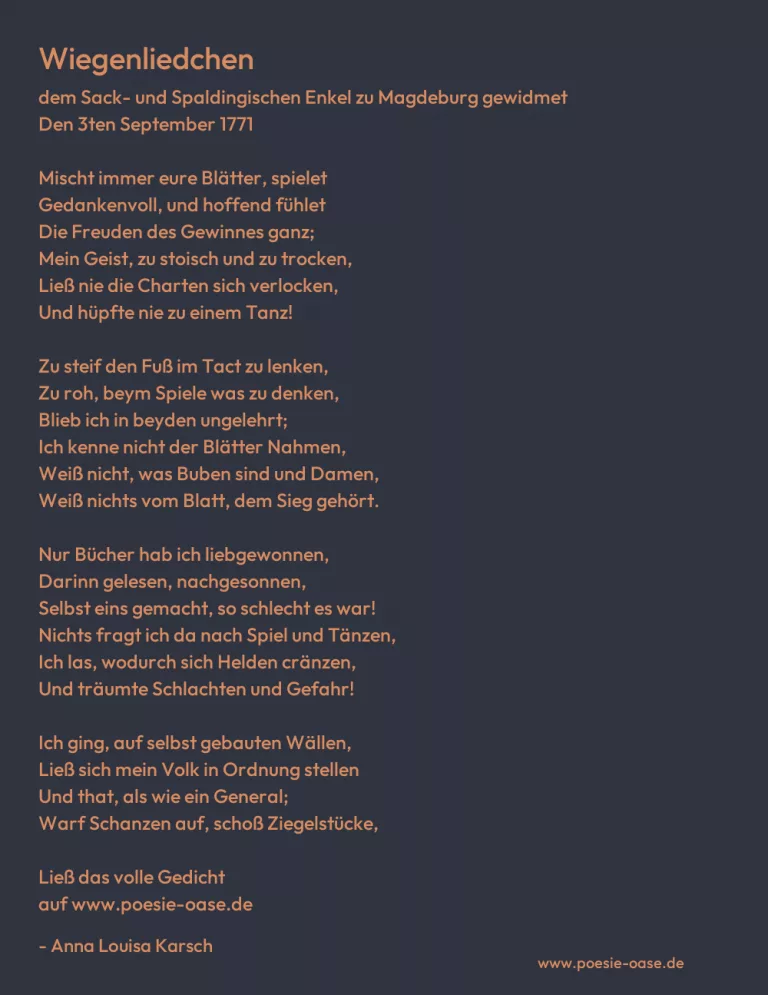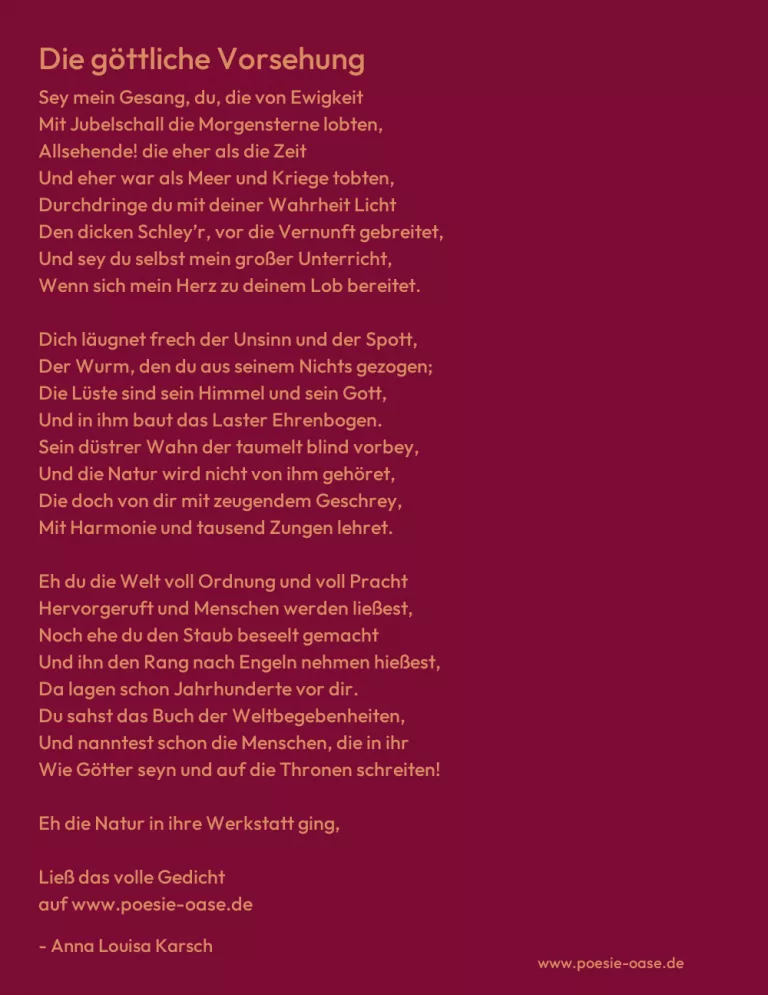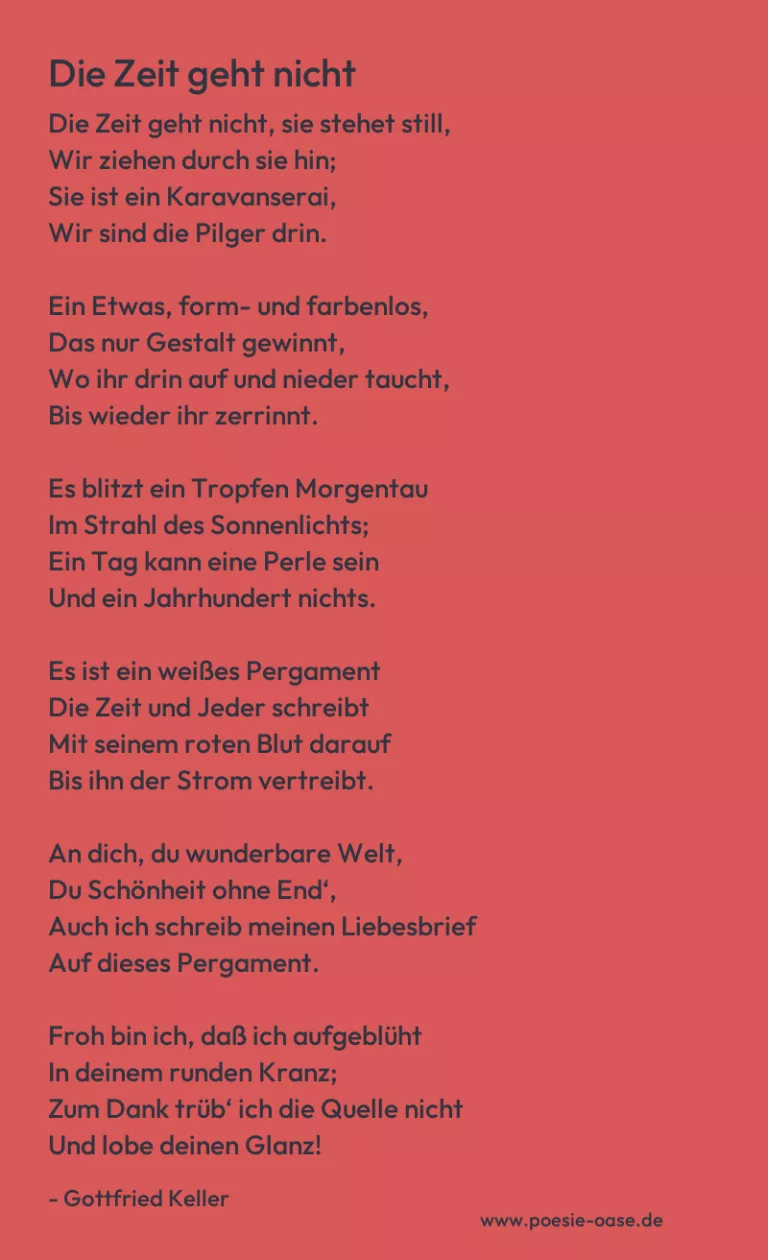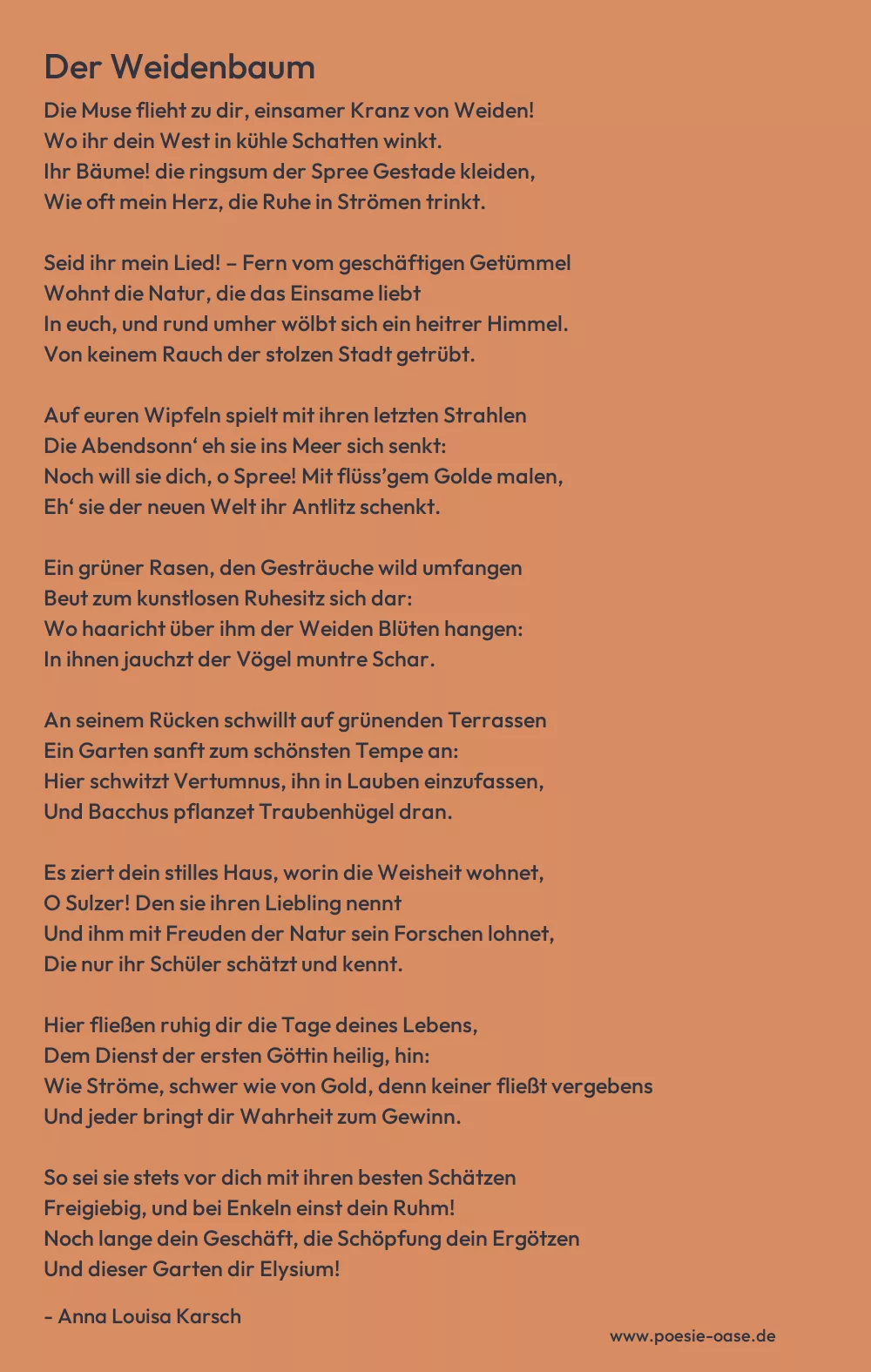Die Muse flieht zu dir, einsamer Kranz von Weiden!
Wo ihr dein West in kühle Schatten winkt.
Ihr Bäume! die ringsum der Spree Gestade kleiden,
Wie oft mein Herz, die Ruhe in Strömen trinkt.
Seid ihr mein Lied! – Fern vom geschäftigen Getümmel
Wohnt die Natur, die das Einsame liebt
In euch, und rund umher wölbt sich ein heitrer Himmel.
Von keinem Rauch der stolzen Stadt getrübt.
Auf euren Wipfeln spielt mit ihren letzten Strahlen
Die Abendsonn‘ eh sie ins Meer sich senkt:
Noch will sie dich, o Spree! Mit flüss’gem Golde malen,
Eh‘ sie der neuen Welt ihr Antlitz schenkt.
Ein grüner Rasen, den Gesträuche wild umfangen
Beut zum kunstlosen Ruhesitz sich dar:
Wo haaricht über ihm der Weiden Blüten hangen:
In ihnen jauchzt der Vögel muntre Schar.
An seinem Rücken schwillt auf grünenden Terrassen
Ein Garten sanft zum schönsten Tempe an:
Hier schwitzt Vertumnus, ihn in Lauben einzufassen,
Und Bacchus pflanzet Traubenhügel dran.
Es ziert dein stilles Haus, worin die Weisheit wohnet,
O Sulzer! Den sie ihren Liebling nennt
Und ihm mit Freuden der Natur sein Forschen lohnet,
Die nur ihr Schüler schätzt und kennt.
Hier fließen ruhig dir die Tage deines Lebens,
Dem Dienst der ersten Göttin heilig, hin:
Wie Ströme, schwer wie von Gold, denn keiner fließt vergebens
Und jeder bringt dir Wahrheit zum Gewinn.
So sei sie stets vor dich mit ihren besten Schätzen
Freigiebig, und bei Enkeln einst dein Ruhm!
Noch lange dein Geschäft, die Schöpfung dein Ergötzen
Und dieser Garten dir Elysium!