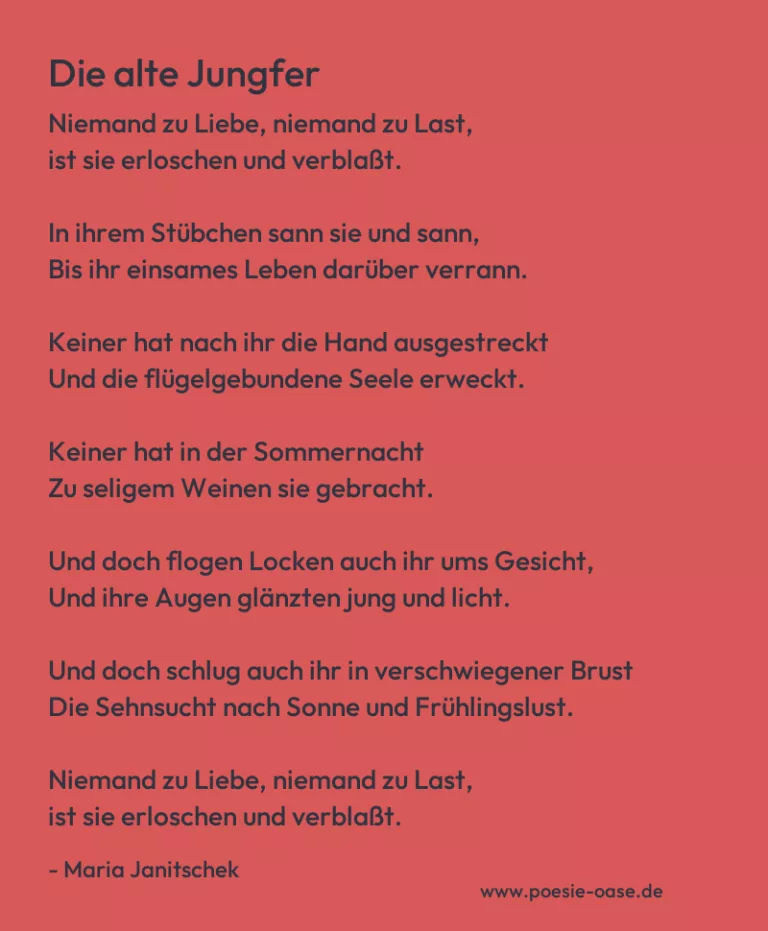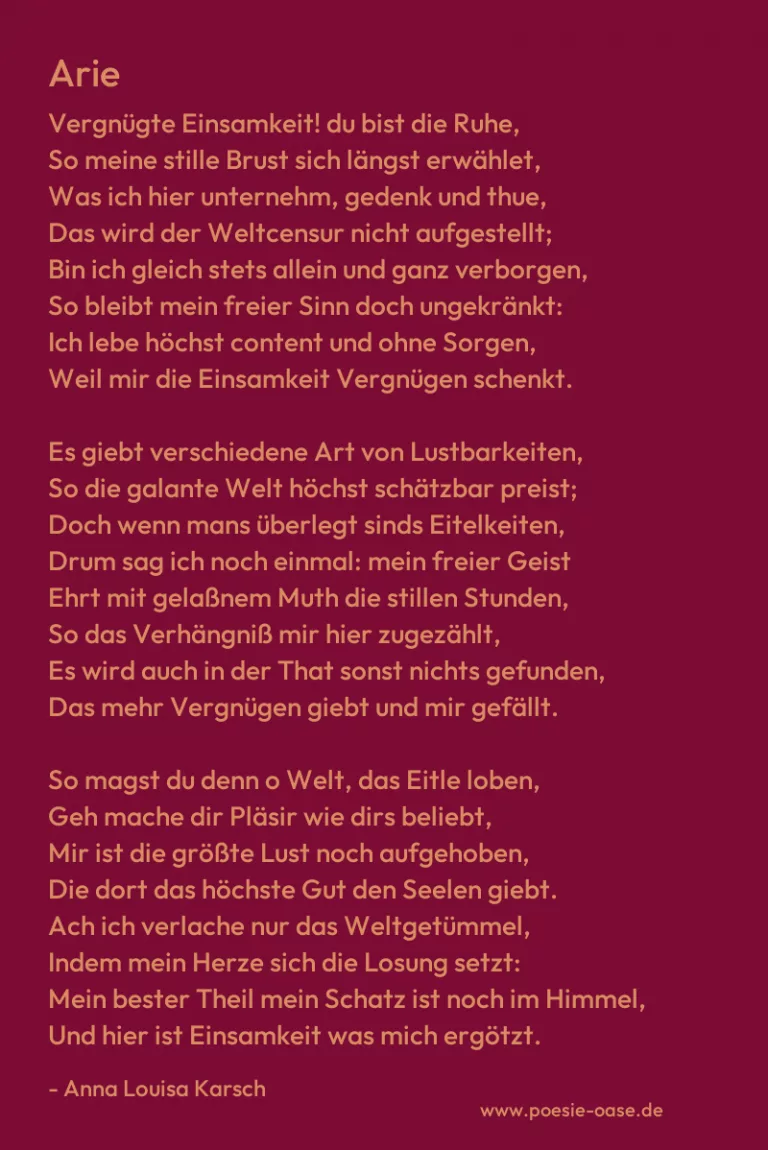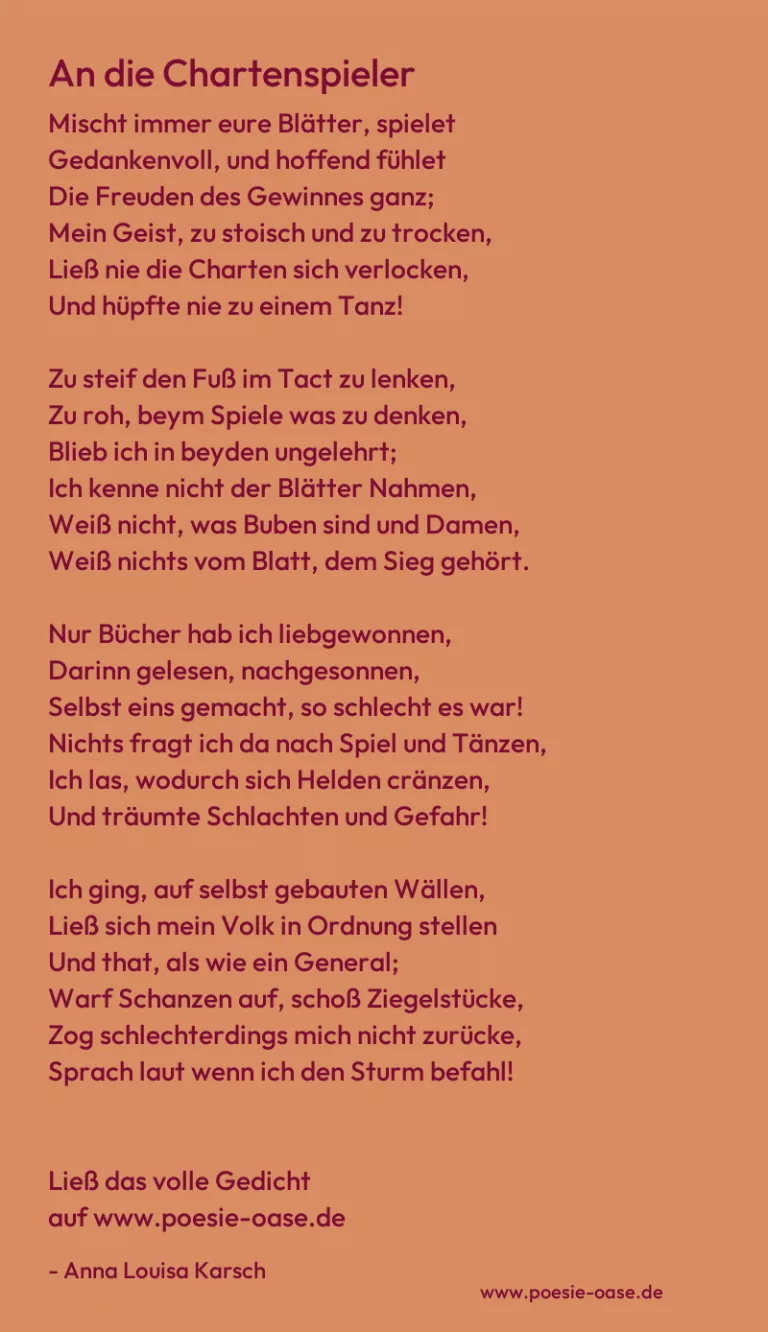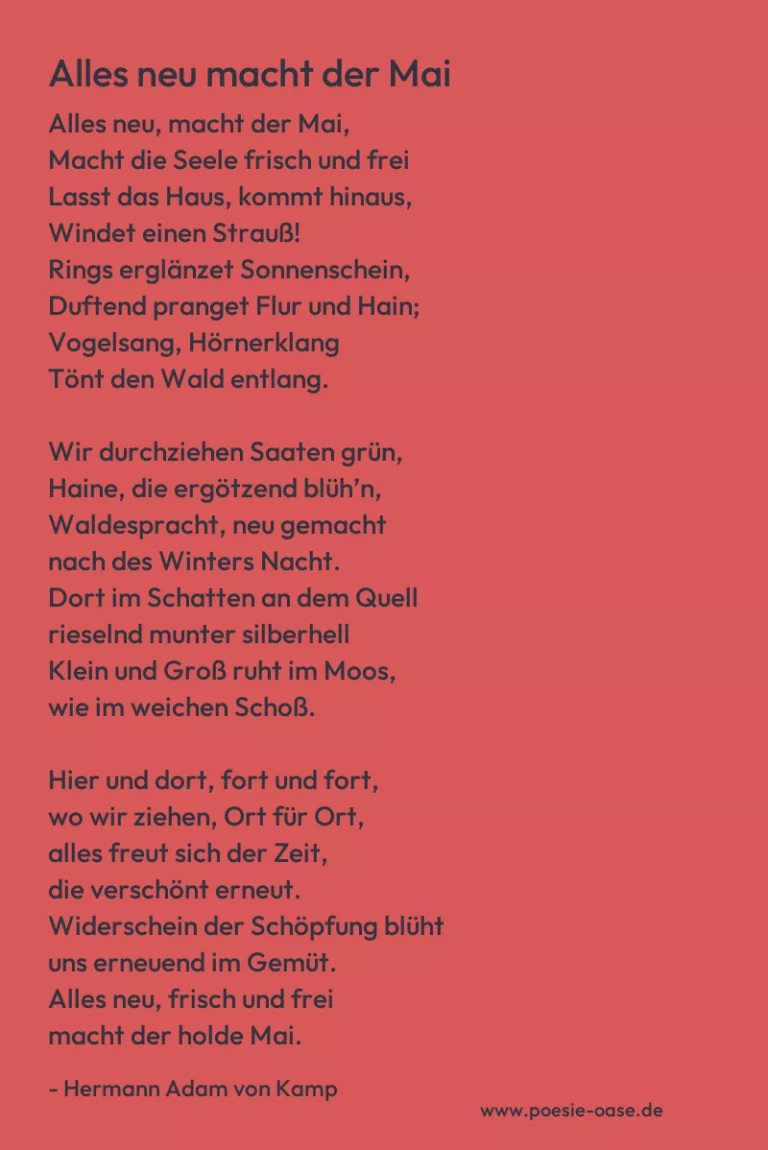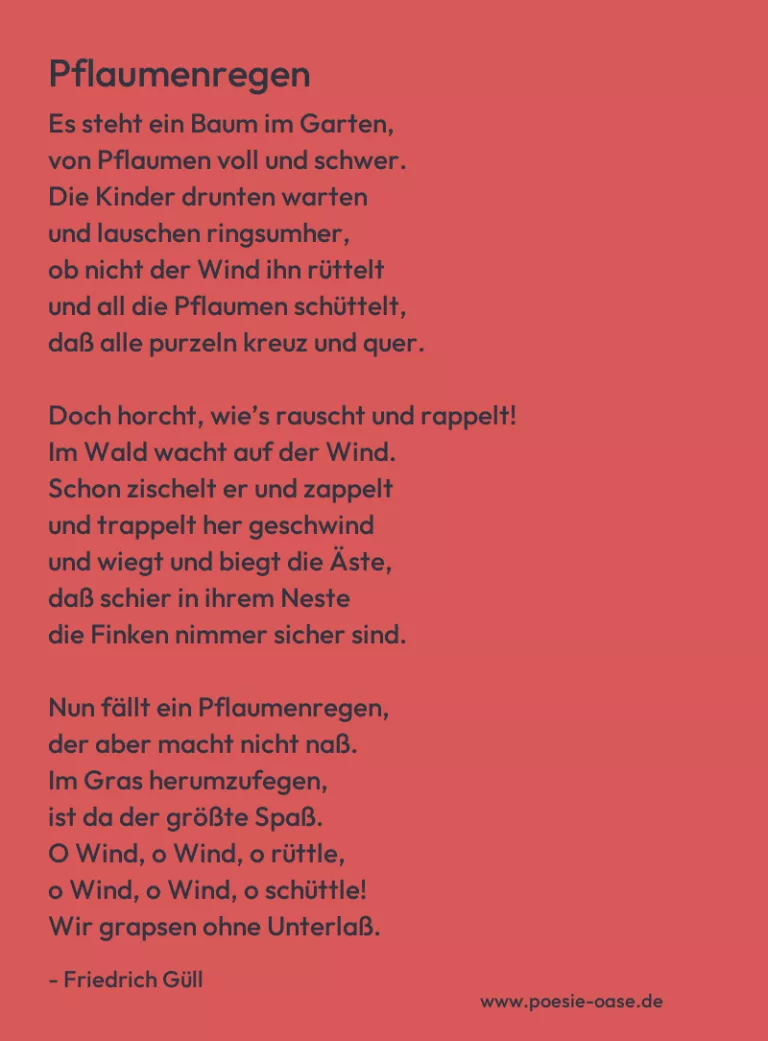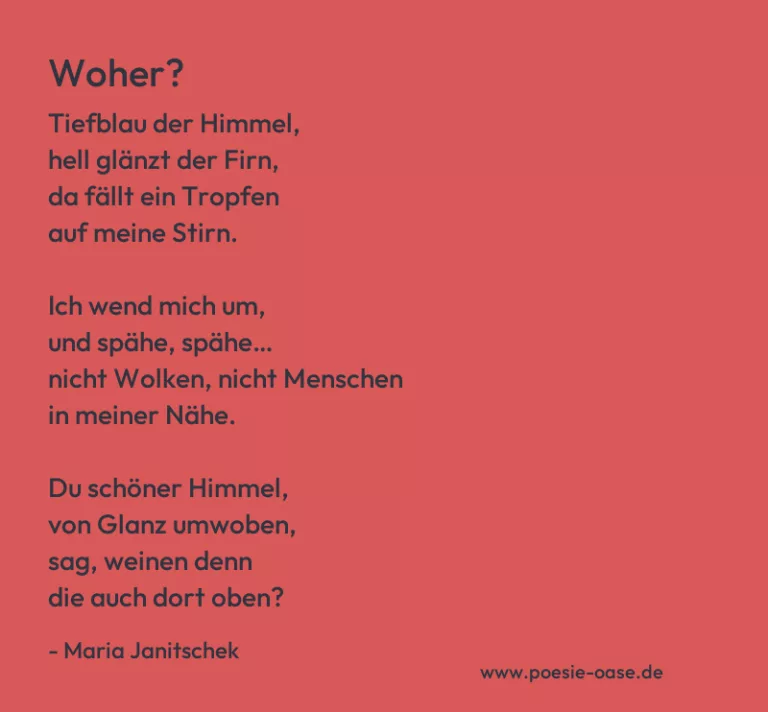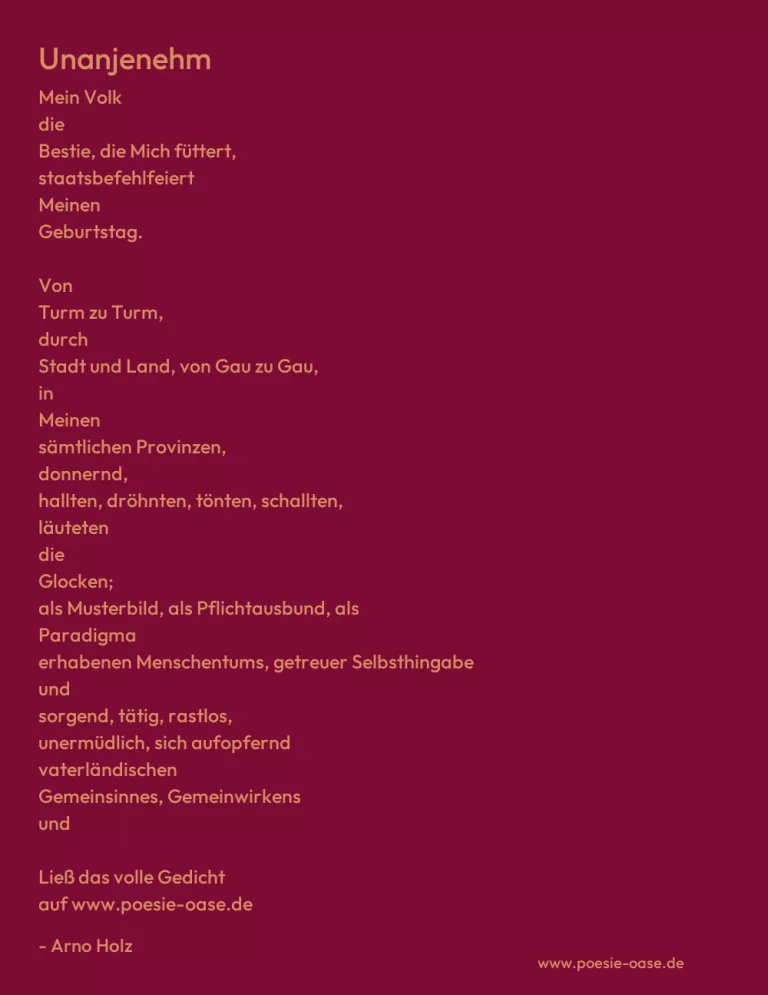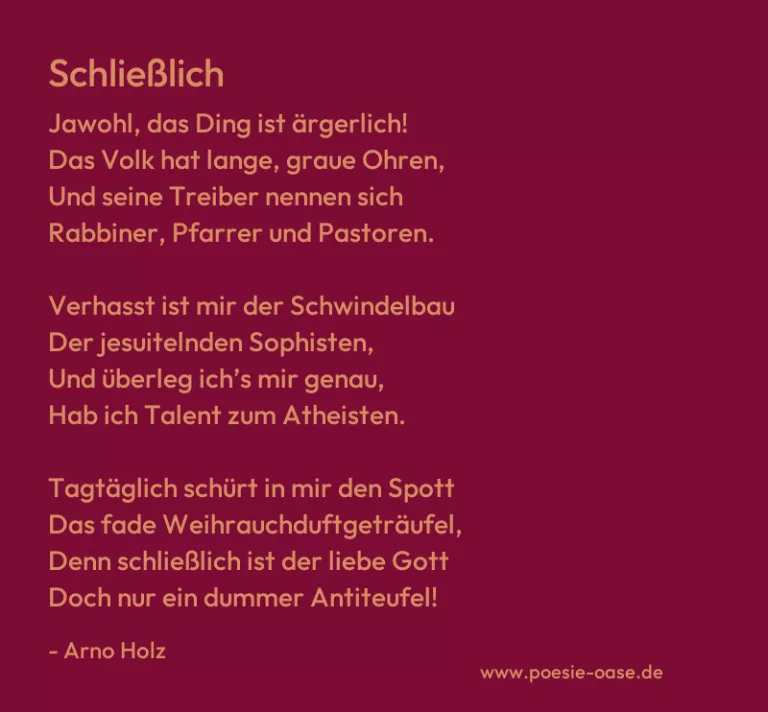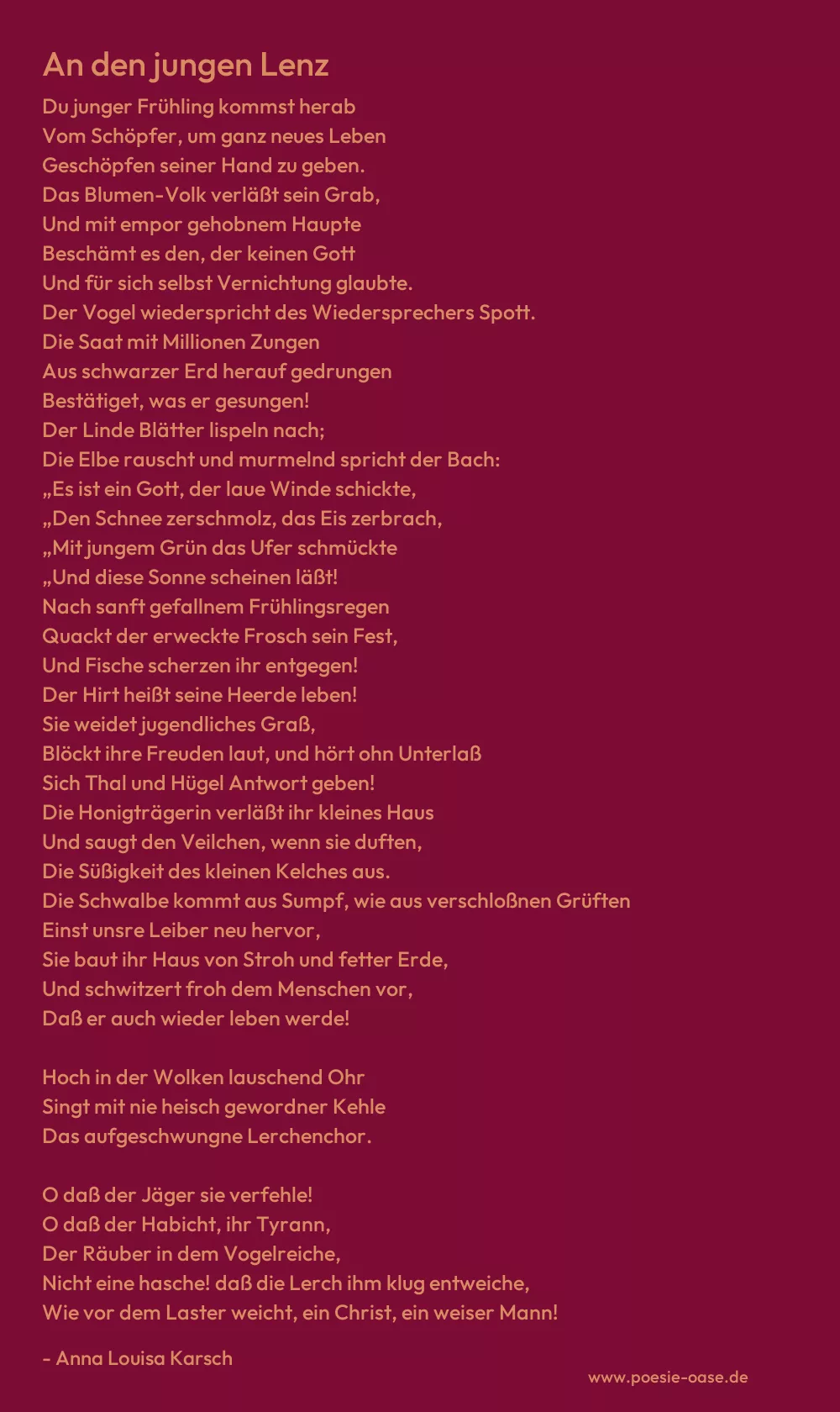Alltag, Blumen & Pflanzen, Feiern, Flüsse & Meere, Frühling, Gemeinfrei, Helden & Prinzessinnen, Leichtigkeit, Liebe & Romantik, Natur, Religion, Sommer, Tiere, Winter, Zerstörung
An den jungen Lenz
Du junger Frühling kommst herab
Vom Schöpfer, um ganz neues Leben
Geschöpfen seiner Hand zu geben.
Das Blumen-Volk verläßt sein Grab,
Und mit empor gehobnem Haupte
Beschämt es den, der keinen Gott
Und für sich selbst Vernichtung glaubte.
Der Vogel wiederspricht des Wiedersprechers Spott.
Die Saat mit Millionen Zungen
Aus schwarzer Erd herauf gedrungen
Bestätiget, was er gesungen!
Der Linde Blätter lispeln nach;
Die Elbe rauscht und murmelnd spricht der Bach:
„Es ist ein Gott, der laue Winde schickte,
„Den Schnee zerschmolz, das Eis zerbrach,
„Mit jungem Grün das Ufer schmückte
„Und diese Sonne scheinen läßt!
Nach sanft gefallnem Frühlingsregen
Quackt der erweckte Frosch sein Fest,
Und Fische scherzen ihr entgegen!
Der Hirt heißt seine Heerde leben!
Sie weidet jugendliches Graß,
Blöckt ihre Freuden laut, und hört ohn Unterlaß
Sich Thal und Hügel Antwort geben!
Die Honigträgerin verläßt ihr kleines Haus
Und saugt den Veilchen, wenn sie duften,
Die Süßigkeit des kleinen Kelches aus.
Die Schwalbe kommt aus Sumpf, wie aus verschloßnen Grüften
Einst unsre Leiber neu hervor,
Sie baut ihr Haus von Stroh und fetter Erde,
Und schwitzert froh dem Menschen vor,
Daß er auch wieder leben werde!
Hoch in der Wolken lauschend Ohr
Singt mit nie heisch gewordner Kehle
Das aufgeschwungne Lerchenchor.
O daß der Jäger sie verfehle!
O daß der Habicht, ihr Tyrann,
Der Räuber in dem Vogelreiche,
Nicht eine hasche! daß die Lerch ihm klug entweiche,
Wie vor dem Laster weicht, ein Christ, ein weiser Mann!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
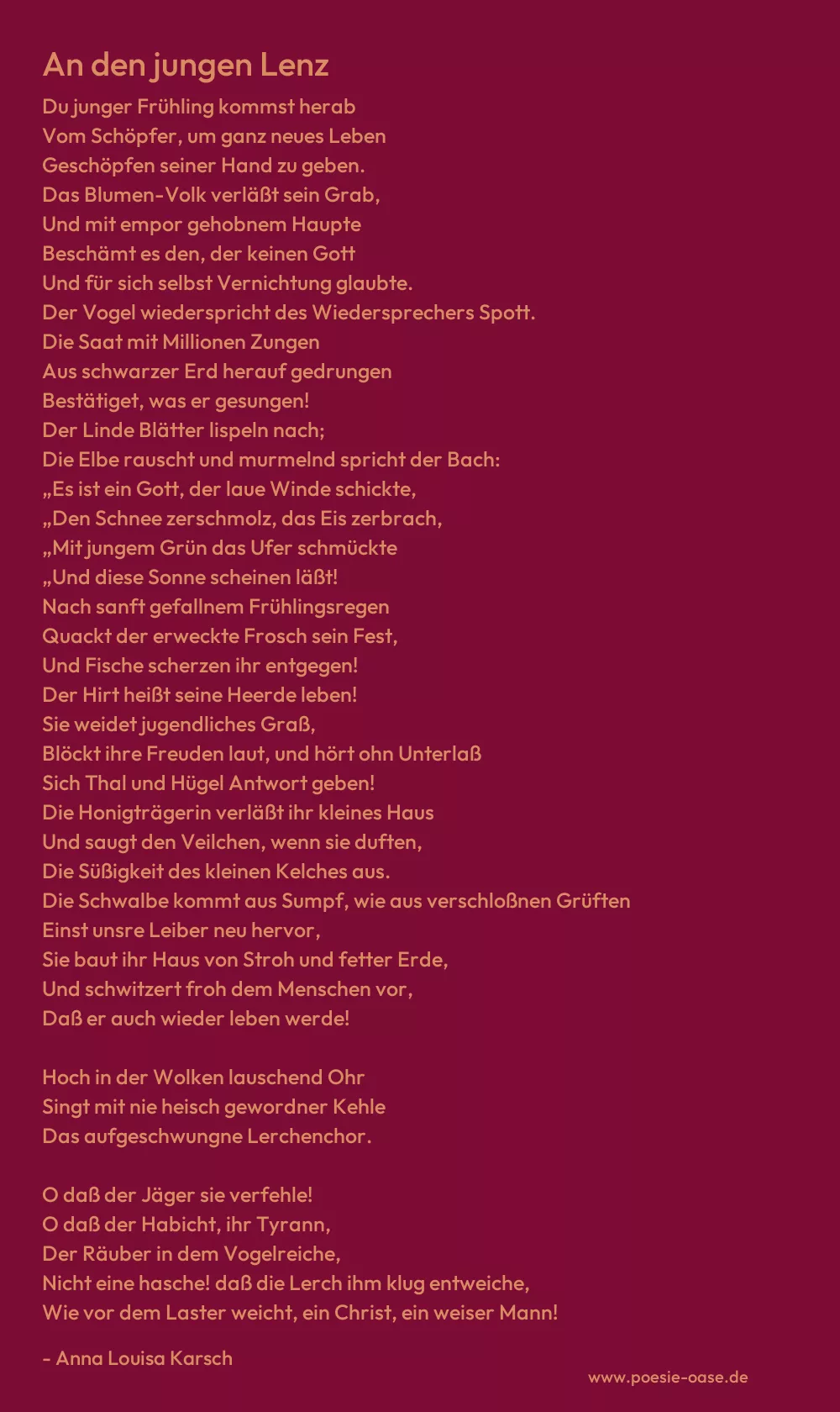
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An den jungen Lenz“ von Anna Louisa Karsch ist ein kraftvolles Natur- und Glaubenslied, das den Frühling als sichtbares Zeugnis für die Existenz und Güte Gottes preist. Mit lebendigen Bildern und einer klaren religiösen Botschaft verbindet die Sprecherin den Neubeginn der Natur mit einem Lob auf die göttliche Schöpfung und einem stillen Tadel gegenüber dem Unglauben.
Der Frühling wird nicht nur als Jahreszeit, sondern als Sendbote Gottes beschrieben, der neues Leben bringt. Aus der Dunkelheit und Kälte des Winters erwacht die Natur zu voller Blüte, was von der Sprecherin als göttliches Wirken interpretiert wird. Blumen, Vögel, Bäche, sogar der Frosch – sie alle sind Teil eines gewaltigen Chores, der bezeugt: „Es ist ein Gott.“ Diese vielfältigen Stimmen der Natur werden zu Zeugen gegen Zweifel und Spott, insbesondere gegen jene, die keinen Gott anerkennen.
Dabei arbeitet Karsch mit zahlreichen Personifikationen: Pflanzen und Tiere werden zu Verkündern göttlicher Ordnung, der Fluss spricht, die Linde lispelt, die Lerche singt ihr Lob empor. Besonders eindrucksvoll ist das Bild der Schwalbe, die aus den Sümpfen zurückkehrt und durch ihre Wiederkehr an die Auferstehung erinnert – eine feine Verknüpfung von Naturbeobachtung und christlicher Hoffnung. Auch die ländliche Idylle mit dem Hirten und seiner Herde fügt sich harmonisch in dieses Bild der erwachten Schöpfung ein.
Am Ende richtet sich der Blick auf die Lerche, die in ihrer Unermüdlichkeit das Lob Gottes in den Himmel trägt. Ihr Gesang wird zu einem Symbol des Glaubens, das nicht unterbrochen werden soll – weder vom Jäger noch vom Raubvogel. Die letzte Bitte, dass die Lerche dem „Habicht“ entkomme wie ein weiser Christ dem Laster, verbindet Naturbild und Moral zu einem eindringlichen Appell: Der Frühling lehrt nicht nur die Schönheit der Welt, sondern auch die Notwendigkeit von Glaube und Tugend.
„An den jungen Lenz“ ist somit ein hymnisches Naturgedicht mit tief religiösem Kern. Anna Louisa Karsch gelingt es, die erwachende Natur als Spiegel göttlicher Schöpferkraft zu zeigen – in einer Sprache, die zugleich sinnlich, bildreich und von gläubiger Zuversicht erfüllt ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.