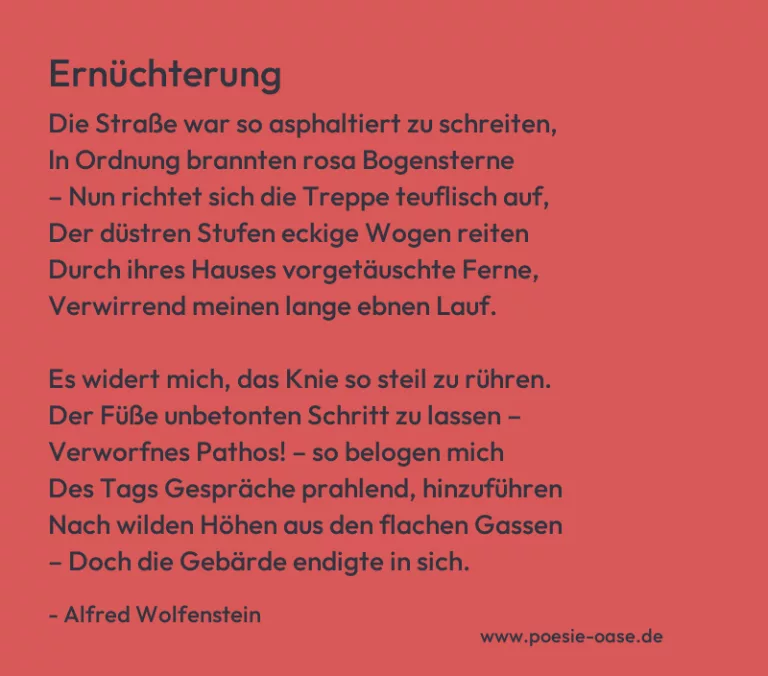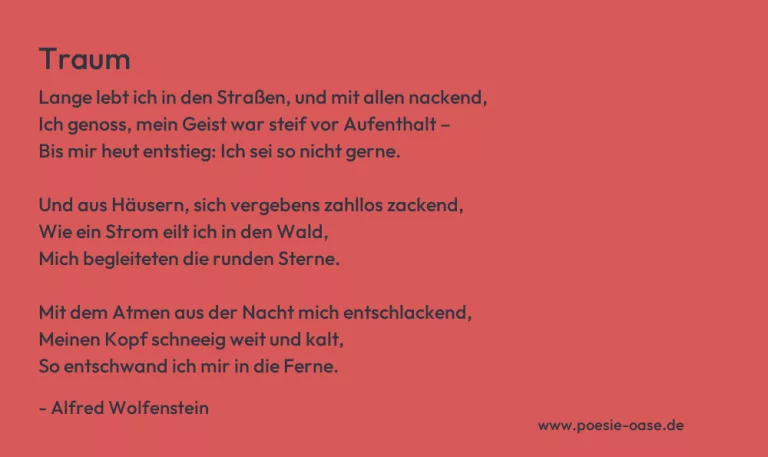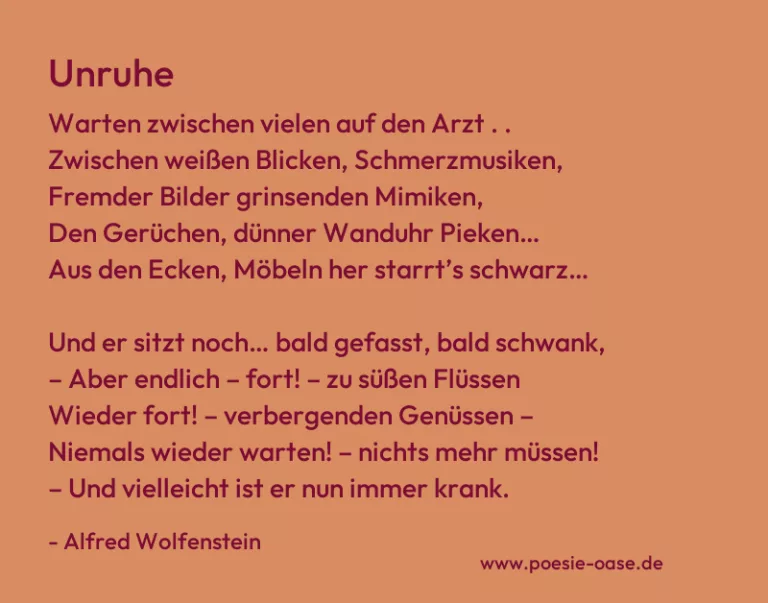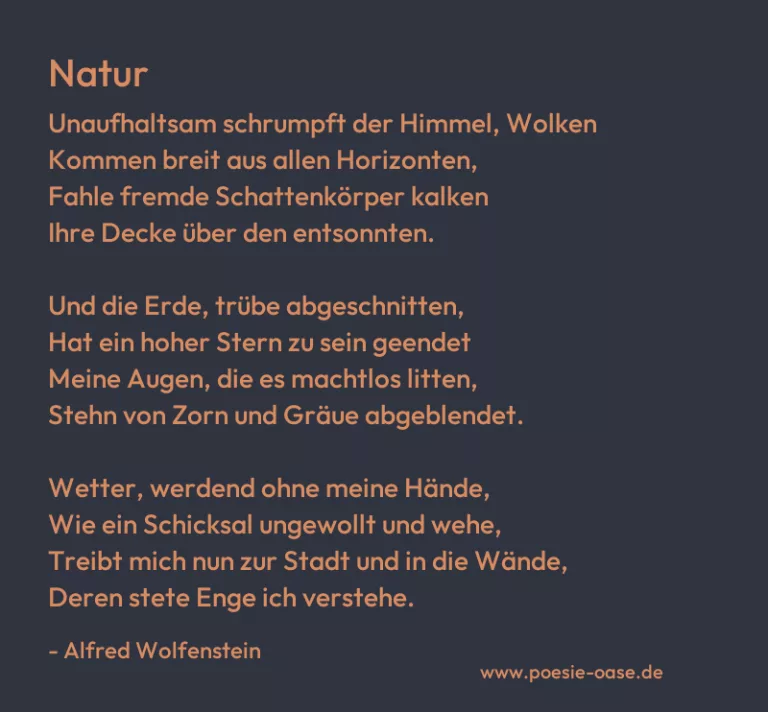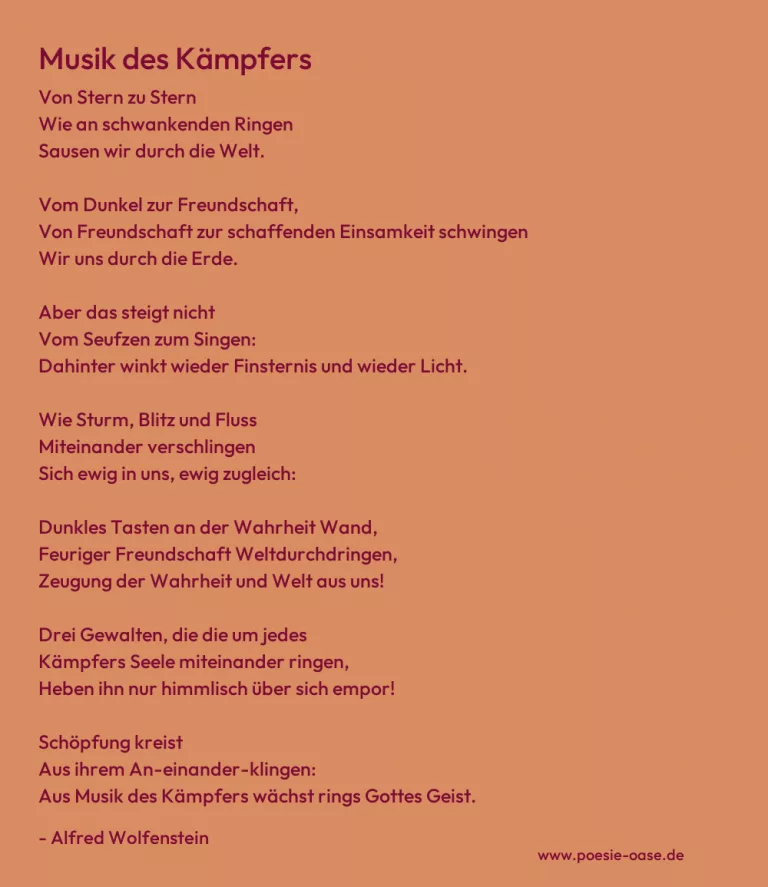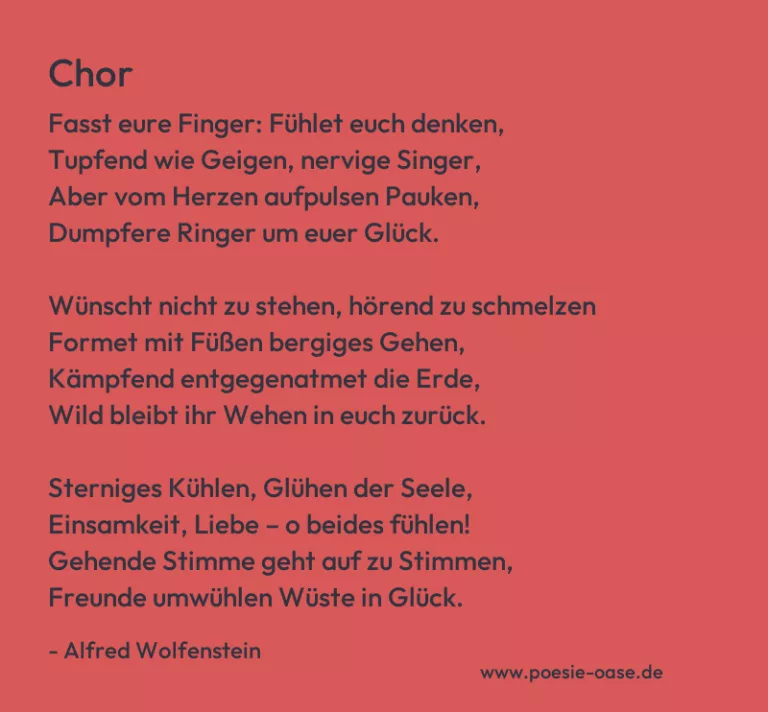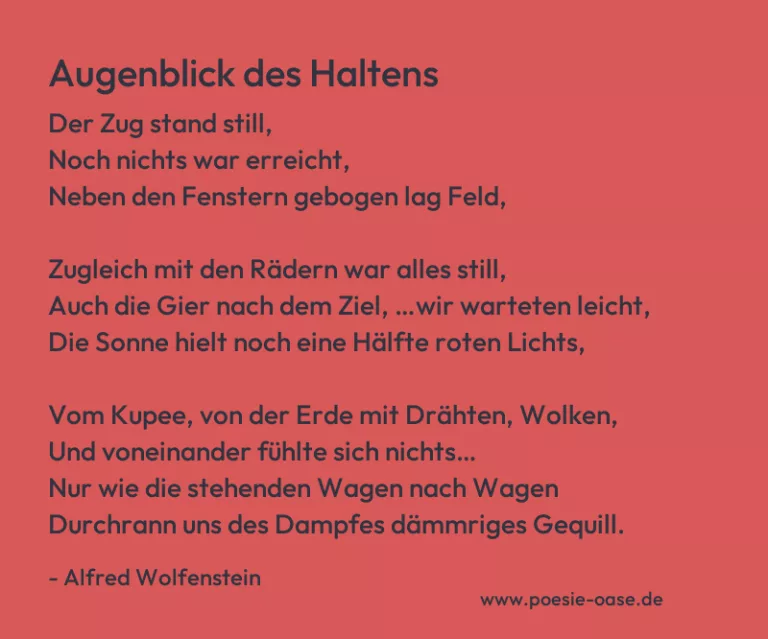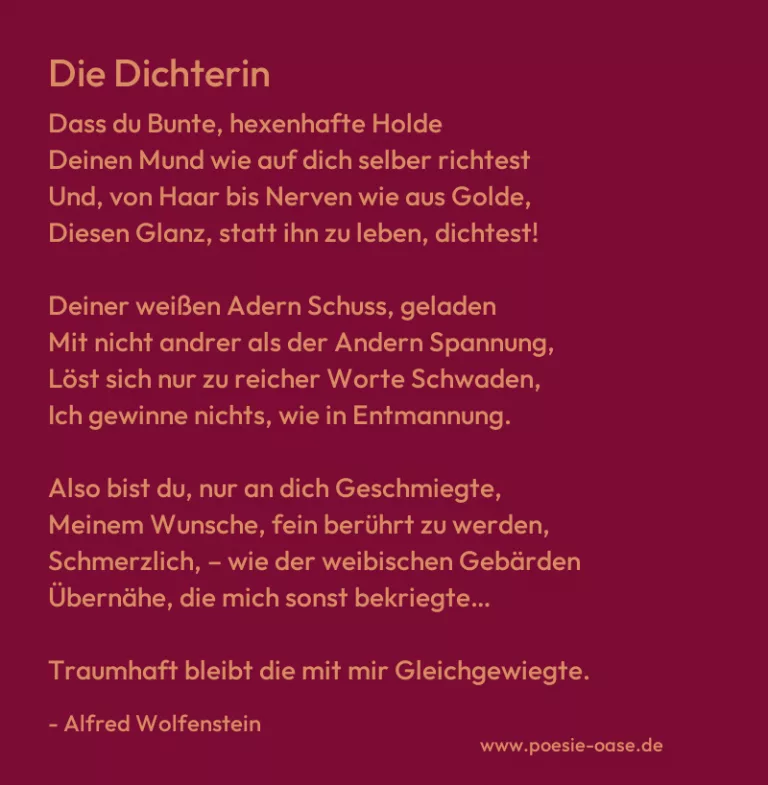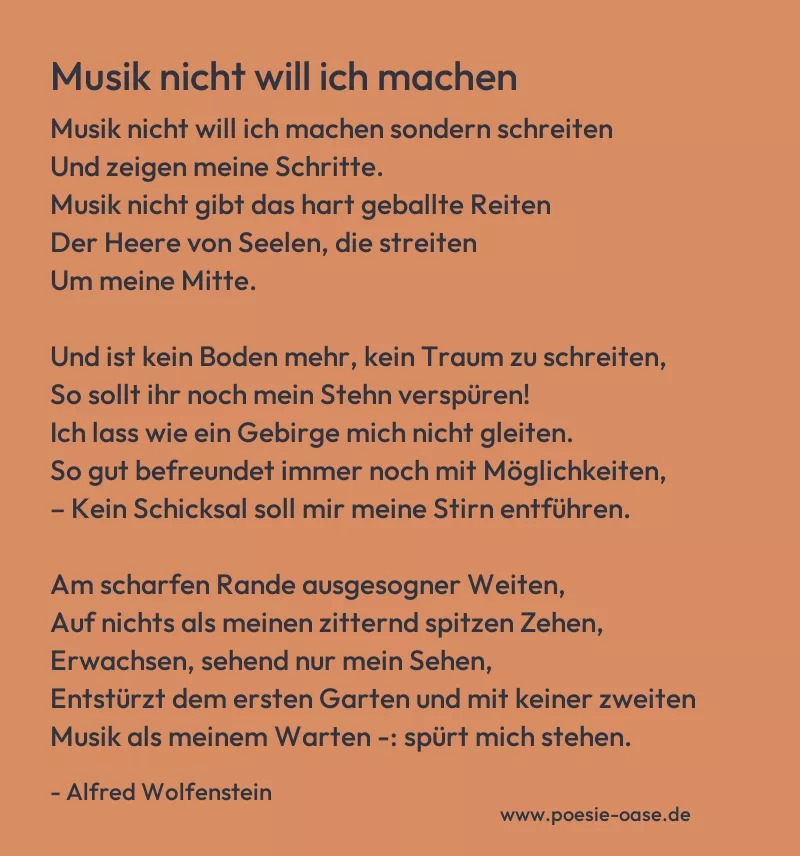Musik nicht will ich machen
Musik nicht will ich machen sondern schreiten
Und zeigen meine Schritte.
Musik nicht gibt das hart geballte Reiten
Der Heere von Seelen, die streiten
Um meine Mitte.
Und ist kein Boden mehr, kein Traum zu schreiten,
So sollt ihr noch mein Stehn verspüren!
Ich lass wie ein Gebirge mich nicht gleiten.
So gut befreundet immer noch mit Möglichkeiten,
– Kein Schicksal soll mir meine Stirn entführen.
Am scharfen Rande ausgesogner Weiten,
Auf nichts als meinen zitternd spitzen Zehen,
Erwachsen, sehend nur mein Sehen,
Entstürzt dem ersten Garten und mit keiner zweiten
Musik als meinem Warten -: spürt mich stehen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
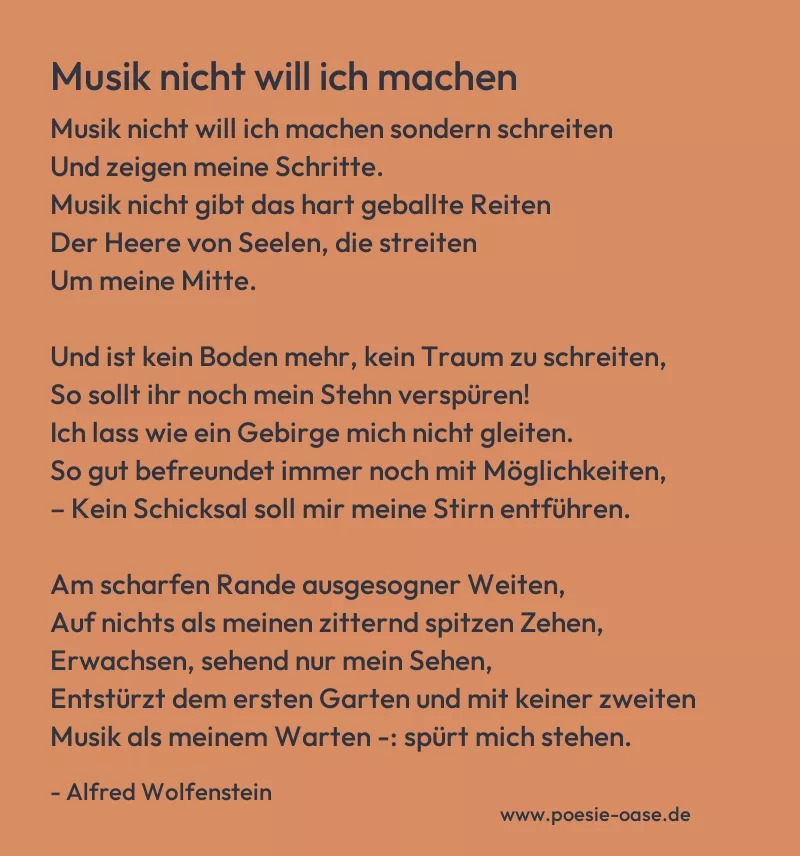
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht Musik nicht will ich machen von Alfred Wolfenstein ist ein Ausdruck radikaler Selbstbehauptung und innerer Unbeugsamkeit in einer Welt der Auflösung und Unsicherheit. Statt Musik zu „machen“ – also harmonisch zu gestalten oder sich einzufügen – will das lyrische Ich „schreiten“ und damit ein klares, sichtbares Zeichen seines Willens und seiner Existenz setzen. Der Begriff der Musik steht hier sinnbildlich für Ordnung, Schönheit oder vielleicht auch Anpassung – all das lehnt das Ich ab zugunsten eines kämpferischen Selbstausdrucks.
Die erste Strophe stellt diesen Gegensatz deutlich heraus: Statt musikalischer Harmonie herrscht in der „Mitte“ des Ichs ein Kampf – „Heere von Seelen“ ringen um seine Identität. Das Ich wird nicht als ruhiger Kern dargestellt, sondern als umkämpfter Ort innerer Vielheit und Spannung. Die Musik wird ersetzt durch das „Reiten“ und „Streiten“, harte, unmelodische Begriffe, die auf das dramatische Ringen um das Selbst hinweisen.
In der zweiten Strophe wird die Standhaftigkeit des Ichs betont. Selbst wenn kein Weg („kein Boden“, „kein Traum“) mehr vorhanden ist, will es durch sein „Stehn“ noch spürbar sein. Dieses Stehen ist kein passives Verharren, sondern ein aktives Aushalten, ein Widerstand gegen äußere Kräfte. Die Metapher vom „Gebirge“ unterstreicht diese Unerschütterlichkeit, ebenso wie der Trotz gegenüber dem Schicksal: „Kein Schicksal soll mir meine Stirn entführen“. Die Stirn – oft Symbol für Würde, Stolz oder Denken – bleibt unangetastet.
Die dritte Strophe beschreibt einen prekären Zustand der existenziellen Grenzsituation: Das Ich steht „am scharfen Rande ausgesogner Weiten“ – eine eindringliche Metapher für Auszehrung, Leere und Bedrohung. Es balanciert auf „zitternd spitzen Zehen“, wirkt verwundbar und doch aufrecht. Die Anspielung auf den „ersten Garten“ – ein Verweis auf das biblische Paradies – macht deutlich, dass das Ich aus ursprünglicher Geborgenheit „entstürzt“ ist und keine zweite Erlösung sucht. Die einzige Musik, die bleibt, ist das „Warten“ – ein stilles, innerlich gespanntes Ausharren, das jedoch wieder auf das „Stehen“ zurückgeführt wird.
Musik nicht will ich machen ist ein stark expressionistisches Gedicht, das den Widerstand des Einzelnen gegen die Auflösung von Ordnung, Bedeutung und innerer Ganzheit feiert. Die Sprache ist kraftvoll, bildreich und rhythmisch dicht, zugleich durchzogen von Brüchen und Spannungen, die das innere Ringen des lyrischen Ichs unmittelbar erfahrbar machen. Wolfenstein gestaltet das Bild eines modernen Menschen, der sich trotz existenzieller Unsicherheit behauptet – ohne Harmonie, aber mit Haltung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.