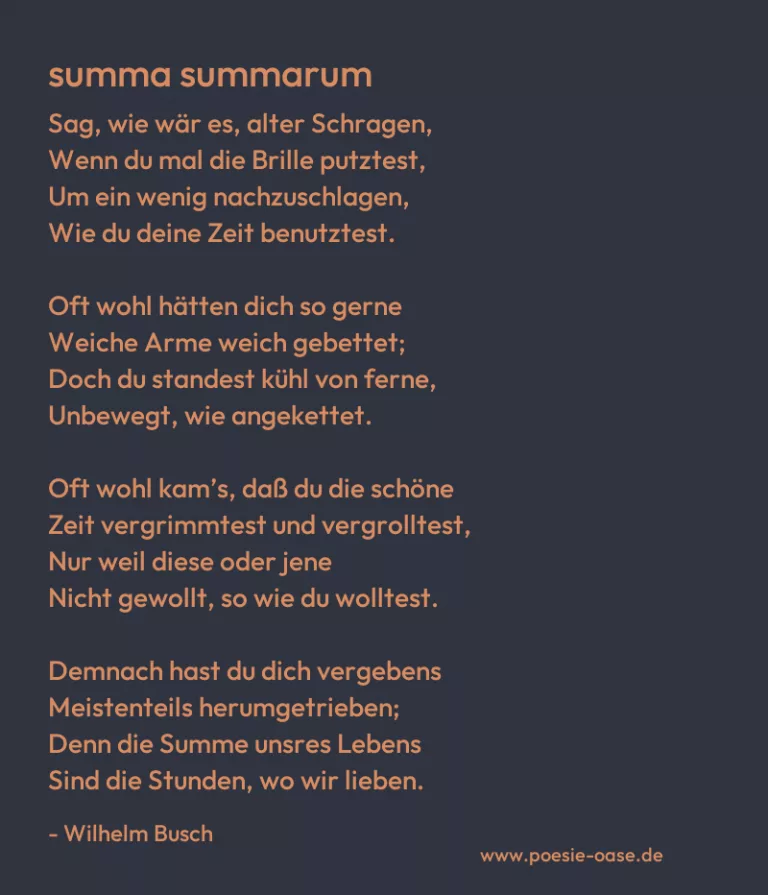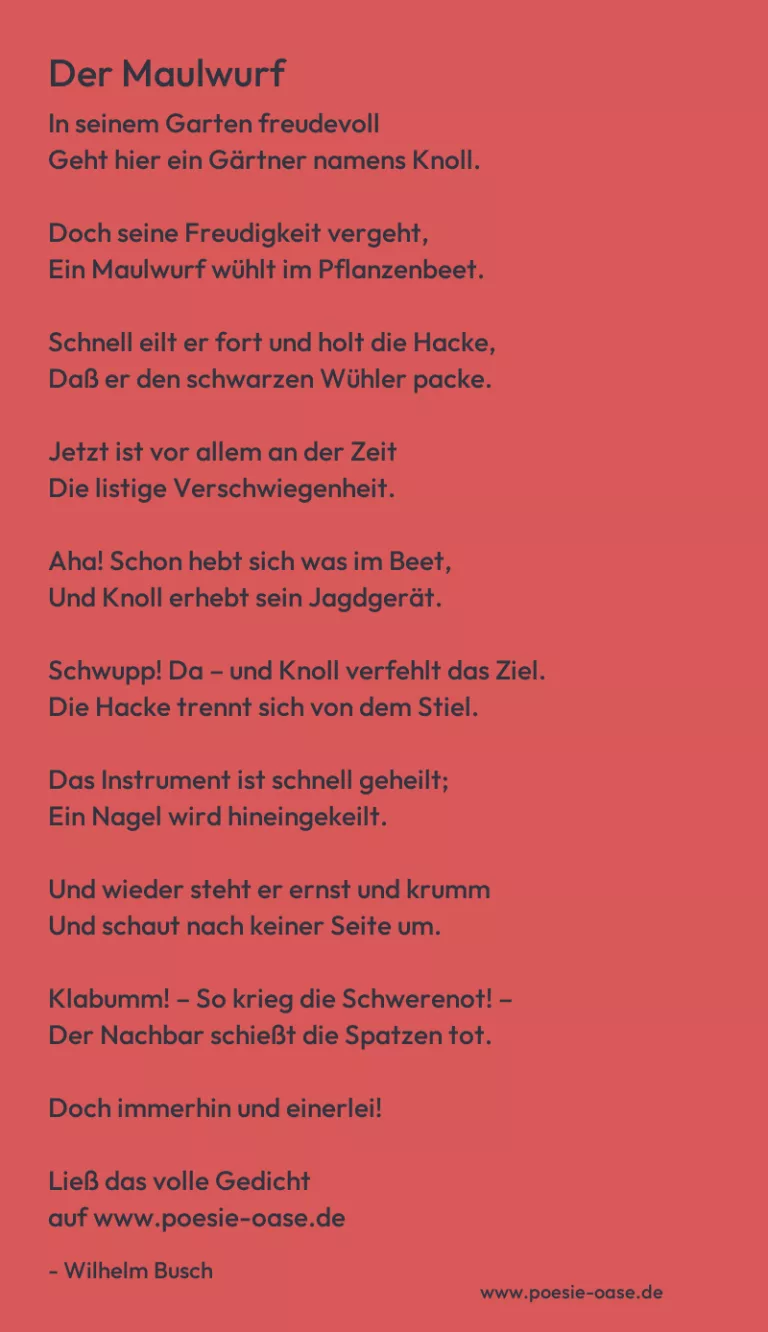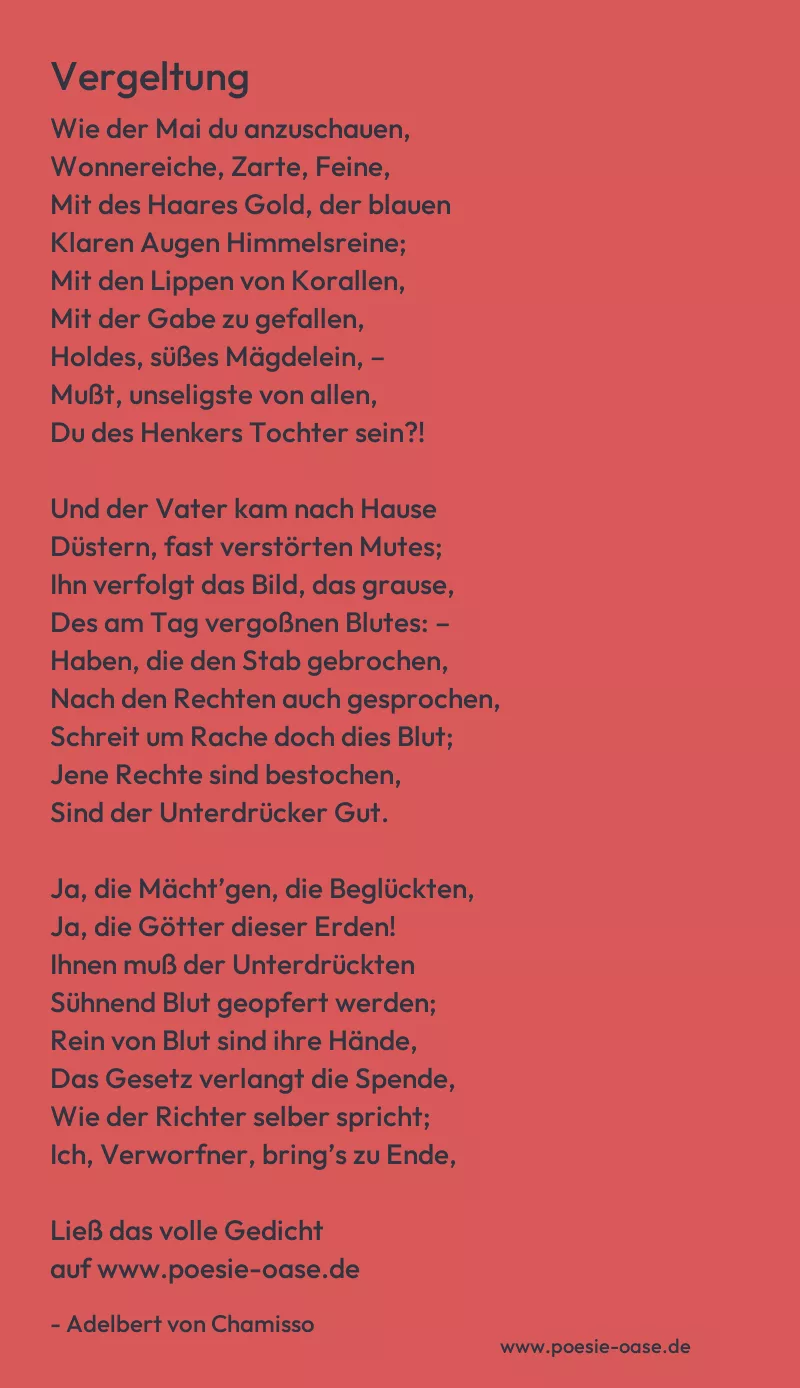Wie der Mai du anzuschauen,
Wonnereiche, Zarte, Feine,
Mit des Haares Gold, der blauen
Klaren Augen Himmelsreine;
Mit den Lippen von Korallen,
Mit der Gabe zu gefallen,
Holdes, süßes Mägdelein, –
Mußt, unseligste von allen,
Du des Henkers Tochter sein?!
Und der Vater kam nach Hause
Düstern, fast verstörten Mutes;
Ihn verfolgt das Bild, das grause,
Des am Tag vergoßnen Blutes: –
Haben, die den Stab gebrochen,
Nach den Rechten auch gesprochen,
Schreit um Rache doch dies Blut;
Jene Rechte sind bestochen,
Sind der Unterdrücker Gut.
Ja, die Mächt’gen, die Beglückten,
Ja, die Götter dieser Erden!
Ihnen muß der Unterdrückten
Sühnend Blut geopfert werden;
Rein von Blut sind ihre Hände,
Das Gesetz verlangt die Spende,
Wie der Richter selber spricht;
Ich, Verworfner, bring’s zu Ende,
Ob das Herz darob mir bricht.
Recht und Freiheit! rufen wollte
Dieser noch, da scholl der dumpfe
Trommelschlag, – ein Wink, – es rollte
Schnell sein Haupt getrennt vom Rumpfe.
Morgen werden Mütter weinen,
Morgen folgen zwei dem einen,
Und gebrandmarkt werden drei! –
Möchte noch der Tag mir scheinen,
Wo Vergeltung Losung sei! –
Wühlt in seines Herzens Wunden
So der Alte trüb und trüber,
Und die nächtlich bangen Stunden
Ziehen träg an ihm vorüber;
Ewig scheint die Nacht zu dauern;
Wahngebilde sieht er lauern,
Wo sein Auge starrend ruht;
Sieht an den geweißten Mauern
Rieseln der Gerechten Blut.
Und er hofft die düstern Sorgen
Sich beschäft’gend abzustreifen,
Im voraus zum andern Morgen
Will er Beil und Messer schleifen,
Will am Herde sich bemühen
Noch die Stempel auszuglühen,
Die er morgen brauchen soll; –
Blutrot sieht er Funken sprühen
Um das Eisen schreckenvoll.
Blut und Blut! Die grausen Bilder
Stürmen auf ihn ein und hadern,
Es empöret wild und wilder
Sich das Blut in seinen Adern;
Frieden hofft er nur zu finden,
Sich der Angst nur zu entwinden
In der reinen Unschuld Näh: –
Dieser Spuk, er wird verschwinden,
Wann ich meine Tochter seh.
Nahen will ich ihr, mich halten
Ihr zu Häupten, nur sie schauen,
Zum Gebet die Hände falten
Und auf meinen Gott vertrauen. –
Wie er sagte, also tat er,
Sorglich, leisen Schrittes naht‘ er,
Nicht zu stören ihre Ruh; –
Was, verzweiflungsvoller Vater,
Zuckst dein scharfes Messer du?
Ach du siehest, weh dir Armen!
Siehst den Wüstling, siehst den Grafen,
Siehst der Tochter in den Armen
Den Verführer eingeschlafen.
Im Begriff, den Stoß zu führen,
Wirst du andres noch erküren,
Ja! du wirfst das Messer weit, –
Zeit war’s, jene Glut zu schüren,
Und der Stempel liegt bereit. –
Wirst nicht, Schandbub, mit dem Leben
Nur die Freveltat mir büßen;
Werde meinen Fluch dir geben,
Und du wirst dich krümmen müssen,
Trage du auf deiner bleichen
Stirne dieses Kainszeichen,
Eingebrannt von meiner Hand!
Magst so ungefährdet schleichen,
Mann der Sünde, durch das Land.
Zischend brennt sich ein das Eisen,
Schreiend fährt er aus dem Schlafe,
Und erblickt den grimmen Greisen
Mit dem Werkzeug seiner Strafe. –
„Zeuch von hinnen! dein Erwachen
Möge den noch glaubend machen,
Der Vergeltung nicht geglaubt;
Gott ist mächtig in dem Schwachen“:
Spricht’s und wiegt sein graues Haupt.