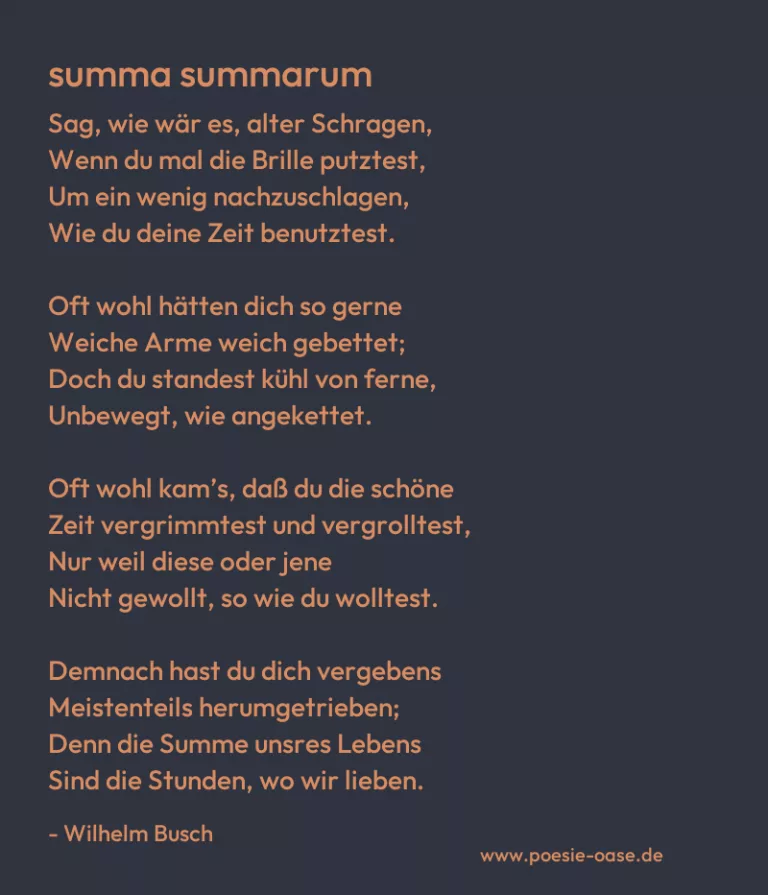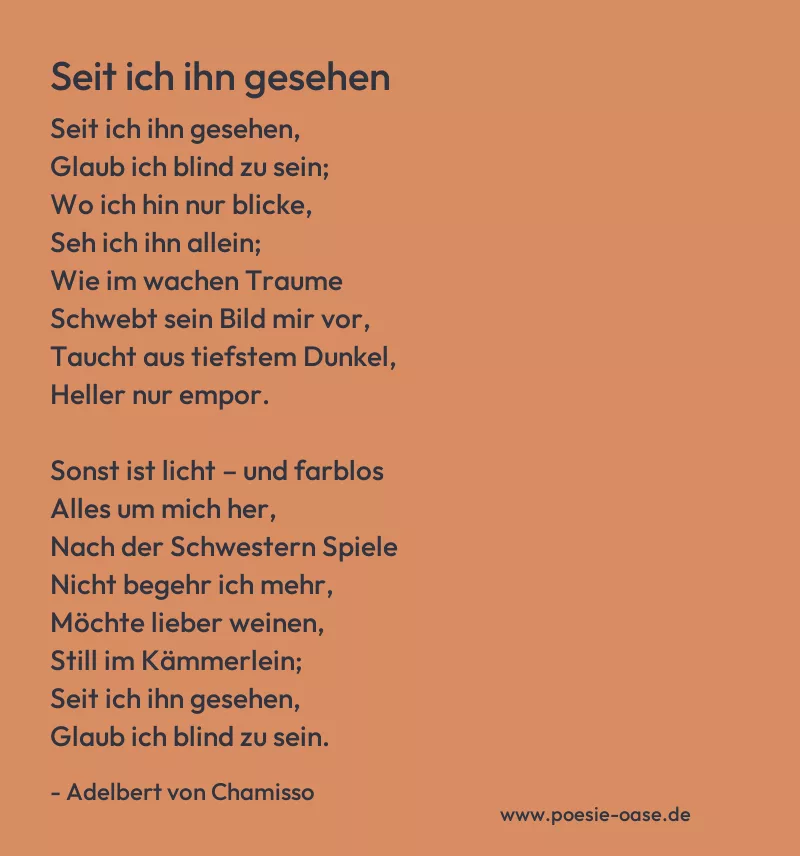Seit ich ihn gesehen
Seit ich ihn gesehen,
Glaub ich blind zu sein;
Wo ich hin nur blicke,
Seh ich ihn allein;
Wie im wachen Traume
Schwebt sein Bild mir vor,
Taucht aus tiefstem Dunkel,
Heller nur empor.
Sonst ist licht – und farblos
Alles um mich her,
Nach der Schwestern Spiele
Nicht begehr ich mehr,
Möchte lieber weinen,
Still im Kämmerlein;
Seit ich ihn gesehen,
Glaub ich blind zu sein.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
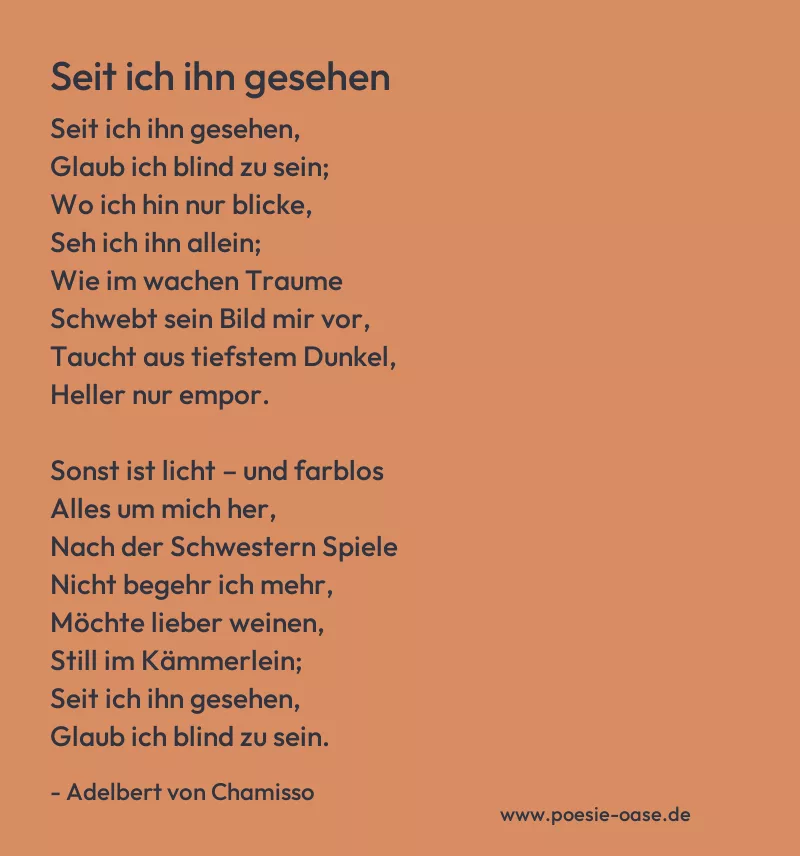
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Seit ich ihn gesehen“ von Adelbert von Chamisso beschreibt in schlichter, aber eindringlicher Sprache das Erleben einer jungen Frau, die von der ersten Liebe überwältigt ist. Das lyrische Ich schildert, wie die Begegnung mit einem Mann ihre Wahrnehmung vollkommen verändert hat – seit diesem Moment scheint die Außenwelt an Bedeutung verloren zu haben. Die wiederholte Zeile „Seit ich ihn gesehen, / Glaub ich blind zu sein“ rahmt das Gedicht und bringt das zentrale Motiv der Liebe als alles verzehrende, fast isolierende Kraft zum Ausdruck.
Die Bildsprache des Gedichts ist von sanfter Innerlichkeit geprägt. Die Metapher vom „wachen Traume“ unterstreicht, wie sehr das Bild des Geliebten das Denken und Fühlen der Sprecherin bestimmt – real und unwirklich zugleich. Er „schwebt“ vor ihrem inneren Auge, seine Erscheinung wird aus dem „tiefsten Dunkel“ immer heller – eine poetische Darstellung des seelischen Aufleuchtens, das die Liebe bewirkt.
Gleichzeitig zeigt das Gedicht auch eine leise Melancholie: Die Außenwelt erscheint „licht- und farblos“, alltägliche Dinge wie das Spiel mit den Schwestern verlieren ihren Reiz. Stattdessen zieht sich die Sprecherin ins stille Kämmerlein zurück, möchte „lieber weinen“ – ein Ausdruck tiefer Innerlichkeit und vielleicht auch der Unsicherheit, ob diese Liebe erwidert wird.
In seiner ruhigen, kreisförmigen Struktur spiegelt das Gedicht den Zustand einer ersten, überwältigenden Verliebtheit wider, die das Ich sowohl verzaubert als auch von der Welt entfremdet. Es ist ein zartes Porträt jugendlicher Sehnsucht, das zugleich von Einsamkeit und intensiver Innerlichkeit spricht – Liebe wird hier nicht als äußere Handlung, sondern als tiefgreifende Veränderung der Wahrnehmung und des Empfindens gezeigt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.