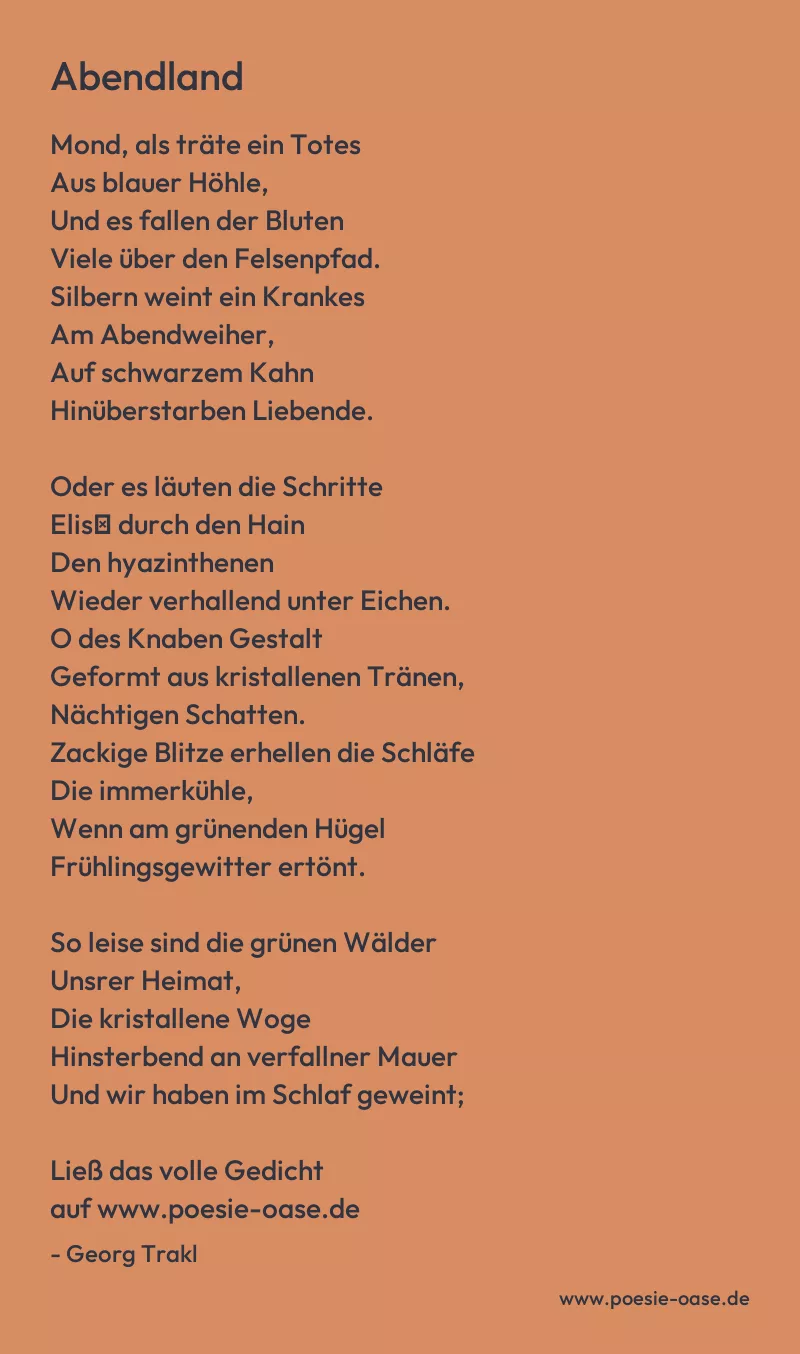Abendland
Mond, als träte ein Totes
Aus blauer Höhle,
Und es fallen der Bluten
Viele über den Felsenpfad.
Silbern weint ein Krankes
Am Abendweiher,
Auf schwarzem Kahn
Hinüberstarben Liebende.
Oder es läuten die Schritte
Elis′ durch den Hain
Den hyazinthenen
Wieder verhallend unter Eichen.
O des Knaben Gestalt
Geformt aus kristallenen Tränen,
Nächtigen Schatten.
Zackige Blitze erhellen die Schläfe
Die immerkühle,
Wenn am grünenden Hügel
Frühlingsgewitter ertönt.
So leise sind die grünen Wälder
Unsrer Heimat,
Die kristallene Woge
Hinsterbend an verfallner Mauer
Und wir haben im Schlaf geweint;
Wandern mit zögernden Schritten
An der dornigen Hecke hin Singende
im Abendsommer, In heiliger Ruh
Des fern verstrahlenden Weinbergs;
Schatten nun im kühlen Schoß
Der Nacht, trauernde Adler.
So leise schließt ein mondener Strahl
Die purpurnen Male der Schwermut.
Ihr großen Städte
Steinern aufgebaut
In der Ebene! So sprachlos folgt
Der Heimatlose
Mit dunbler Stirne dem Wind,
Kahlen Bäumen am Hügel.
Ihr weithin dämmernden Ströme!
Gewaltig ängstet
Schaurige Abendröte
Im Sturmgewölk.
Ihr sterbenden Völker!
Bleiche Woge
Zerschellend am Strande der Nacht,
Fallende Sterne.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
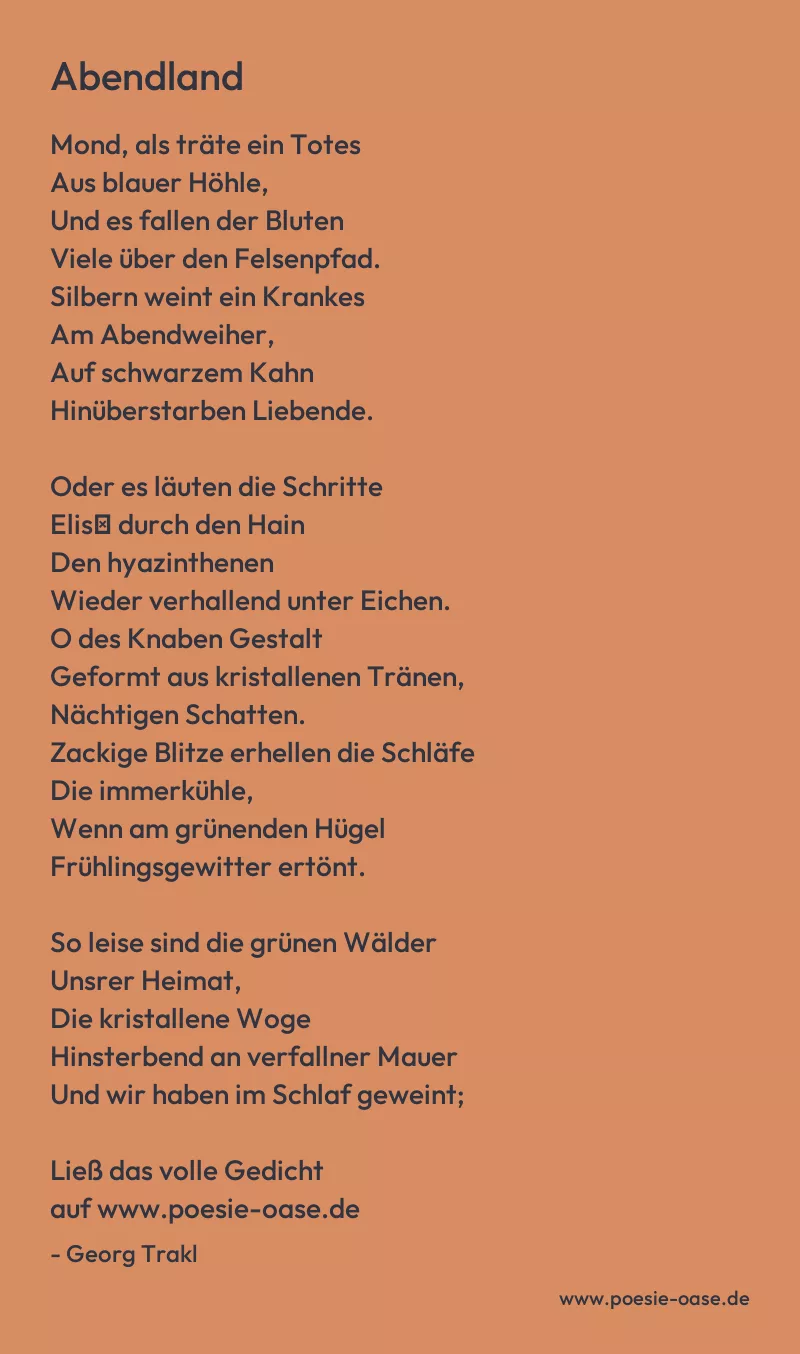
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Abendland“ von Georg Trakl ist eine düstere Reflexion über den Niedergang und die Vergänglichkeit, die in der Atmosphäre des spätromantischen Expressionismus wurzelt. Das Gedicht beschreibt eine Welt des Verfalls und der Trauer, in der das Abendland, also die westliche Zivilisation, als eine dem Untergang geweihte Region wahrgenommen wird. Trakl verwendet eine Vielzahl von Bildern und Symbolen, um diese Stimmung zu erzeugen, darunter der Mond, der wie ein Toter aus einer blauen Höhle tritt, weinende Kranke, sterbende Liebende, und eine melancholische Natur, die von Herbst und Dunkelheit geprägt ist.
Die Struktur des Gedichts ist komplex und unregelmäßig, was zur Unheimlichkeit und zur emotionalen Intensität beiträgt. Es ist in mehrere Abschnitte unterteilt, die durch unterschiedliche Bilder und Motive verbunden sind. Wiederkehrende Elemente wie der Mond, das Wasser und die Farbe Blau verstärken das Gefühl von Melancholie und Auflösung. Die erwähnten „sterbenden Völker“ und „fallenden Sterne“ unterstreichen die Vorstellung vom unausweichlichen Verfall und der Zerstörung. Die Verwendung von Adjektiven wie „schwarz“, „dunkel“ und „traurig“ verstärkt die Atmosphäre der Verzweiflung und des Verlusts.
Die Personen und Orte im Gedicht, wie zum Beispiel „Elis“ oder der „Weinberg“, haben eine symbolische Bedeutung. „Elis“ könnte als ein Hinweis auf Trakls Schwester Margarete gedeutet werden, und repräsentiert somit die Verlorenheit und das Leid des Einzelnen. Der „Weinberg“ steht für eine vergangene Idylle, die von der Gegenwart durch den „Abendsommer“ und „trauernde Adler“ kontrastiert wird, die das Ende des Tages, aber auch des Lebens ankündigen. Die „großen Städte“ und „dämmernden Ströme“ stehen für die Zivilisation, die der gleichen Vergänglichkeit unterliegt wie die Natur und der Mensch.
Trakls Sprachstil ist geprägt von einer starken Verwendung von Metaphern, Chiffren und Synästhesien. Dies verleiht dem Gedicht eine besondere Dichte und Vielschichtigkeit, die es dem Leser erschwert, eine eindeutige Interpretation vorzunehmen. Die Bedeutung liegt in der emotionalen Wirkung, in der Erschaffung einer Atmosphäre von Trauer, Verlust und dem Gefühl des Untergangs. Das Gedicht ist ein düsteres Meisterwerk, das die Zerrissenheit und die Ängste des frühen 20. Jahrhunderts widerspiegelt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.