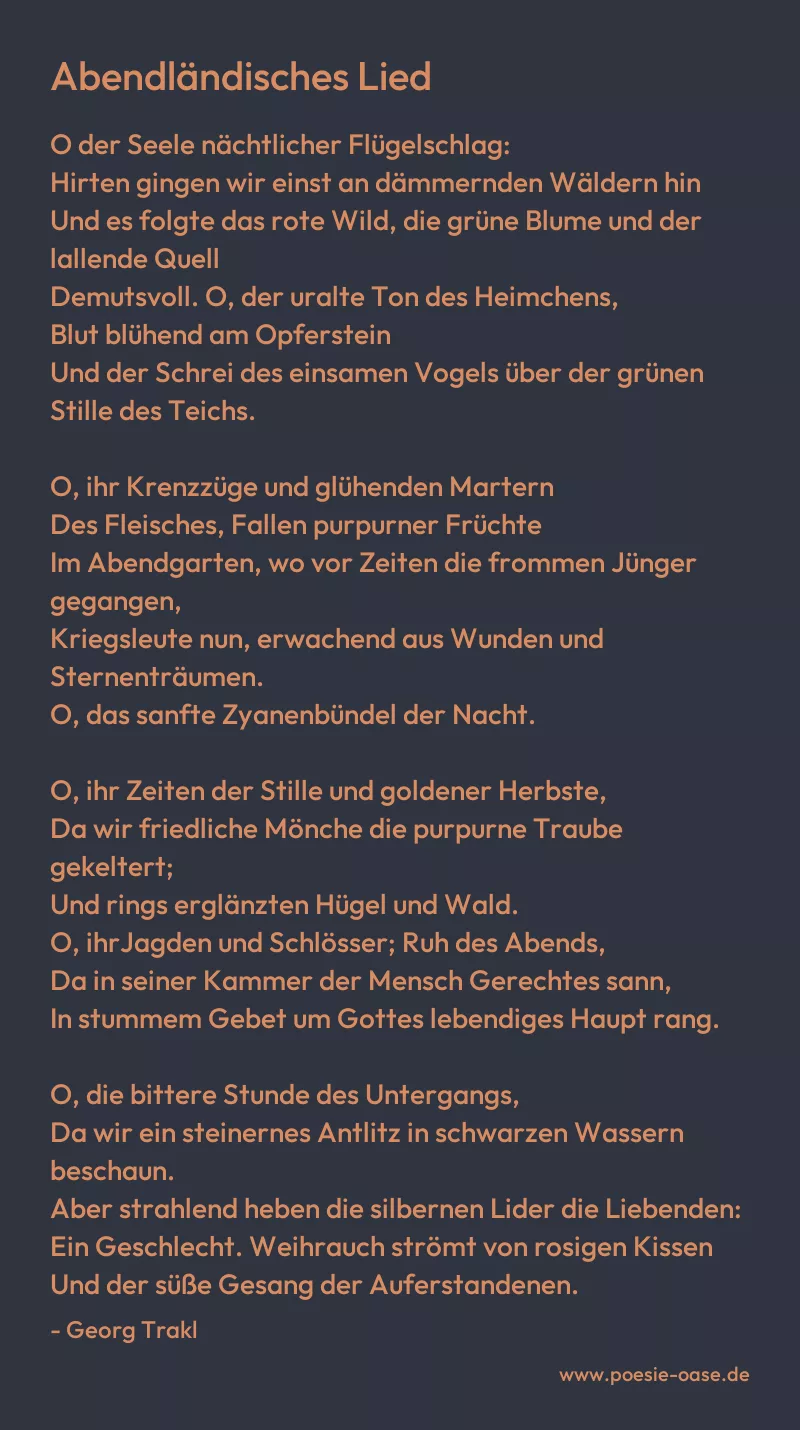Abendländisches Lied
O der Seele nächtlicher Flügelschlag:
Hirten gingen wir einst an dämmernden Wäldern hin
Und es folgte das rote Wild, die grüne Blume und der lallende Quell
Demutsvoll. O, der uralte Ton des Heimchens,
Blut blühend am Opferstein
Und der Schrei des einsamen Vogels über der grünen Stille des Teichs.
O, ihr Krenzzüge und glühenden Martern
Des Fleisches, Fallen purpurner Früchte
Im Abendgarten, wo vor Zeiten die frommen Jünger gegangen,
Kriegsleute nun, erwachend aus Wunden und Sternenträumen.
O, das sanfte Zyanenbündel der Nacht.
O, ihr Zeiten der Stille und goldener Herbste,
Da wir friedliche Mönche die purpurne Traube gekeltert;
Und rings erglänzten Hügel und Wald.
O, ihrJagden und Schlösser; Ruh des Abends,
Da in seiner Kammer der Mensch Gerechtes sann,
In stummem Gebet um Gottes lebendiges Haupt rang.
O, die bittere Stunde des Untergangs,
Da wir ein steinernes Antlitz in schwarzen Wassern beschaun.
Aber strahlend heben die silbernen Lider die Liebenden:
Ein Geschlecht. Weihrauch strömt von rosigen Kissen
Und der süße Gesang der Auferstandenen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
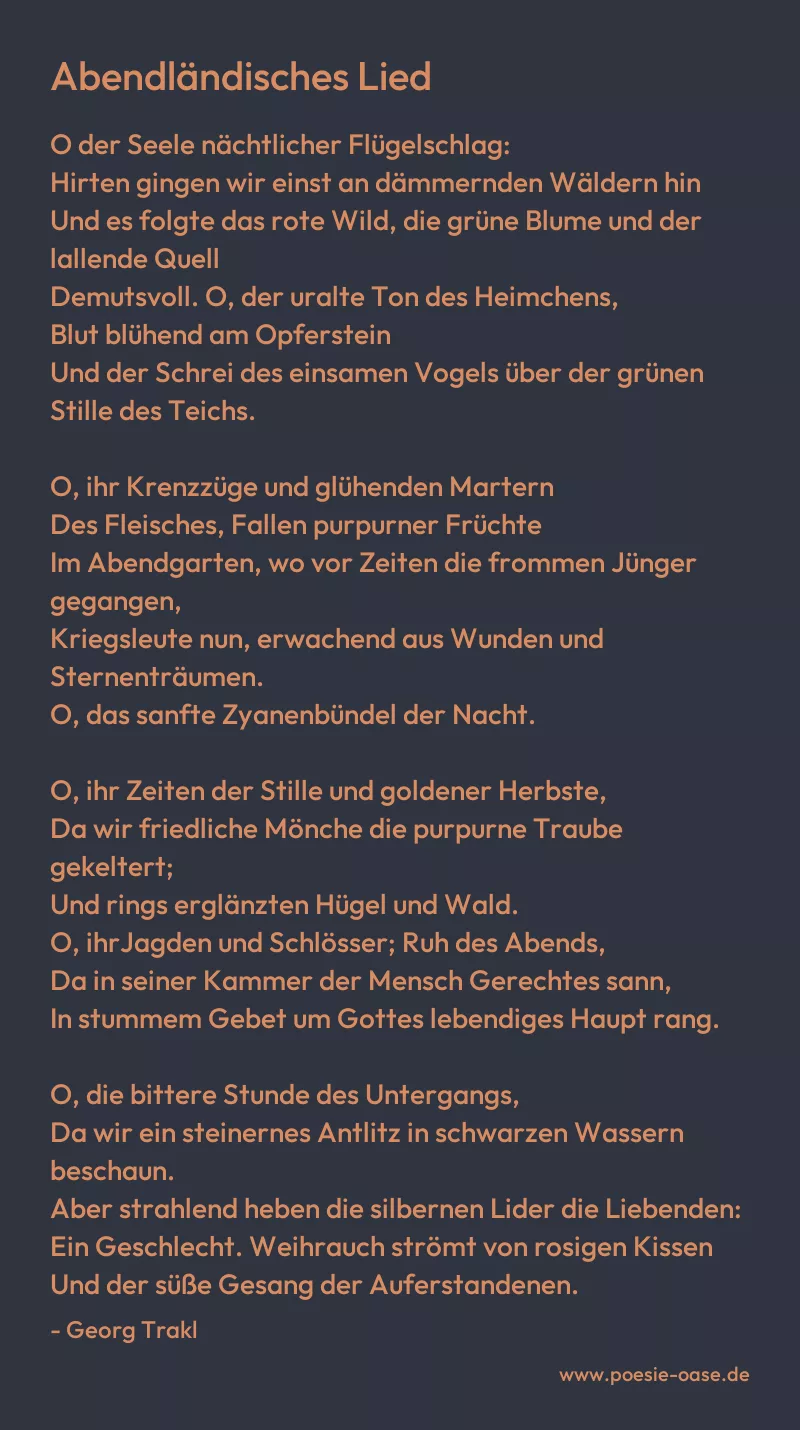
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Abendländisches Lied“ von Georg Trakl ist eine düstere und melancholische Reflexion über den Untergang des Abendlandes und die menschliche Erfahrung von Leid, Verlust und Erlösung. Das Gedicht ist reich an Symbolen und Bildern, die eine beklemmende Atmosphäre erzeugen und den Leser in eine Welt der Vergänglichkeit und des spirituellen Schmerzes entführen.
In der ersten Strophe werden Bilder der Natur und des Unschuldigen heraufbeschworen: „Hirten gingen wir einst an dämmernden Wäldern hin“, begleitet von „rotem Wild, die grüne Blume und der lallende Quell“. Dies deutet auf eine verlorene, idyllische Vergangenheit hin. Allerdings wird diese Idylle durch das Bild des „Blut[es] blühend am Opferstein“ und den „Schrei des einsamen Vogels“ unterbrochen, was auf eine untergründige Gewalt und Einsamkeit hindeutet, die die Unschuld trüben. Trakl verwebt hier Natur und Schrecken, um die Ambivalenz der menschlichen Existenz auszudrücken.
Die zweite Strophe wendet sich den „Kreuzezügen und glühenden Martern“ zu und deutet auf eine Geschichte der Gewalt und des Leids hin. Die „purpurnen Früchte“ im „Abendgarten“ weisen auf Verführung und Vergänglichkeit hin, während die „Kriegsleute“ und „Sternenträume“ eine traumatische Vergangenheit und Gegenwart implizieren. Der „sanfte Zyanenbündel der Nacht“ suggeriert eine Schönheit, die untrennbar mit dem Tod verbunden ist, was die düstere Grundstimmung verstärkt.
Die dritte Strophe erinnert an eine Zeit der Stille und des Friedens, repräsentiert durch „friedliche Mönche“ und die „goldenen Herbste“. Diese Strophe bietet einen kurzen Moment der Hoffnung, doch auch hier sind Bilder der Vergänglichkeit präsent, wie etwa die Erwähnung von Jagden und Schlössern, die letztlich der Vergänglichkeit unterliegen. Der „Mensch Gerechtes“ in seiner Kammer deutet auf ein Streben nach Spiritualität und Erlösung hin, das durch die „stumme Gebet[e]“ zum Ausdruck kommt.
Die abschließende Strophe ist von einer Atmosphäre des Untergangs und der Erlösung geprägt. Das „steinernes Antlitz in schwarzen Wassern“ spiegelt das Bild der eigenen Verlorenheit wider. Doch trotz des Untergangs gibt es einen Hoffnungsschimmer: „strahlend heben die silbernen Lider die Liebenden: Ein Geschlecht“, gefolgt von „Weihrauch strömt“ und dem „süße[n] Gesang der Auferstandenen“. Diese letzten Zeilen deuten auf eine mögliche Erneuerung und Erlösung hin, die trotz des Untergangs der Welt verbleibt. Das Gedicht endet somit mit einem ambivalenten Gefühl von Verlust und Hoffnung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.