Heiratet reich, es gereuet nie,
Doch bald, eh der Lorbeer im Welken,
Um, wenn ausgemolken die Poesie,
Die Kuh im Hause zu melken.
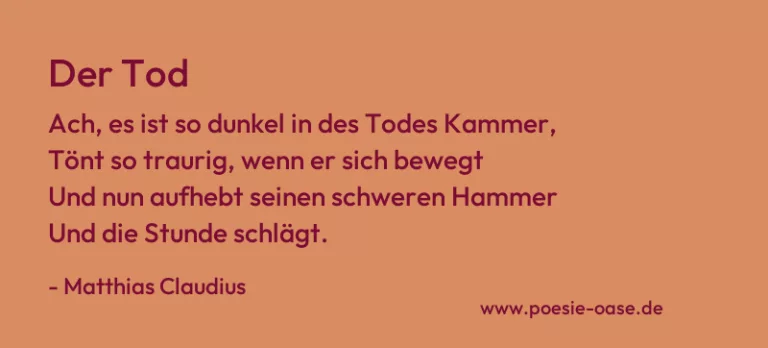
Der Tod
- Gemeinfrei
- Jahreszeiten
Heiratet reich, es gereuet nie,
Doch bald, eh der Lorbeer im Welken,
Um, wenn ausgemolken die Poesie,
Die Kuh im Hause zu melken.
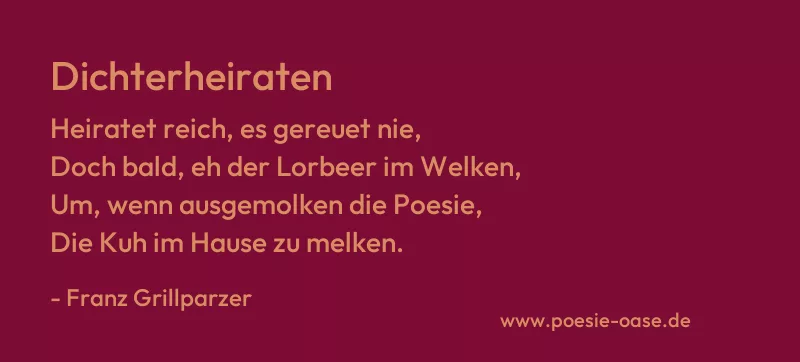
Das Gedicht „Dichterheiraten“ von Franz Grillparzer ist eine satirische Betrachtung über die Heirat eines Dichters und die Vergänglichkeit dichterischer Inspiration. In prägnanten vier Zeilen verknüpft Grillparzer das Motiv des Ruhms mit der ökonomischen Realität, indem er dem Dichter rät, eine wohlhabende Frau zu heiraten. Der erste Vers „Heiratet reich, es gereuet nie“ stellt die pragmatische Empfehlung in den Vordergrund: Eine reiche Heirat wird nie bereut, da sie finanzielle Sicherheit bietet. Besonders betont wird die Notwendigkeit der frühen Eheschließung, „bald, eh der Lorbeer im Welken“, also bevor der Ruhm des Dichters verblasst. Der Lorbeerkranz, traditionelles Symbol für dichterische Anerkennung, verliert mit der Zeit an Bedeutung – ein Hinweis auf die Vergänglichkeit des Erfolgs. Die letzten beiden Verse setzen diesen Gedanken humorvoll fort: Sobald „die Poesie ausgemolken“ ist, bleibt dem Dichter nur noch die häusliche Abhängigkeit von seiner wohlhabenden Frau. Die Metapher der „Kuh im Hause“ deutet darauf hin, dass der Dichter, einst von Inspiration getragen, nun auf wirtschaftliche Absicherung angewiesen ist. Grillparzer spielt damit ironisch auf die Schwierigkeit an, von der Dichtkunst allein zu leben, und karikiert das Spannungsfeld zwischen Idealismus und materieller Notwendigkeit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.