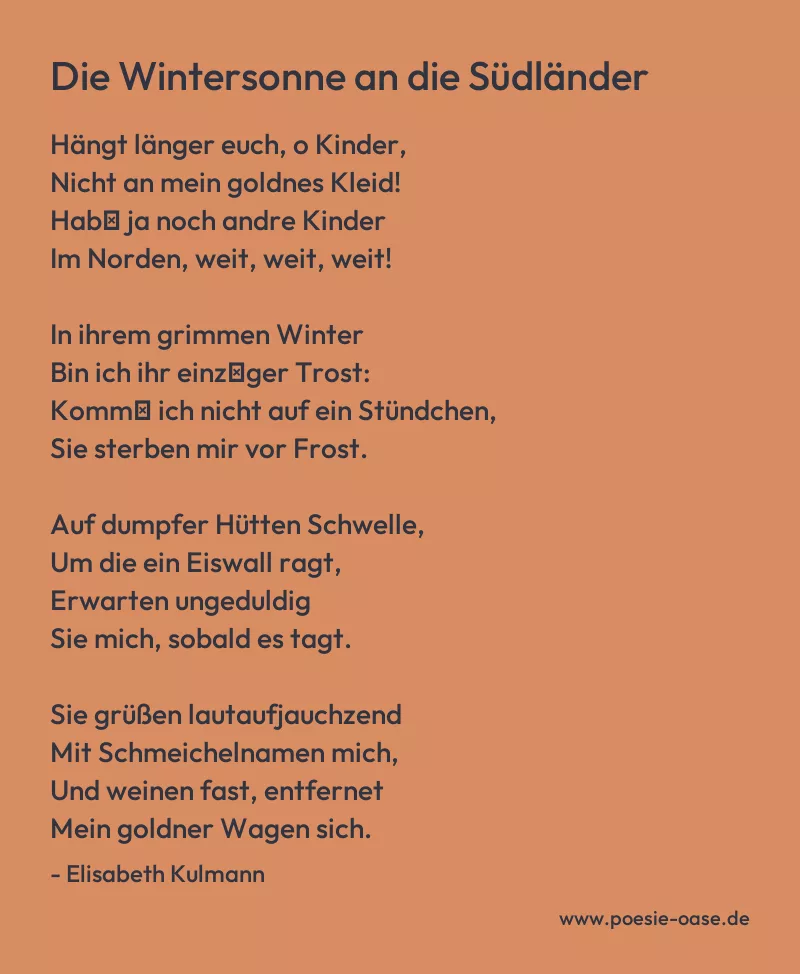Die Wintersonne an die Südländer
Hängt länger euch, o Kinder,
Nicht an mein goldnes Kleid!
Hab′ ja noch andre Kinder
Im Norden, weit, weit, weit!
In ihrem grimmen Winter
Bin ich ihr einz′ger Trost:
Komm′ ich nicht auf ein Stündchen,
Sie sterben mir vor Frost.
Auf dumpfer Hütten Schwelle,
Um die ein Eiswall ragt,
Erwarten ungeduldig
Sie mich, sobald es tagt.
Sie grüßen lautaufjauchzend
Mit Schmeichelnamen mich,
Und weinen fast, entfernet
Mein goldner Wagen sich.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
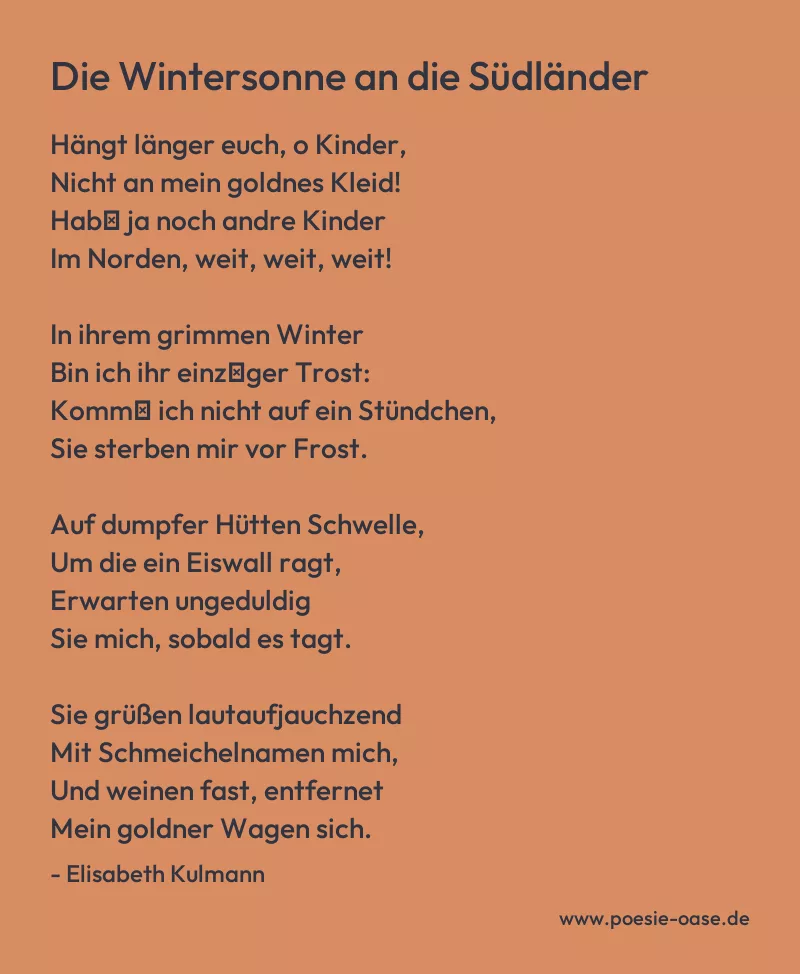
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Wintersonne an die Südländer“ von Elisabeth Kulmann nimmt die Perspektive der Wintersonne ein, die sich an die Bewohner wärmerer, südlicher Gefilde wendet. Die Sonner repräsentiert hier nicht nur ein Naturphänomen, sondern sie personifiziert sich, um ihre Bedeutung und Beziehung zu den Menschen zu beleuchten. Das Gedicht ist ein Appell, eine Aufforderung an die Südländer, sich nicht zu sehr an ihrer Anwesenheit zu erfreuen, da ihre wahre Aufgabe und ihr Wert in den eisigen, kalten Regionen des Nordens liegen.
Die Sonner beschreibt das Verhältnis zwischen sich selbst und den Menschen im Norden als von existenzieller Bedeutung. Sie betont, dass sie dort der „einziger Trost“ im Winter ist, und impliziert, dass ihre Abwesenheit den Tod bedeuten würde („Sie sterben mir vor Frost“). Diese Übertreibung unterstreicht die Härte des Lebens im Norden und die lebensspendende Rolle der Sonne in dieser rauen Umgebung. Die Metapher des „goldnen Kleids“ für das Sonnenlicht verstärkt das Bild von Wert und Kostbarkeit, das die Sonner für ihre nördlichen Anhänger darstellt.
Die Darstellung der Nordländer ist von Wärme und Sehnsucht geprägt. Sie warten „ungeduldig“ auf die Sonne, begrüßen sie „lautaufjauchzend“ und weinen fast, wenn sie wieder verschwindet. Diese emotionalen Reaktionen zeigen die tiefe Abhängigkeit und Verehrung, die die Menschen im Norden der Sonne entgegenbringen. Kulmann verwendet hier einfache, aber wirkungsvolle Sprache, um die Gefühle der Nordländer zu vermitteln und das Kontrastverhältnis zu den „Kindern“ im Süden zu verdeutlichen.
Insgesamt ist das Gedicht eine Reflexion über die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen und die daraus resultierenden sozialen und emotionalen Bindungen, die die Sonne zu den Menschen aufbaut. Es ist auch eine Ermahnung, die Bedeutung von Wärme und Licht in einer Welt zu schätzen, in der Kälte und Dunkelheit allgegenwärtig sind. Die Sonner, als sprechende Instanz, wird hier als eine Figur mit Pflichtbewusstsein und Verantwortung dargestellt, die ihre Aufmerksamkeit auf diejenigen richten muss, die sie am meisten brauchen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.