Der Sonnenwagen nahet
Dem letzten Himmelsabhang,
An dessen Fuße plätschernd
Die Meereswellen tanzen.
Die Sonnenpferde strengen
Sich an, der nahen Kühlung
Sich freuend und der Ruhe.
Schon ist das Tagsgestirne
Dem Meer so nahe, daß es
Bereits sein Bild im Schooße
Der stillen Wellen siehet.
Es kommen stets einander
Die beiden Sonnen näher,
Zwei Königen vergleichbar
Mit ihrem Prachtgefolge,
Die froh, an ihrer Reiche
Gemeinschaftliche Gränze,
Wie Brüder sich einander
Entgegen gehn. Die Säume
Der glühendrothen Räder
Des müden Sonnenwagens
Berühren nun die Wellen,
Die zischend ihn umkreisen.
Seht! eine Silberbrücke
Schwimmt auf dem Meer, und führet
Die Sonne zu dem Schiffe,
Worin, tiefeingeschlummert,
Sie auf des breiten Weltstroms
Entlegenem Gewoge
Zum Morgenthor zurückfährt,
Um Sterblichen und Göttern
Den neuen Tag zu bringen.
Der Sonnenuntergang
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
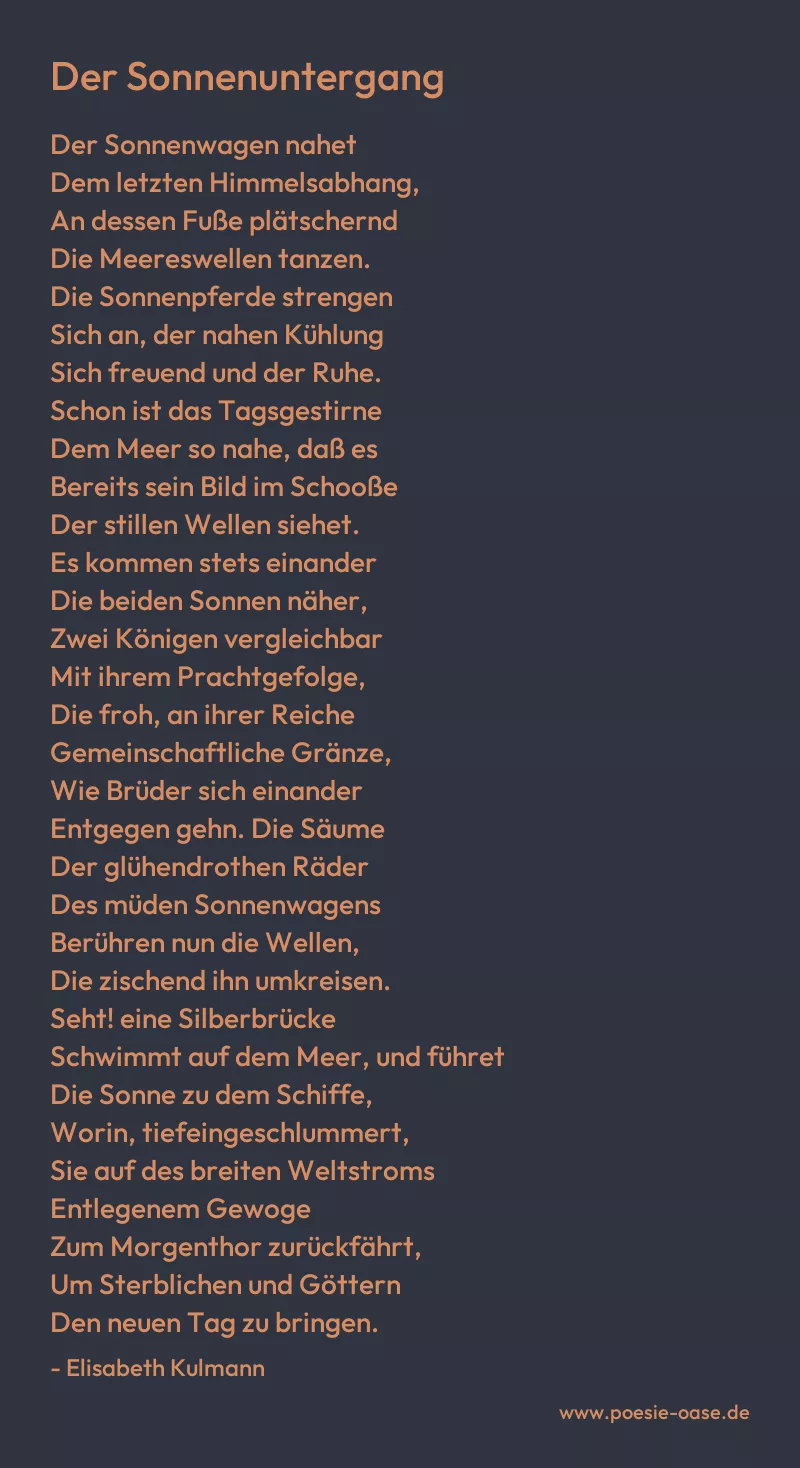
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Sonnenuntergang“ von Elisabeth Kulmann ist eine bildgewaltige Naturbetrachtung, die den Untergang der Sonne in einer romantischen und poetischen Weise darstellt. Kulmann personifiziert die Sonne und verwandelt das Himmelsgeschehen in ein menschliches Drama, wodurch die Natur mit Gefühlen und Handlungen versehen wird. Die Sonne wird als königliche Gestalt dargestellt, die ihren Wagen lenkt und sich am Ende des Tages der Ruhe und dem Schlaf hingibt. Die Verwendung von Begriffen wie „Sonnenwagen“, „Sonnenpferde“ und „Tagsgestirne“ deutet auf eine antike oder mythologische Denkweise hin, die die Naturphänomene durch menschliche Metaphern erklärt.
Das Gedicht ist in einer geschlossenen Form aufgebaut und verwendet einen regelmäßigen Rhythmus und Reim, der die fließende Bewegung des Sonnenuntergangs unterstützt. Die Sprache ist reich an Bildern und Metaphern, die die sinnliche Wahrnehmung des Lesers ansprechen. Beispielsweise werden die Meereswellen als tanzend dargestellt, die Sonnenpferde freuen sich auf die Kühlung, und die Sonne betrachtet ihr Spiegelbild im Meer. Die Verwendung von Adjektiven wie „glühendrot“ und „silbern“ verstärkt die lebendigen Farben und die visuelle Intensität des Gedichts. Die Beschreibung der „Silberbrücke“, die die Sonne zu ihrem Schiff führt, ist ein besonders bemerkenswertes Bild, das die poetische Vorstellungskraft der Autorin widerspiegelt.
Die thematische Hauptlinie des Gedichts ist die Vereinigung der Sonne mit dem Meer, die hier als freundschaftliche Begegnung zweier Könige beschrieben wird. Der Übergang vom Tag zur Nacht wird als ein friedlicher und harmonischer Prozess dargestellt. Das Zusammentreffen von Sonne und Meer, die an ihrer gemeinsamen Grenze wie Brüder aufeinander zugehen, betont das friedliche und natürliche Ende des Tages. Dieser Übergang wird als ein Moment der Ruhe und Erholung dargestellt, der die Sonne auf ihre nächtliche Reise vorbereitet, um am nächsten Morgen den neuen Tag zu bringen.
Die Interpretation des Gedichts kann auch als eine Reflexion über den Kreislauf von Tag und Nacht und die Vergänglichkeit des irdischen Lebens verstanden werden. Die Sonne, die am Abend untergeht, um in den Tiefen des Meeres zu schlafen, symbolisiert den Schlaf und die Erholung. Die Reise der Sonne im Schiff durch das Weltmeer zum Morgenthor und ihr Erscheinen am nächsten Tag repräsentiert die Wiedergeburt und die Hoffnung auf einen neuen Tag. Dieses Gedicht kann somit als eine Ode an die Natur, an die Schönheit des Lebens und an den ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen gelesen werden.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
