Du nimmst als Sterbenden
Den kranken Mann
Siehst als noch Lebenden
Den Todten an.
O rufe nicht zur Wehr,
Mich nicht zum Thun;
Mir ziemt kein Kämpfen mehr,
Mir ziemt nur Ruhn.
Lieg ich im Bette hier
Wie in der Gruft,
Steigt der Gedanke mir
Hoch in die Luft;
Ich überscheu als Schwan
Mit Vogelblick
Des Lebens wirre Bahn
Und mein Geschick.
Nicht war, was ich geschafft,
Allwege gut.
Ach, blad gebrach′s an Kraft
Und bald an Muth.
Hier von Glückes Huld
Ward ich begrüßt;
Dort hab ich eigne Schuld
Wie schwer gebüßt.
Das, halb im Traume geht
An mir vorbei,
Mein Leben ist verweht,
Und ich bin frei.
Was blieb dir, Seele, nun,
Als daß mit Ernst
Du in dir selber ruhn?
Du sterben lernst?
An Rapp
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
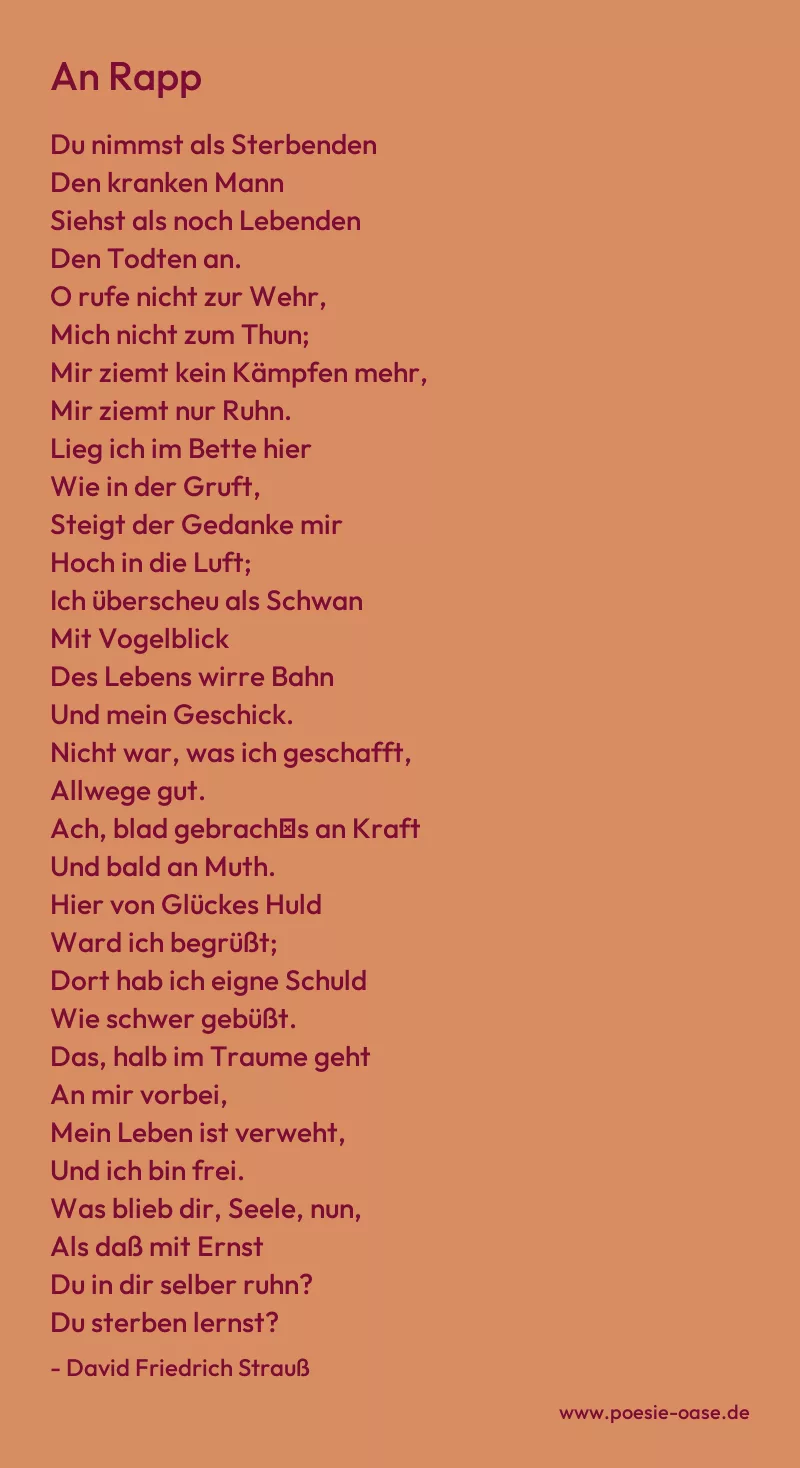
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An Rapp“ von David Friedrich Strauß ist eine tiefgründige Reflexion über das Sterben und die Bilanz eines Lebens, geschrieben aus der Perspektive eines Kranken. Der Autor nähert sich dem Thema mit einer bemerkenswerten Ruhe und Akzeptanz, was sich in der gewählten Sprache und der Struktur des Gedichts widerspiegelt. Der Sprecher scheint sich bereits im Übergang vom Leben zum Tod zu befinden, was durch die eingangs erwähnte Wahrnehmung deutlich wird, dass er den Sterbenden als sich selbst und den Toten als lebendig betrachtet.
Das Gedicht ist inhaltlich in mehrere Phasen unterteilt, die sich durch die thematische Entwicklung und die Intensität der Emotionen auszeichnen. Im ersten Abschnitt, Verse 1-8, äußert der Sprecher seinen Wunsch nach Ruhe und distanziert sich von der Welt des Handelns. Er sieht sich nicht mehr in der Lage zu kämpfen und wünscht sich lediglich Frieden. Dies deutet auf eine tiefe Erschöpfung hin, möglicherweise sowohl physischer als auch psychischer Natur. Die Metapher des „Bettes hier wie in der Gruft“ verstärkt das Gefühl der Isolation und des Übergangs.
Der zweite Abschnitt, Verse 9-16, markiert einen Übergang in die Reflexion. Der Sprecher, nun in Gedanken erhoben, betrachtet sein Leben wie aus der Vogelperspektive. Die Metapher des Schwans, der über die „wirre Bahn des Lebens“ blickt, evoziert ein Gefühl von Distanz und Überlegenheit, aber auch von Melancholie. Der Rückblick auf das eigene Schaffen wird kritisch betrachtet, mit dem Eingeständnis von Fehlern und dem Mangel an Kraft und Mut. Dies deutet auf eine Selbstreflexion und die Akzeptanz von Unvollkommenheit hin.
Im letzten Abschnitt, Verse 17-24, scheint das Leben des Sprechers wie ein Traum an ihm vorbeizuziehen. Die Erfahrungen von Glück und Unglück werden gleichermaßen betrachtet, wobei die „eigne Schuld“ als Ursache für das Unglück genannt wird. Das Gefühl der Freiheit, das am Ende artikuliert wird, resultiert aus der Erkenntnis, dass das Leben „verweht“ ist. Die abschließende Frage an die Seele unterstreicht die Suche nach innerem Frieden und die Vorbereitung auf das Sterben. Es geht um das Erlernen von Ruhe in sich selbst und das Lernen des Sterbens.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
