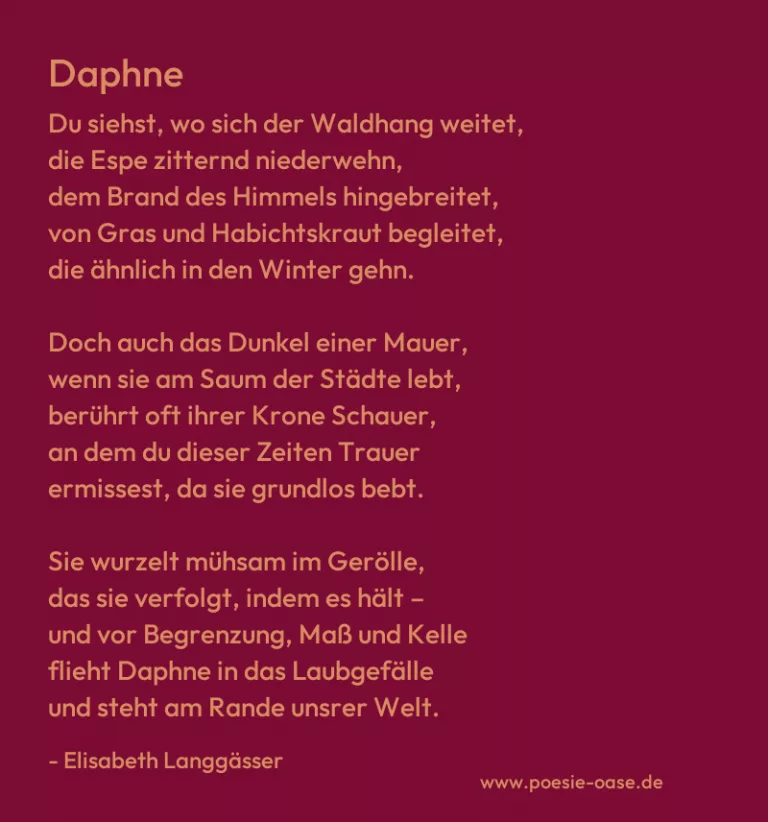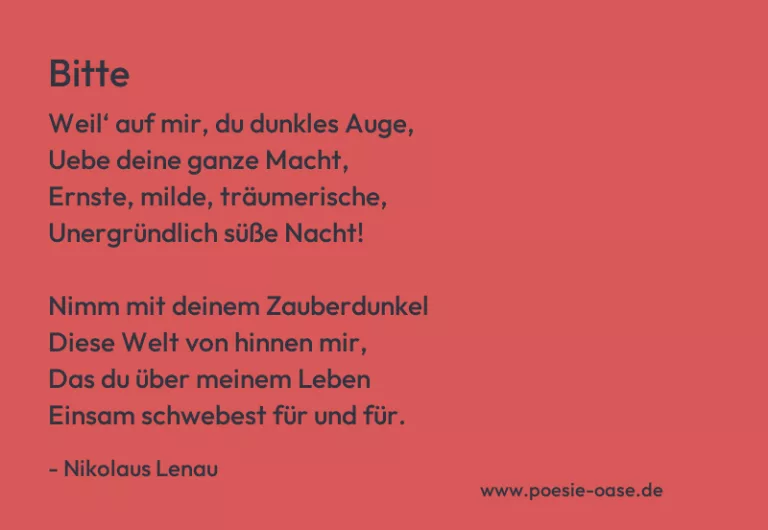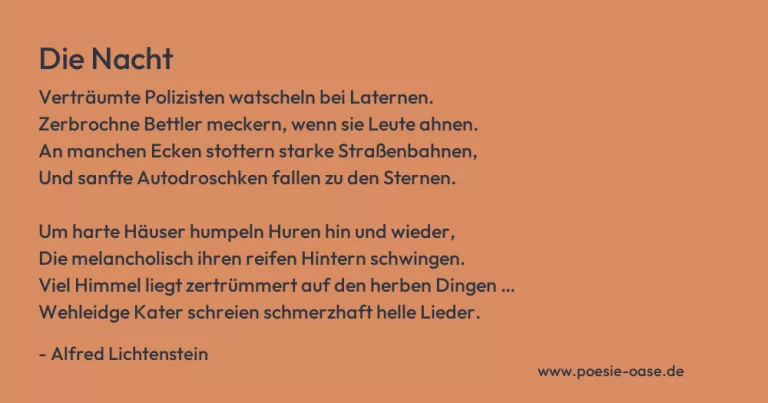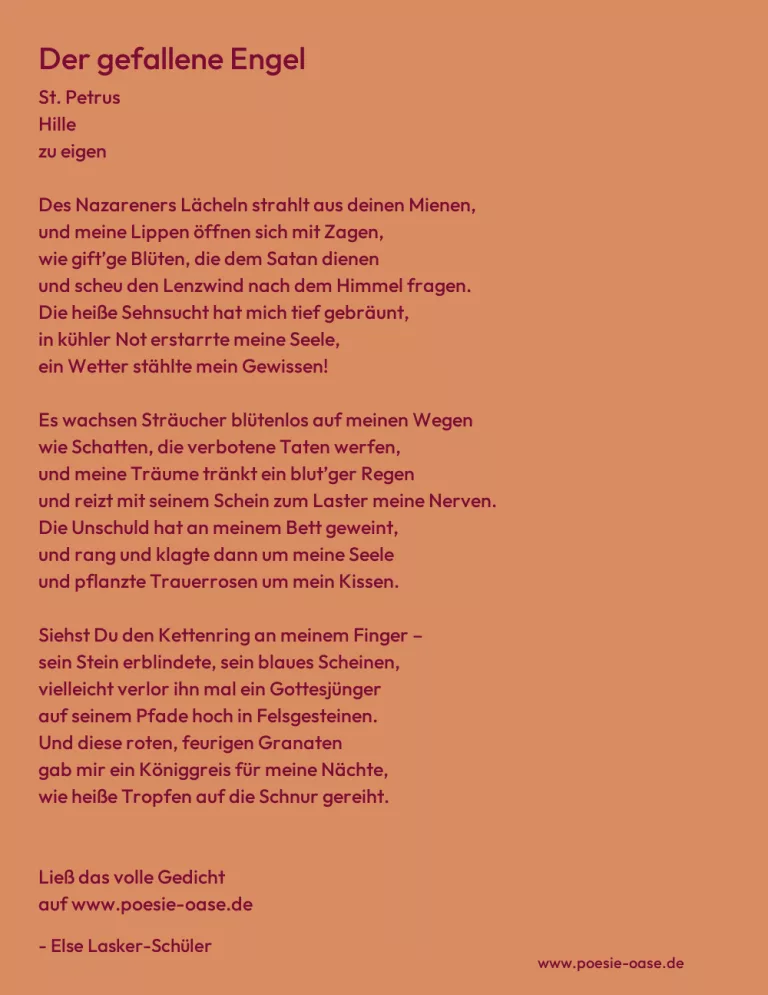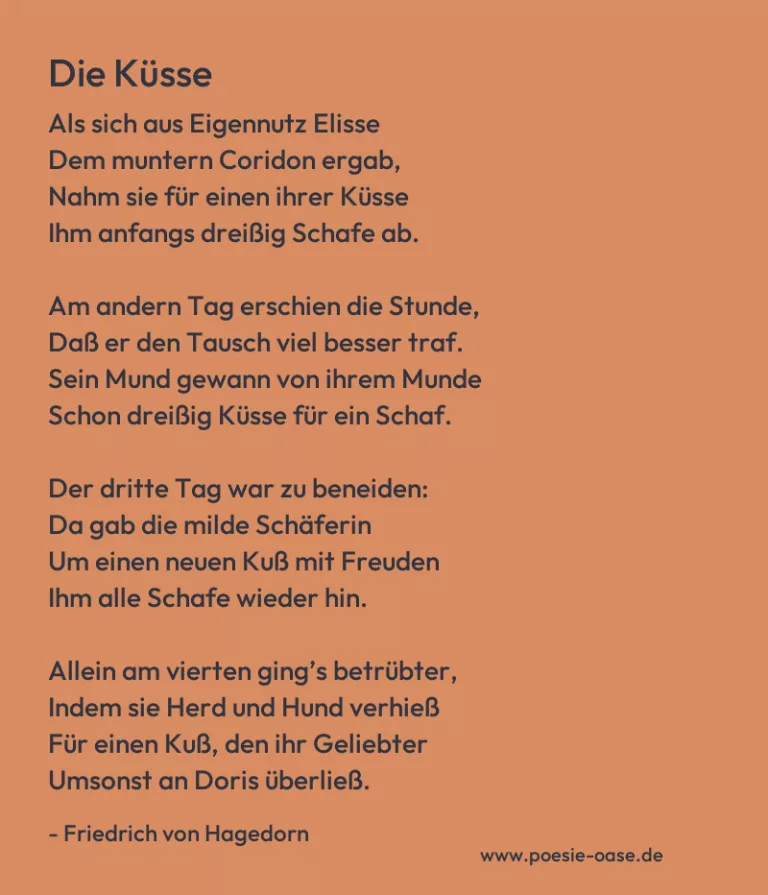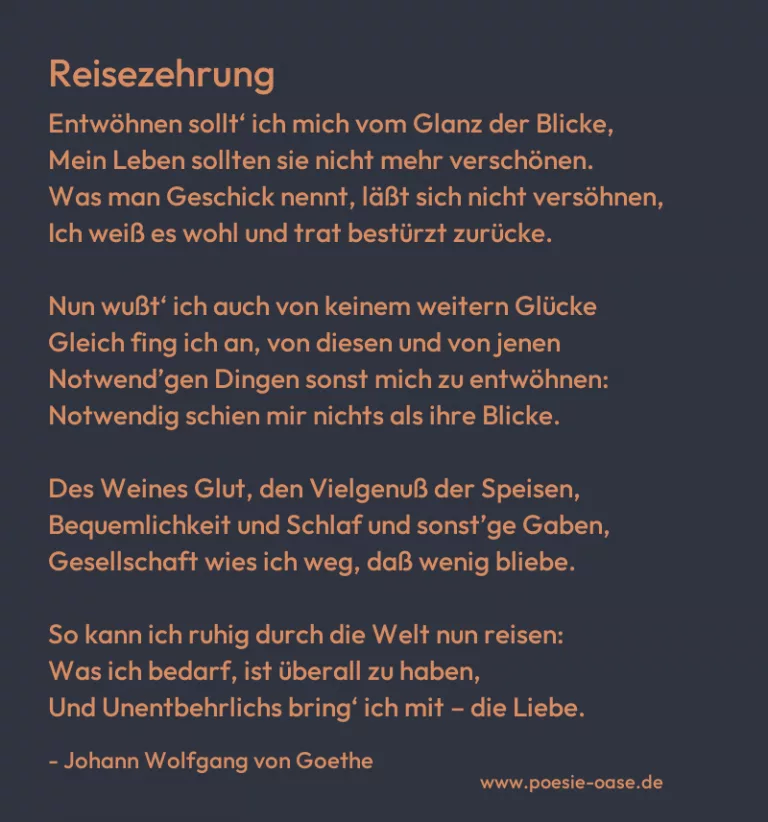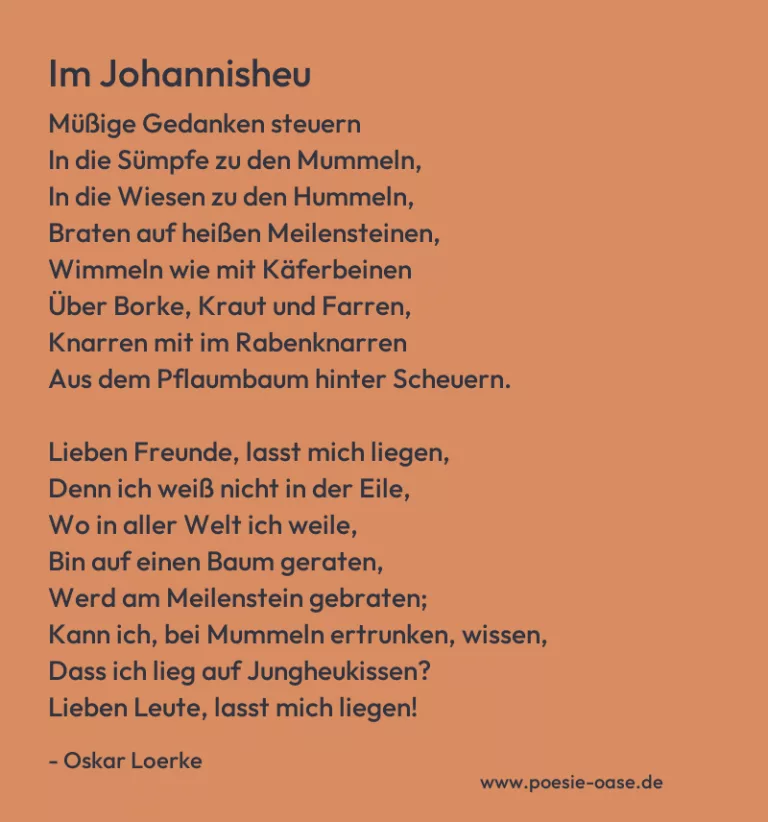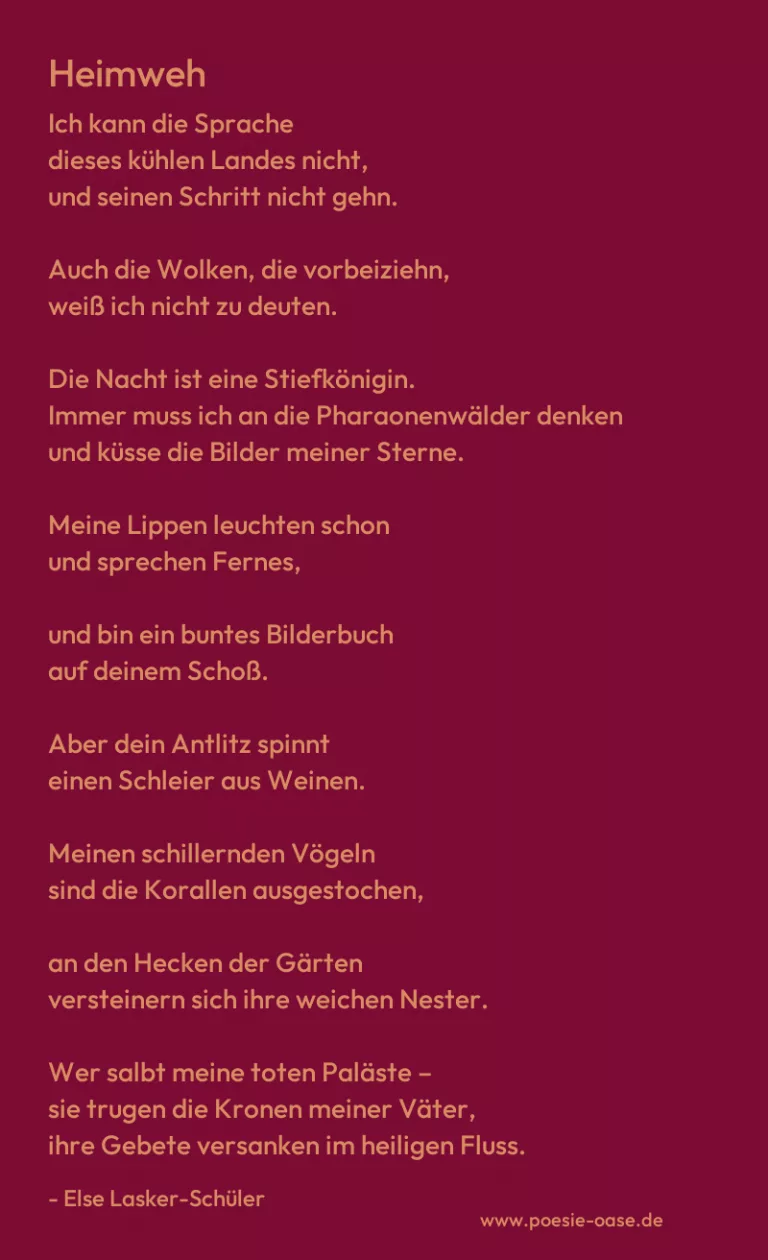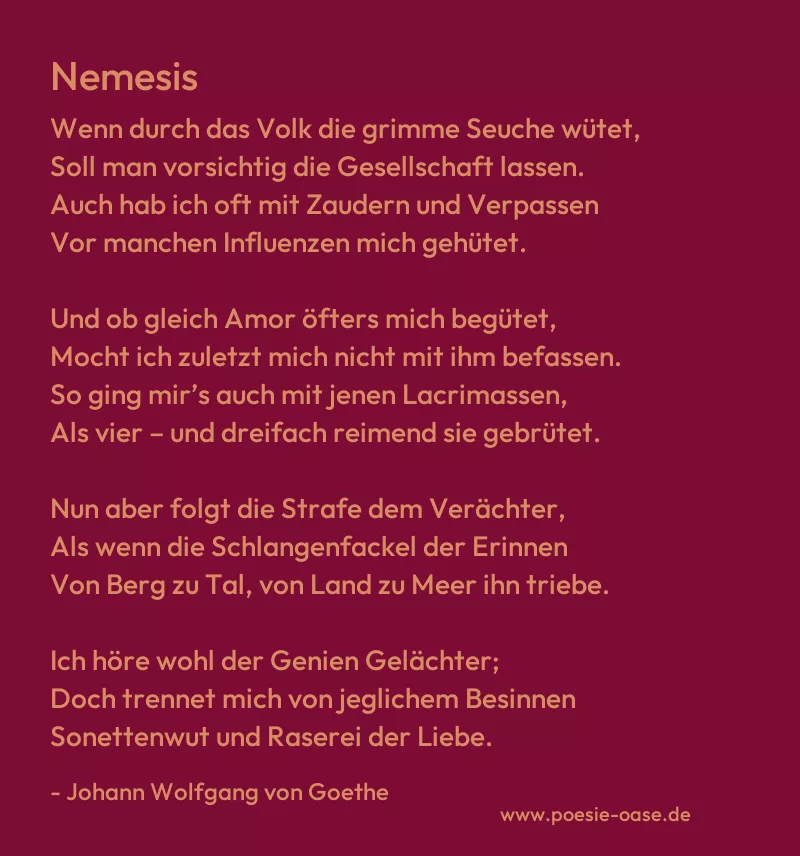Nemesis
Wenn durch das Volk die grimme Seuche wütet,
Soll man vorsichtig die Gesellschaft lassen.
Auch hab ich oft mit Zaudern und Verpassen
Vor manchen Influenzen mich gehütet.
Und ob gleich Amor öfters mich begütet,
Mocht ich zuletzt mich nicht mit ihm befassen.
So ging mir’s auch mit jenen Lacrimassen,
Als vier – und dreifach reimend sie gebrütet.
Nun aber folgt die Strafe dem Verächter,
Als wenn die Schlangenfackel der Erinnen
Von Berg zu Tal, von Land zu Meer ihn triebe.
Ich höre wohl der Genien Gelächter;
Doch trennet mich von jeglichem Besinnen
Sonettenwut und Raserei der Liebe.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
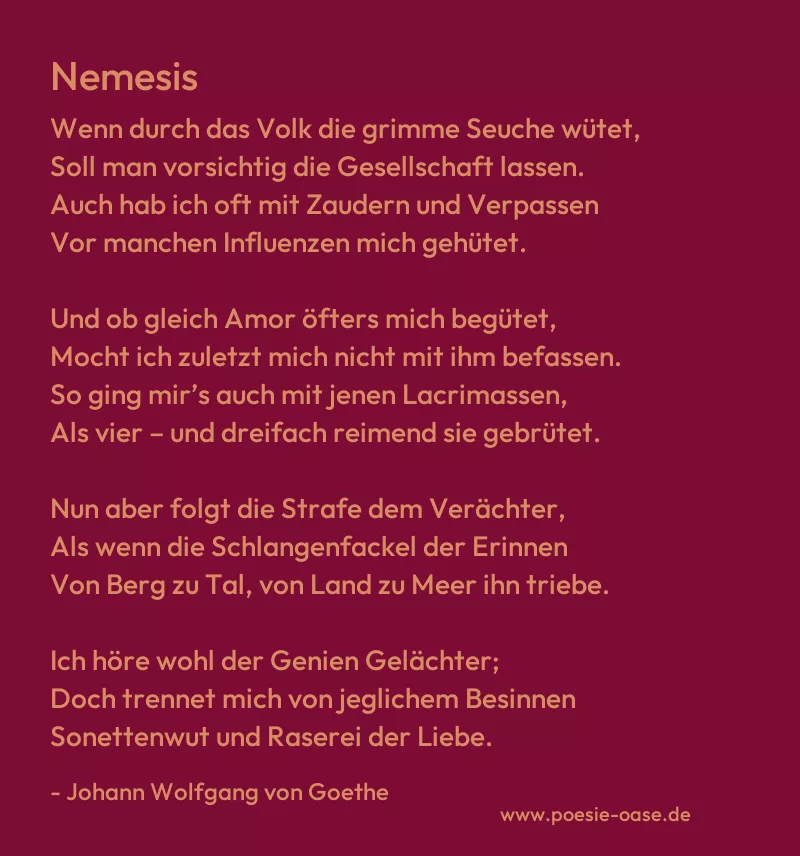
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Nemesis“ von Johann Wolfgang von Goethe thematisiert in ironisch-distanziertem Ton die Unausweichlichkeit des Schicksals und die Macht unkontrollierbarer Leidenschaften. Der Titel verweist auf die griechische Göttin der göttlichen Vergeltung, die diejenigen bestraft, die sich über Gebühr erheben oder ihrem Schicksal zu entkommen versuchen.
In den ersten Zeilen beschreibt das lyrische Ich seine Bemühungen, sich vor schädlichen Einflüssen zu schützen – sei es vor Krankheiten, vor Amors Liebespfeilen oder vor einer literarischen Mode, den „Lacrimassen“, also sentimental-romantischer Dichtung. Doch so sehr es sich auch bemüht, gewissen Einflüssen aus dem Weg zu gehen, entkommt es letztlich doch nicht der Strafe für seine Verweigerung.
Die letzte Strophe zeigt, dass das lyrische Ich nun selbst von einer leidenschaftlichen „Sonettenwut“ und der „Raserei der Liebe“ ergriffen wird – eine Art literarischer und emotionaler Wahnsinn, der ihn völlig überwältigt. Der Versuch, sich durch Zurückhaltung und Vorsicht der Macht von Emotionen und Dichtung zu entziehen, ist gescheitert. Die Strafe der „Nemesis“ manifestiert sich nicht in äußerem Unheil, sondern in der inneren Unruhe und der Unfähigkeit, sich der übermächtigen Kraft der Gefühle und der Kunst zu entziehen. Damit reflektiert Goethe auf humorvolle Weise die Spannung zwischen Vernunft und Leidenschaft, Zurückhaltung und Hingabe.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.