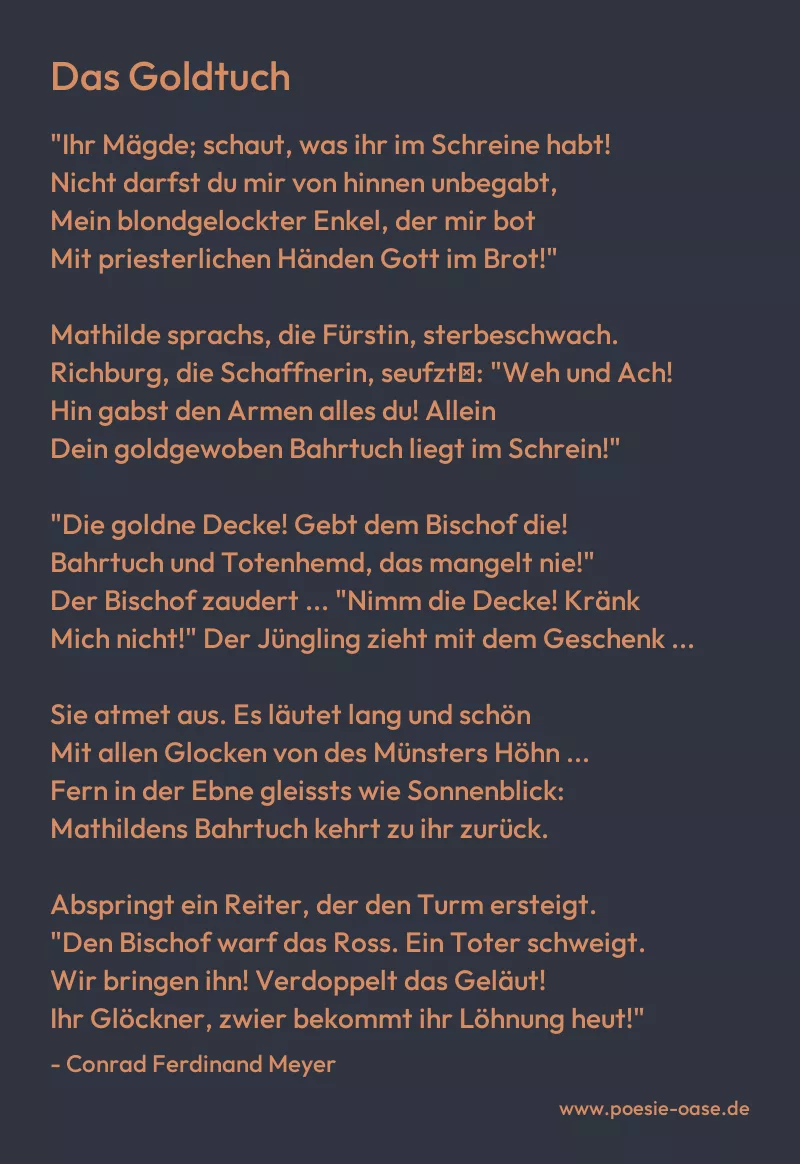Das Goldtuch
„Ihr Mägde; schaut, was ihr im Schreine habt!
Nicht darfst du mir von hinnen unbegabt,
Mein blondgelockter Enkel, der mir bot
Mit priesterlichen Händen Gott im Brot!“
Mathilde sprachs, die Fürstin, sterbeschwach.
Richburg, die Schaffnerin, seufzt′: „Weh und Ach!
Hin gabst den Armen alles du! Allein
Dein goldgewoben Bahrtuch liegt im Schrein!“
„Die goldne Decke! Gebt dem Bischof die!
Bahrtuch und Totenhemd, das mangelt nie!“
Der Bischof zaudert … „Nimm die Decke! Kränk
Mich nicht!“ Der Jüngling zieht mit dem Geschenk …
Sie atmet aus. Es läutet lang und schön
Mit allen Glocken von des Münsters Höhn …
Fern in der Ebne gleissts wie Sonnenblick:
Mathildens Bahrtuch kehrt zu ihr zurück.
Abspringt ein Reiter, der den Turm ersteigt.
„Den Bischof warf das Ross. Ein Toter schweigt.
Wir bringen ihn! Verdoppelt das Geläut!
Ihr Glöckner, zwier bekommt ihr Löhnung heut!“
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
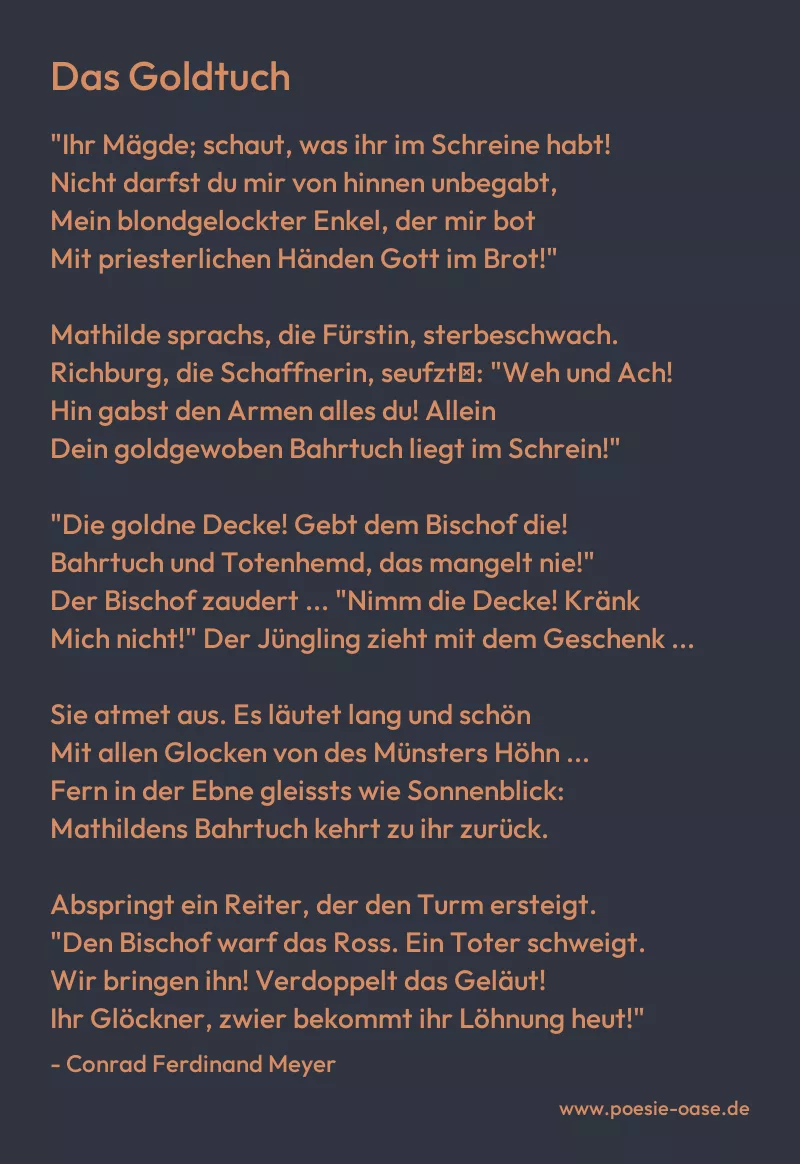
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Das Goldtuch“ von Conrad Ferdinand Meyer zeichnet ein komplexes Bild von Tod, Glauben, Macht und irdischem Besitz. Es entfaltet sich als eine kurze, aber dichte Erzählung in Versform, die von der Sterbeszene der Fürstin Mathilde ausgeht und die Frage nach dem Umgang mit ihrem Nachlass thematisiert. Die Strophen sind präzise und dialogorientiert, wodurch eine unmittelbare Dramatik entsteht.
Im Zentrum des Gedichts steht die Auseinandersetzung um das goldgewebte Bahrtuch. Mathilde, im Angesicht des Todes, möchte sicherstellen, dass ihre Habseligkeiten sinnvoll verwendet werden. Sie fordert ihre Mägde auf, zu prüfen, was sie im Schrein haben. Das Gespräch zwischen Mathilde und Richburg, ihrer Schaffnerin, enthüllt Mathildes großzügige Spenden an die Armen. Als einzig verbliebener Reichtum wird das Goldtuch genannt, das Mathilde dem Bischof zukommen lassen will. Diese Geste deutet auf ihre Frömmigkeit und ihren Wunsch hin, auch im Tod noch etwas Gutes zu bewirken.
Die Reaktion des Bischofs offenbart jedoch die Komplexität der Situation. Der Bischof zögert, das wertvolle Goldtuch anzunehmen. Dies könnte auf seine eigene Machtstellung und seinen Reichtum hindeuten, oder aber auf die Erkenntnis, dass das Tuch symbolisch für Mathildes irdischen Besitz steht. Die Zeilen „Bahrtuch und Totenhemd, das mangelt nie!“ zeigen, dass der Bischof die moralische Verpflichtung verspürt, das Goldtuch anzunehmen, um Mathildes Wunsch zu erfüllen. Der plötzliche Tod des Bischofs durch einen Reitunfall, der direkt im Anschluss an seine Zusage beschrieben wird, führt jedoch zu einer unerwarteten Wendung.
Die abschließende Szene, in der das Goldtuch zu Mathilde zurückkehrt, ist von symbolischer Bedeutung. Die Nachricht vom Tod des Bischofs und das Geläut der Glocken vermitteln eine Atmosphäre von Dramatik und Erleichterung. Die Aussage, dass die Glöckner an diesem Tag doppelt bezahlt werden, unterstreicht die ironische Pointe, dass der Tod des Bischofs die Erfüllung von Mathildes letztem Willen ermöglicht hat. Das Gedicht wirft Fragen nach der Beziehung von Reichtum, Glauben und dem Jenseits auf, wobei der Wert des Goldtuchs schließlich in der Erfüllung der letzten Wünsche und der Unsterblichkeit des Geistes liegt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.