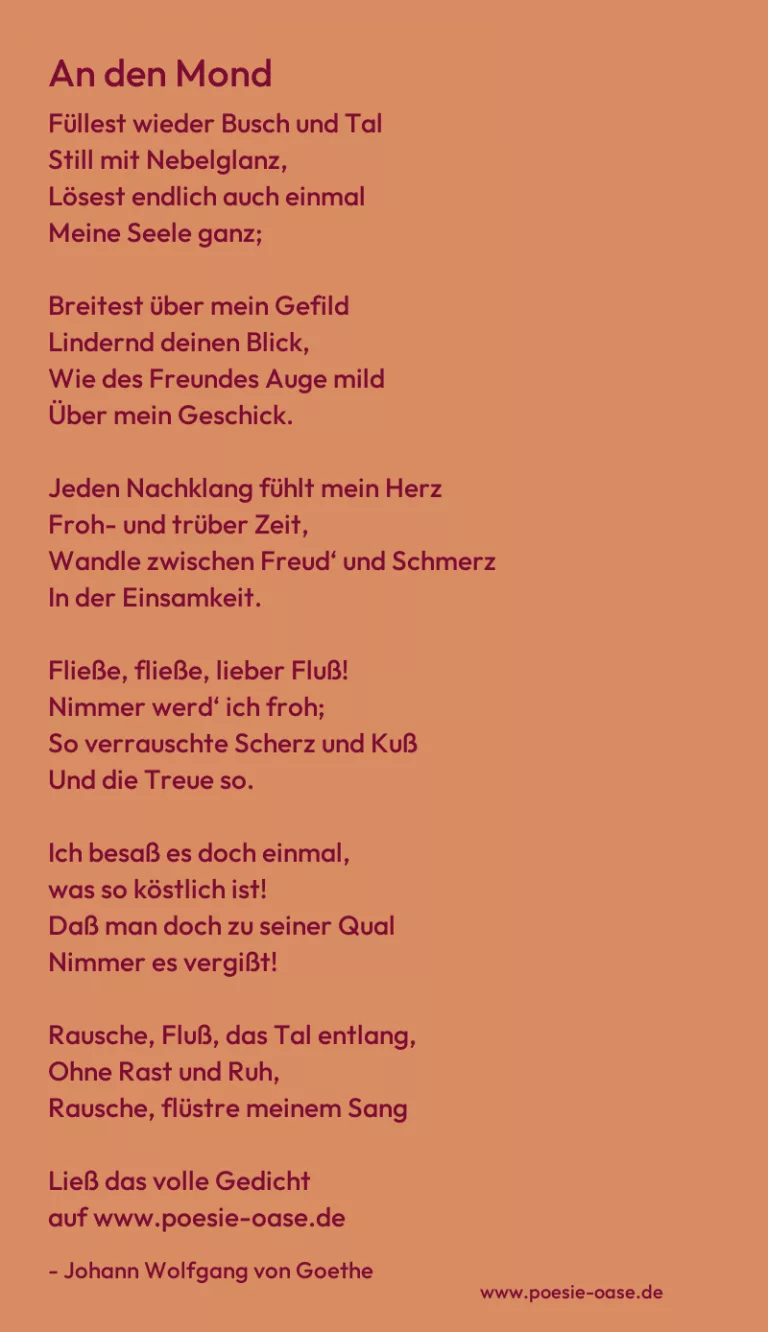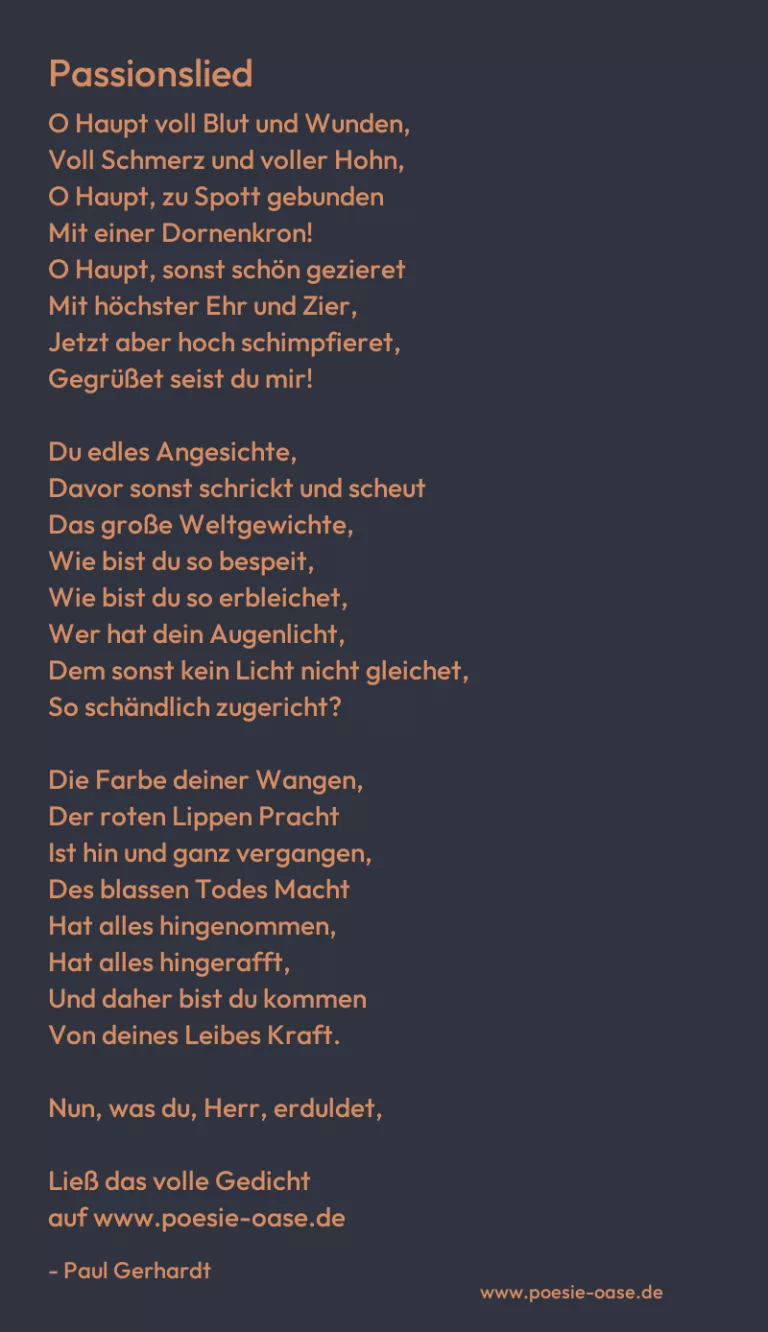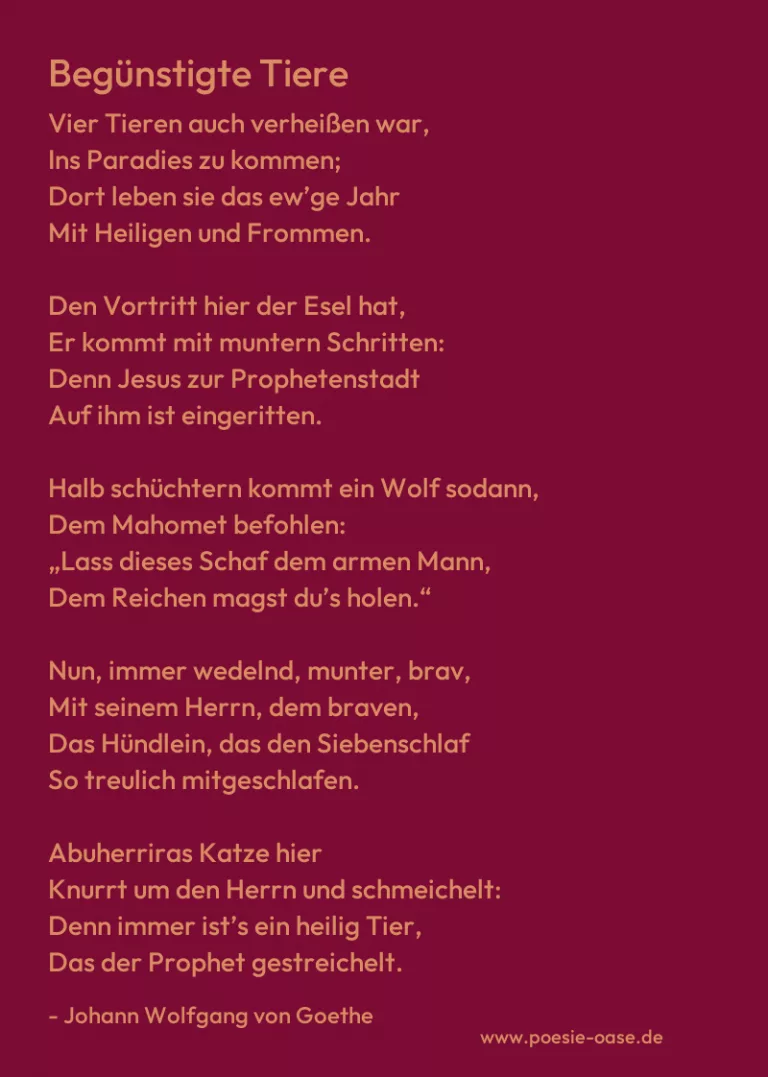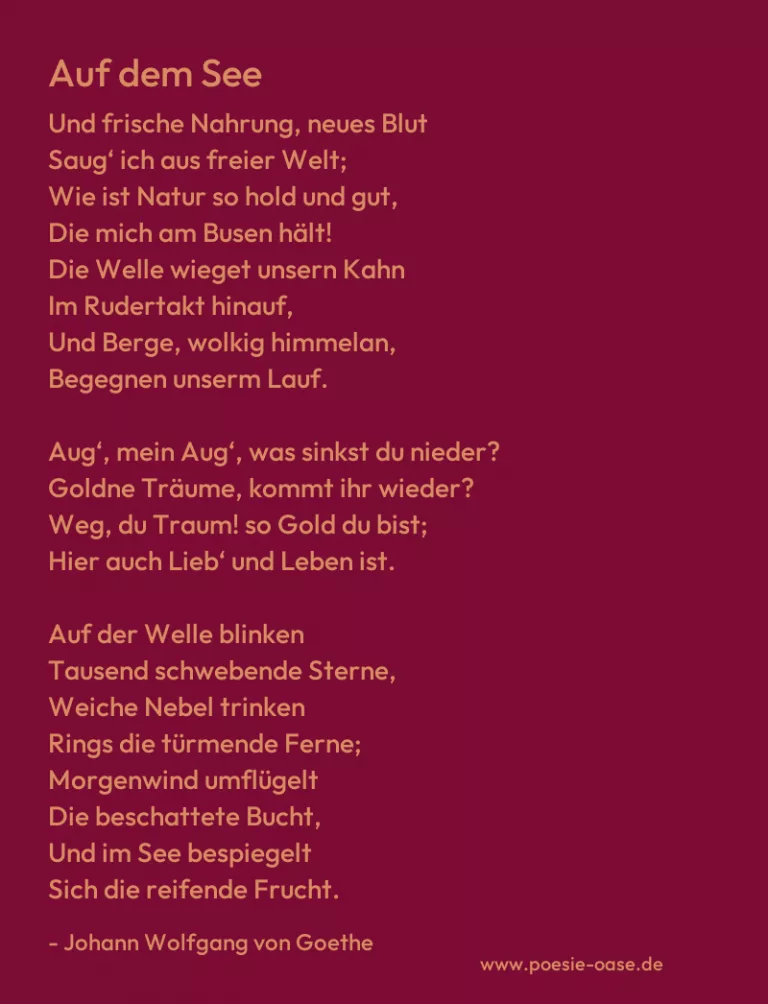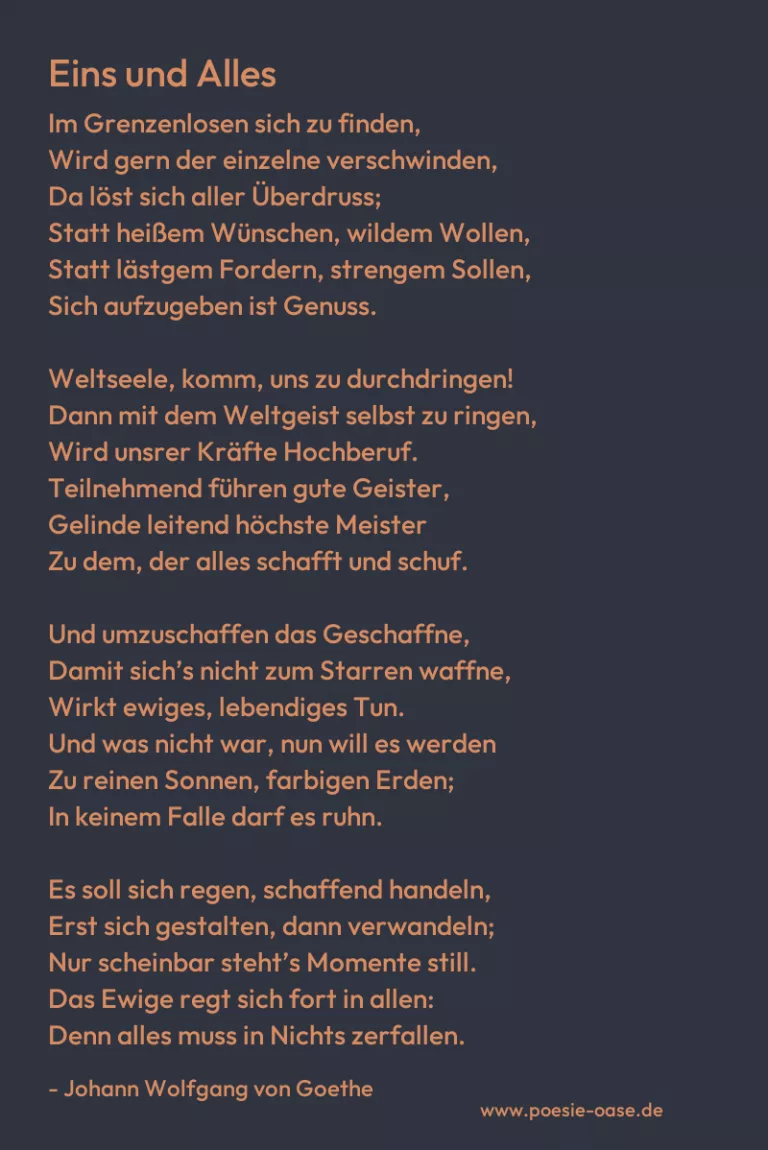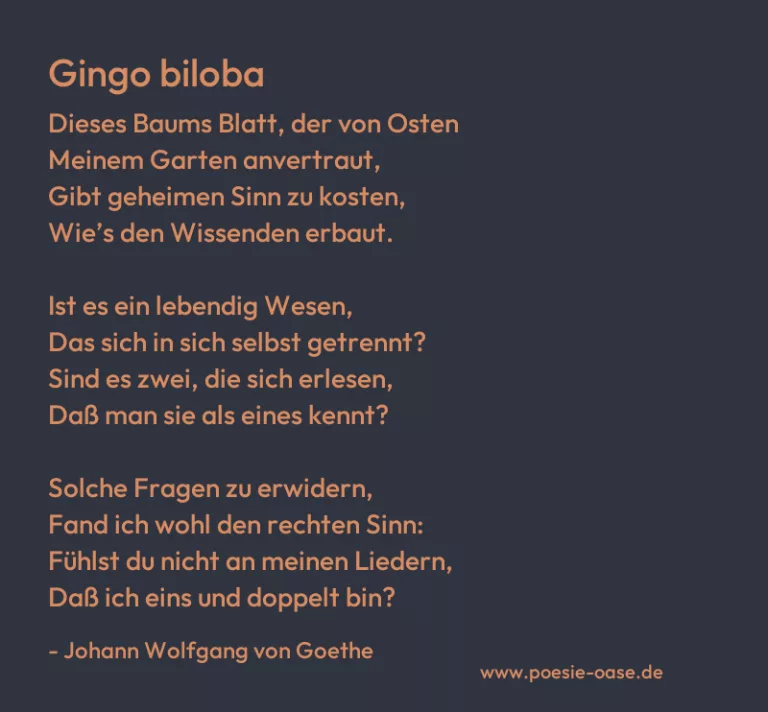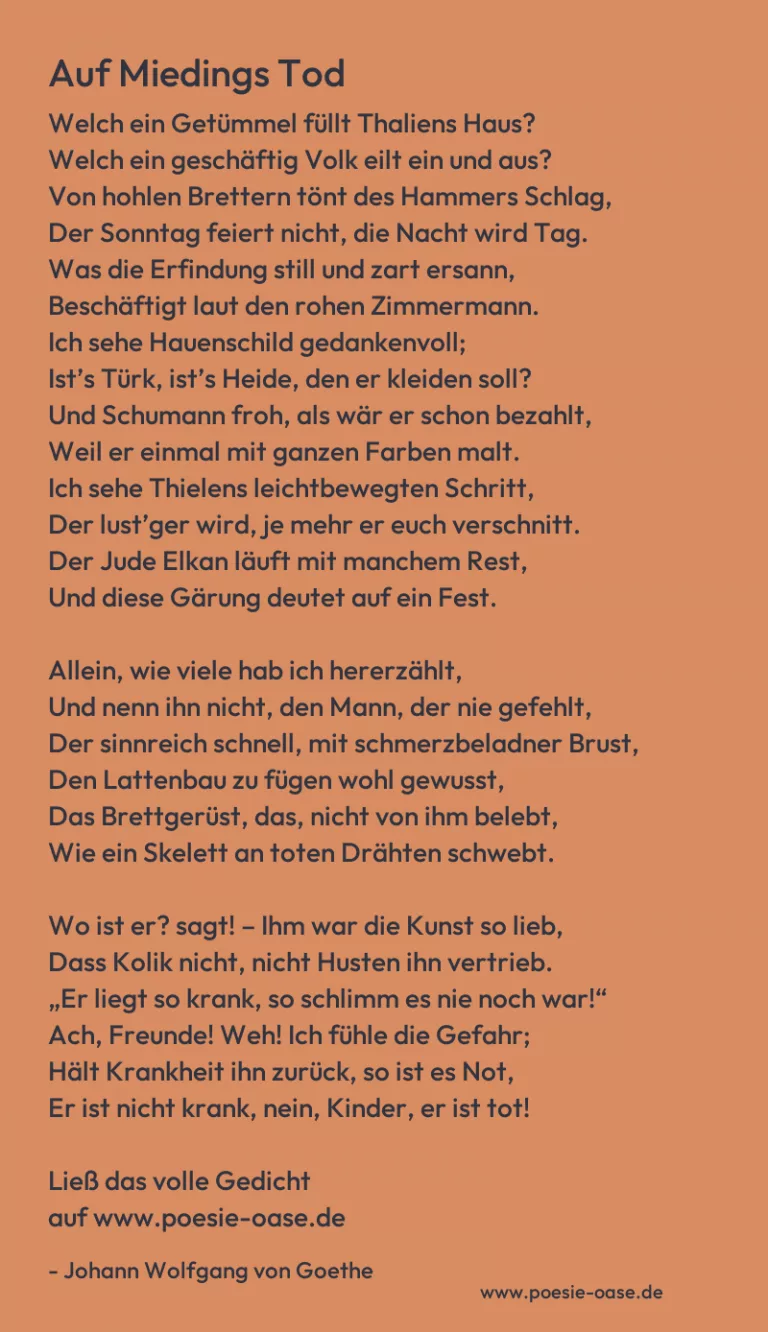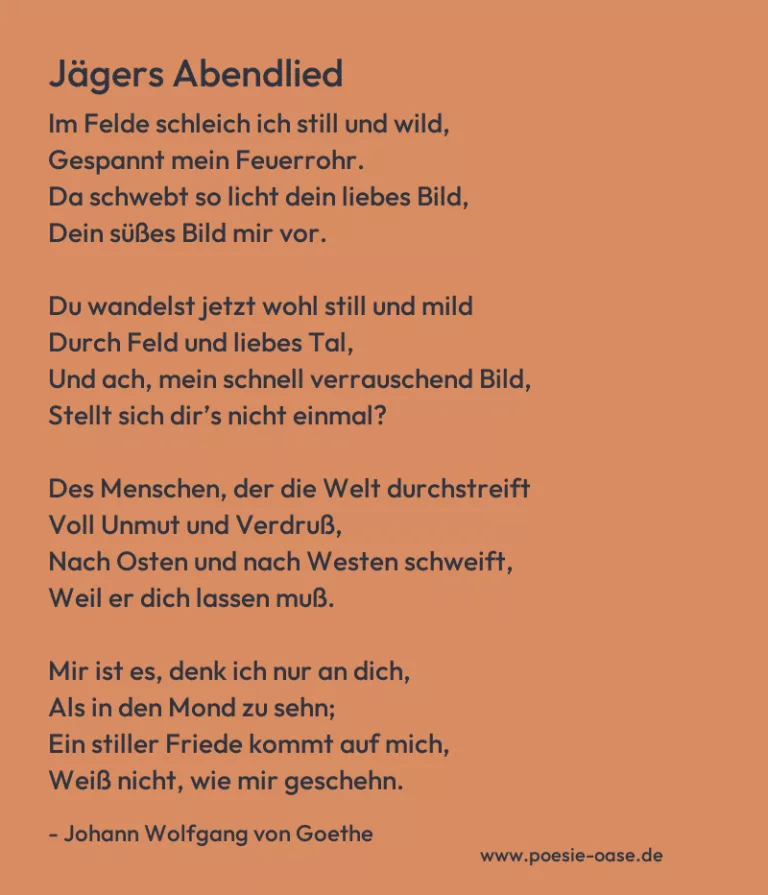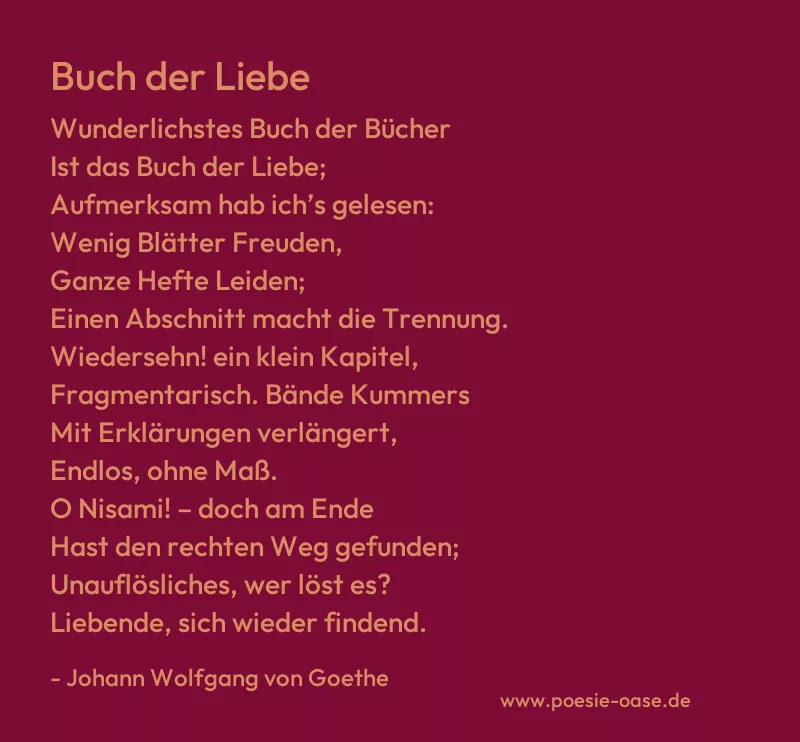Buch der Liebe
Wunderlichstes Buch der Bücher
Ist das Buch der Liebe;
Aufmerksam hab ich’s gelesen:
Wenig Blätter Freuden,
Ganze Hefte Leiden;
Einen Abschnitt macht die Trennung.
Wiedersehn! ein klein Kapitel,
Fragmentarisch. Bände Kummers
Mit Erklärungen verlängert,
Endlos, ohne Maß.
O Nisami! – doch am Ende
Hast den rechten Weg gefunden;
Unauflösliches, wer löst es?
Liebende, sich wieder findend.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
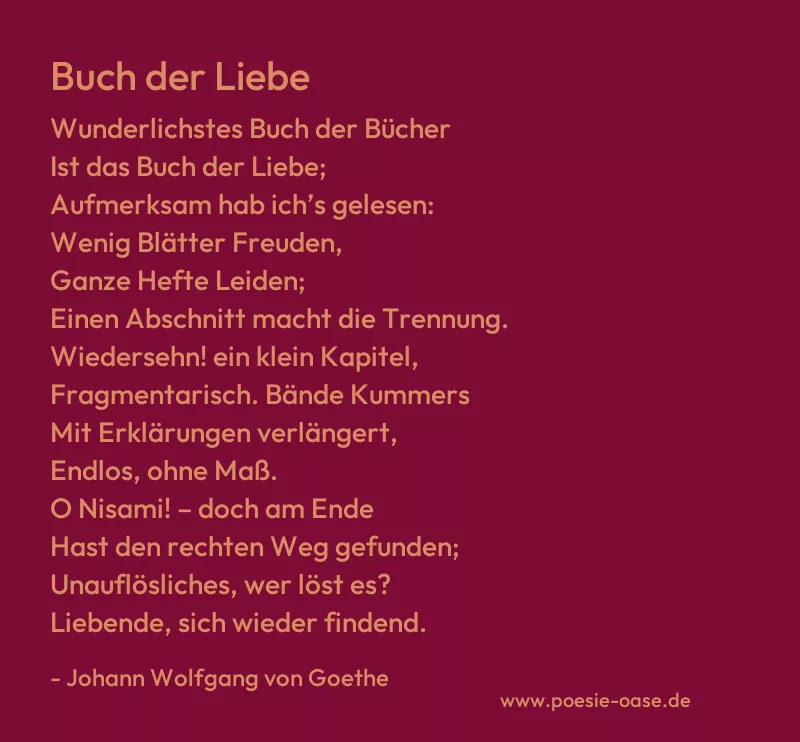
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Buch der Liebe“ von Johann Wolfgang von Goethe setzt sich auf metaphorische Weise mit der Natur der Liebe auseinander. Das lyrische Ich vergleicht die Liebe mit einem Buch, das es aufmerksam gelesen hat. Dabei stellt es fest, dass die Seiten der Freude nur spärlich vorhanden sind, während das Leiden ganze Hefte füllt. Dieses Bild betont die oft schmerzhafte und leidvolle Erfahrung der Liebe, die in Trennung und Kummer gipfeln kann.
Besonders eindrucksvoll ist die Struktur des „Buchs der Liebe“: Die Trennung bildet einen eigenen Abschnitt, während das Wiedersehen nur ein kleines, unvollständiges Kapitel ist. Dagegen scheinen die „Bände Kummers“ kein Ende zu nehmen – eine Darstellung der oft unausgewogenen Erfahrung von Glück und Schmerz in der Liebe. Die Anspielung auf den persischen Dichter Nisami verweist auf dessen Werke, die oft von der Trennung und Wiedervereinigung Liebender handeln.
Am Ende jedoch bietet das Gedicht einen versöhnlichen Ausblick. Die scheinbar unlösbare Frage der Liebe – „Unauflösliches, wer löst es?“ – findet ihre Antwort in der Wiedervereinigung der Liebenden. Trotz aller Leiden und Trennungen scheint Goethe an die Möglichkeit eines glücklichen Endes zu glauben, wenn auch vielleicht nur in einer idealisierten oder poetischen Vorstellung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.