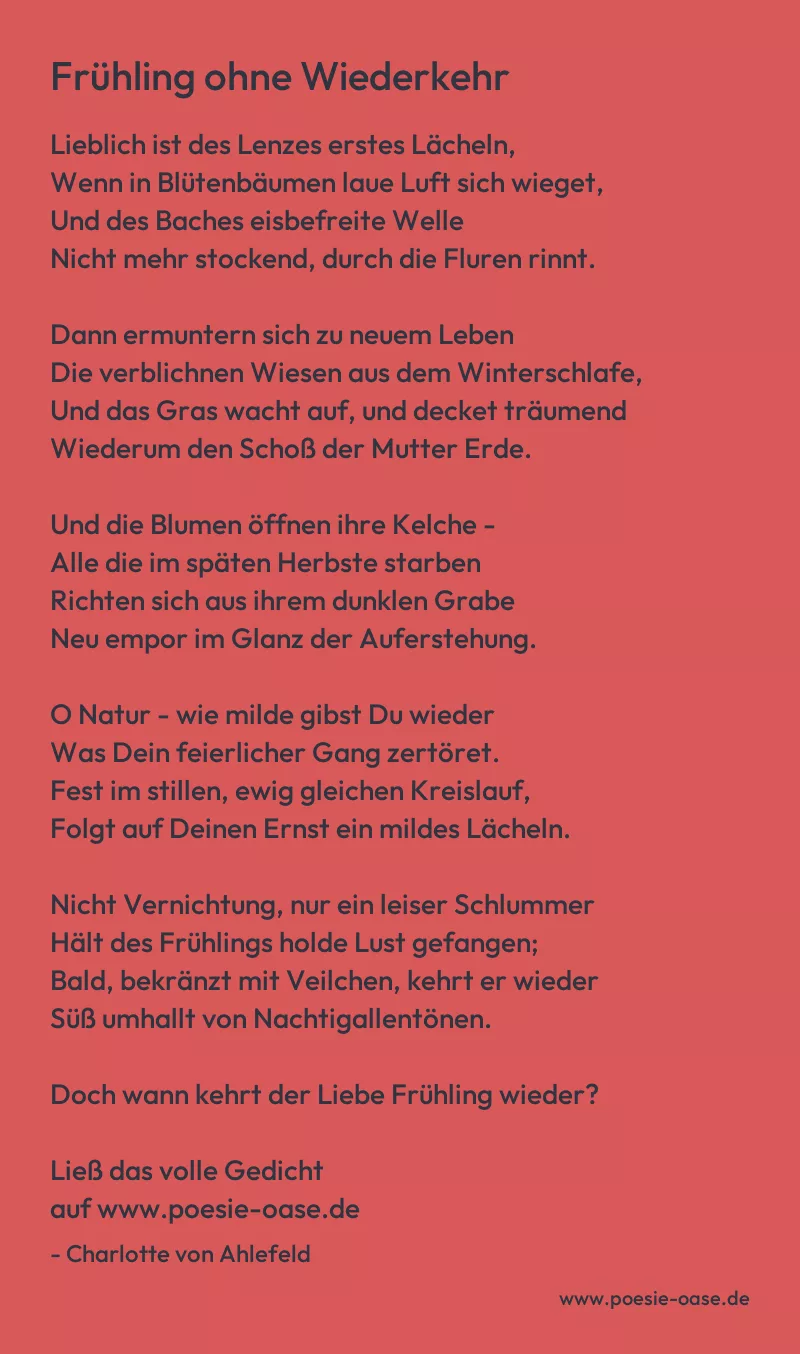Lieblich ist des Lenzes erstes Lächeln,
Wenn in Blütenbäumen laue Luft sich wieget,
Und des Baches eisbefreite Welle
Nicht mehr stockend, durch die Fluren rinnt.
Dann ermuntern sich zu neuem Leben
Die verblichnen Wiesen aus dem Winterschlafe,
Und das Gras wacht auf, und decket träumend
Wiederum den Schoß der Mutter Erde.
Und die Blumen öffnen ihre Kelche –
Alle die im späten Herbste starben
Richten sich aus ihrem dunklen Grabe
Neu empor im Glanz der Auferstehung.
O Natur – wie milde gibst Du wieder
Was Dein feierlicher Gang zertöret.
Fest im stillen, ewig gleichen Kreislauf,
Folgt auf Deinen Ernst ein mildes Lächeln.
Nicht Vernichtung, nur ein leiser Schlummer
Hält des Frühlings holde Lust gefangen;
Bald, bekränzt mit Veilchen, kehrt er wieder
Süß umhallt von Nachtigallentönen.
Doch wann kehrt der Liebe Frühling wieder?
Ach, verscheucht hat ihn die Nacht der Trennung
Und der Winterschauer einer ew′gen Ferne
Tötet rauh das zarte Grün der Hoffnung.
Des Beisammenlebens Stundenblumen
Starben hin im Seufzerhauch des Abschieds.
Kummervoll benetzt von heissen Tränen,
Sind der Freude Rosen längst verblichen.
Keine Sonne wird sie neu erwecken –
Keines Wiedersehens goldner Schimmer
Winkt des Glückes lichterfüllte Tage
Aus dem Grabe der Vergangenheit hervor.
Traurig zieht der Jahreszeiten Wechsel
Meinem still umwölkten Blick vorüber.
Ach es folgt der Frühling auf den Winter,
Aber nimmer kehrt der Liebe Frühling wieder!