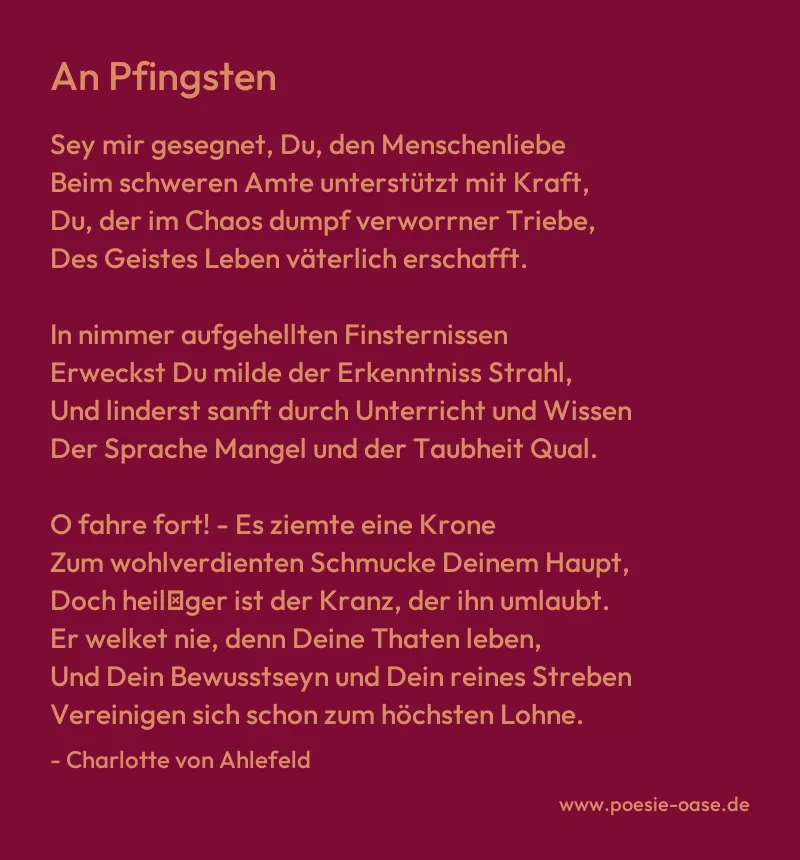An Pfingsten
Sey mir gesegnet, Du, den Menschenliebe
Beim schweren Amte unterstützt mit Kraft,
Du, der im Chaos dumpf verworrner Triebe,
Des Geistes Leben väterlich erschafft.
In nimmer aufgehellten Finsternissen
Erweckst Du milde der Erkenntniss Strahl,
Und linderst sanft durch Unterricht und Wissen
Der Sprache Mangel und der Taubheit Qual.
O fahre fort! – Es ziemte eine Krone
Zum wohlverdienten Schmucke Deinem Haupt,
Doch heil′ger ist der Kranz, der ihn umlaubt.
Er welket nie, denn Deine Thaten leben,
Und Dein Bewusstseyn und Dein reines Streben
Vereinigen sich schon zum höchsten Lohne.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
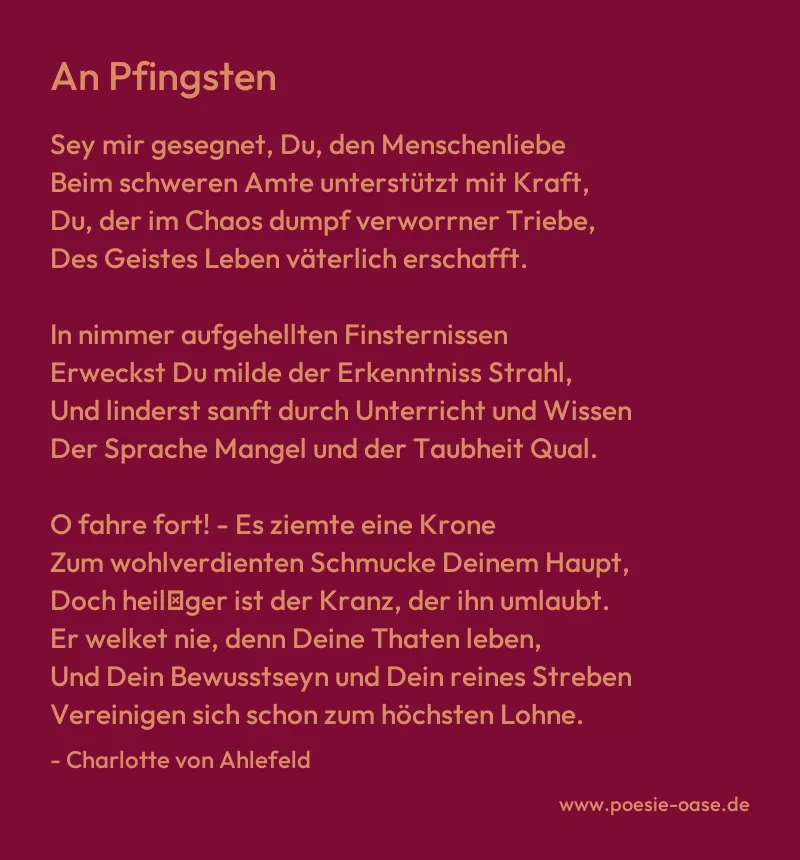
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An Pfingsten“ von Charlotte von Ahlefeld ist eine Hymne, die die zentrale Rolle des Heiligen Geistes in der christlichen Lehre feiert. Es ist ein Lobgesang auf die Wirkung des Geistes, der durch seine Liebe und sein Wirken den Menschen beisteht, ihnen Kraft verleiht und sie zur Erkenntnis führt. Die Autorin adressiert den Heiligen Geist direkt und spricht ihn mit „Du“ an, wodurch eine innige Beziehung zwischen dem Gläubigen und der göttlichen Instanz aufgebaut wird.
Das Gedicht beschreibt die vielfältigen Aufgaben des Heiligen Geistes. Zuerst wird er als Unterstützer der Menschenliebe und Schöpfer des geistigen Lebens in einer chaotischen Welt dargestellt. Er wird als Licht in der Dunkelheit gesehen, das Erkenntnis ermöglicht und die Beschränkungen von Sprache und Gehör überwindet. Die ersten beiden Strophen zeichnen ein Bild von Erleuchtung, Führung und dem Überwinden menschlicher Unzulänglichkeiten durch die Gnade des Geistes. Die Metaphern von „Finsternissen“ und „Strahl der Erkenntnis“ unterstreichen den Kontrast zwischen Unwissenheit und Erleuchtung.
Die abschließende Strophe ändert den Ton und wendet sich der Würdigung der Taten des Heiligen Geistes zu. Anstatt einer physischen Krone, die irdischen Herrschern verliehen wird, wird ein „heil′ger Kranz“ betont, der aus den guten Taten des Geistes entspringt und niemals verwelkt. Diese Aussage verweist auf die Ewigkeit und Unvergänglichkeit der spirituellen Errungenschaften, im Gegensatz zu vergänglichen irdischen Auszeichnungen. Das „Bewusstsein“ und das „reine Streben“ des Geistes sind hier der wahre Lohn, eine Belohnung, die in der spirituellen Sphäre verankert ist.
Die Sprache des Gedichts ist erhaben und feierlich, was der Bedeutung des Themas angemessen ist. Ahlefeld verwendet eine Reihe von rhetorischen Figuren, wie beispielsweise die direkte Ansprache, um die Beziehung zur göttlichen Instanz zu intensivieren. Die Reimstruktur und der rhythmische Aufbau unterstützen die hymnische Wirkung und machen das Gedicht zu einem Ausdruck des Glaubens und der Verehrung. Das Gedicht ist somit eine Huldigung an die transformative Kraft des Heiligen Geistes und ein Bekenntnis zur spirituellen Erneuerung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.