Neulich sah ich, mit Ergetzen,
Eine kleine Fliege sich,
Auf ein Erlen-Blättchen setzen,
Deren Form verwunderlich
Von den Fingern der Natur,
So an Farb′, als an Figur,
Und an bunten Glantz gebildet.
Es war ihr klein Köpfgen grün,
Und ihr Körperchen vergüldet,
Ihrer klaren Flügel Paar,
Wenn die Sonne sie beschien,
Färbt ein Roth fast wie Rubin,
Das, indem es wandelbar,
Auch zuweilen bläulich war.
Liebster Gott! wie kann doch hier
Sich so mancher Farben Zier
Auf so kleinem Platz vereinen,
Und mit solchem Glantz vermählen,
Daß sie wie Metallen scheinen!
Rief ich, mit vergnügter Seelen.
Wie so künstlich! fiel mir ein,
Müssen hier die kleinen Theile
In einander eingeschrenckt,
durch einander hergelenckt
Wunderbar verbunden seyn!
Zu dem Endzweck, daß der Schein
Unsrer Sonnen und ihr Licht,
Das so wunderbarlich-schön,
Und von uns sonst nicht zu sehn,
Unserm forschenden Gesicht
Sichtbar werd, und unser Sinn,
Von derselben Pracht gerühret,
Durch den Glantz zuletzt dahin
Aufgezogen und geführet,
Woraus selbst der Sonnen Pracht
Erst entsprungen, der die Welt,
Wie erschaffen, so erhält,
Und so herrlich zubereitet.
Hast du also, kleine Fliege,
Da ich mir an die vergnüge,
selbst zur Gottheit mich geleitet.
Die kleine Fliege
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
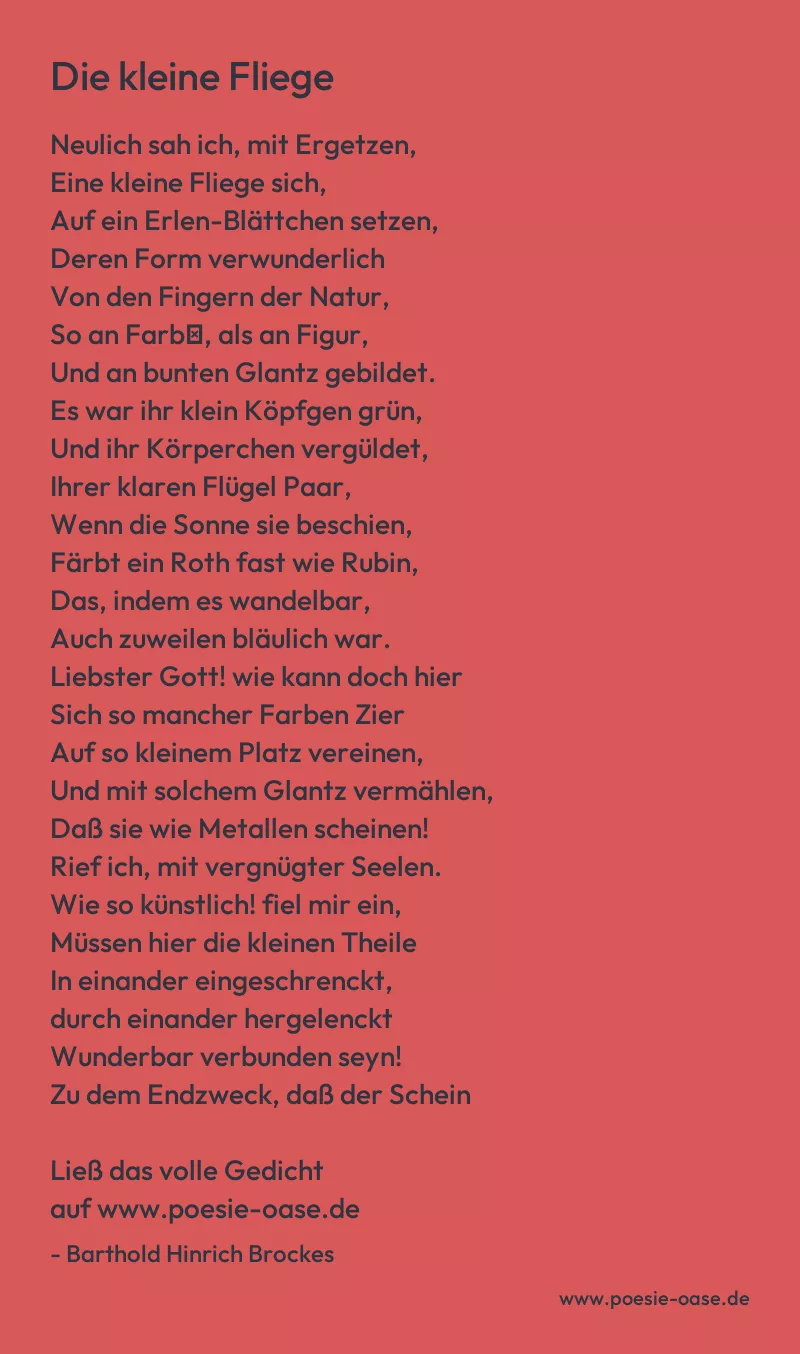
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die kleine Fliege“ von Barthold Hinrich Brockes ist eine Ode an die Schönheit und das Wunder der Natur, im Besonderen an die erstaunliche Erscheinung einer kleinen Fliege. Der Dichter beginnt mit einer einfachen Beobachtung: Er sieht eine Fliege auf einem Erlenblatt sitzen. Bereits hier deutet er auf die Bewunderung und das Staunen hin, das dieses kleine Geschöpf in ihm auslöst. Er beschreibt detailliert die Farben und Formen der Fliege, von ihrem grünen Köpfchen über den goldfarbenen Körper bis hin zu den schimmernden Flügeln, die je nach Lichteinfall rubinrot oder bläulich erscheinen.
Im Verlauf des Gedichts steigert sich die Bewunderung des lyrischen Ichs. Er erkennt in der komplexen Farbgebung und den filigranen Details der Fliege einen Ausdruck der göttlichen Schöpfung. Der Dichter ist fasziniert von der „künstlichen“ Perfektion, die in den kleinen Teilen der Fliege vereint ist. Er reflektiert über die Art und Weise, wie diese kleinen Elemente so kunstvoll verbunden sind, um das Licht zu reflektieren und die Schönheit der Sonne widerzuspiegeln. Diese Beobachtung führt zu einer philosophischen Reflexion über die Beziehung zwischen der irdischen Schönheit, der Sonne und letztendlich der Gottheit.
Der Höhepunkt des Gedichts ist die Erkenntnis, dass die Betrachtung der kleinen Fliege den Dichter dazu führt, sich der göttlichen Schönheit und Ordnung bewusst zu werden. Die Fliege wird hier nicht nur als ein Objekt der ästhetischen Freude betrachtet, sondern als ein Medium, das den Dichter zu einer tiefen spirituellen Erfahrung führt. Durch die Betrachtung dieses kleinen Geschöpfs wird er gleichsam „zur Gottheit geleitet“, wie es im letzten Vers heißt. Dies unterstreicht die Idee, dass selbst in den kleinsten Dingen der Natur die Größe und Herrlichkeit Gottes widergespiegelt werden.
Die Sprache des Gedichts ist typisch für die barocke Epoche, mit ihren ausführlichen Beschreibungen, der Verwendung von Adjektiven und der Reflexion über die Ordnung des Universums. Die ausführlichen Beschreibungen der Fliege dienen nicht nur dazu, die äußere Erscheinung darzustellen, sondern auch, die Bewunderung und Ehrfurcht des Dichters vor der Schöpfung zu vermitteln. Das Gedicht ist somit eine Hommage an die Schönheit der Natur und ein Ausdruck des Glaubens an die allgegenwärtige göttliche Ordnung, die sich in der kleinsten Kreatur manifestiert.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
