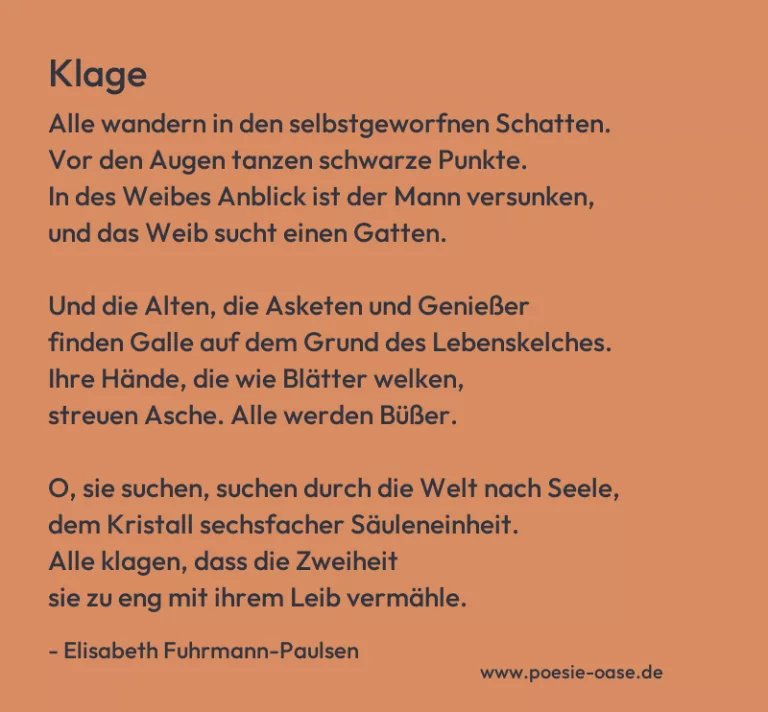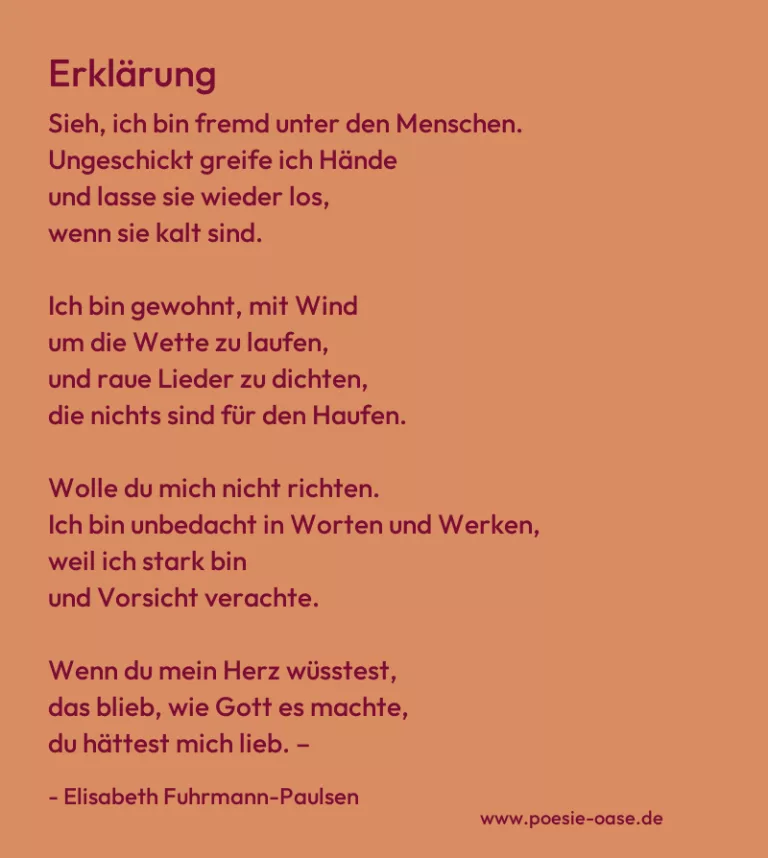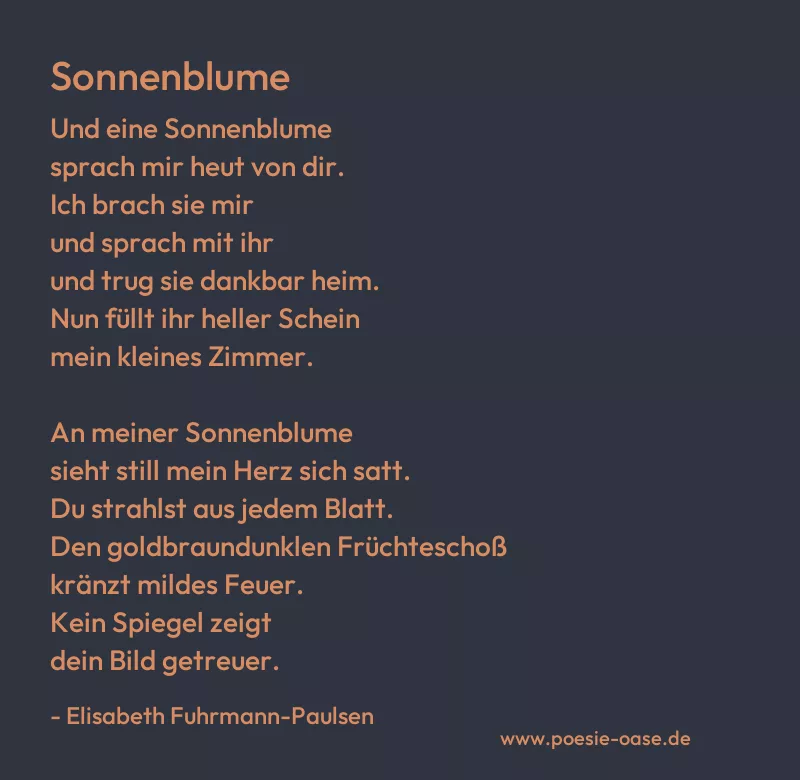Sonnenblume
Und eine Sonnenblume
sprach mir heut von dir.
Ich brach sie mir
und sprach mit ihr
und trug sie dankbar heim.
Nun füllt ihr heller Schein
mein kleines Zimmer.
An meiner Sonnenblume
sieht still mein Herz sich satt.
Du strahlst aus jedem Blatt.
Den goldbraundunklen Früchteschoß
kränzt mildes Feuer.
Kein Spiegel zeigt
dein Bild getreuer.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
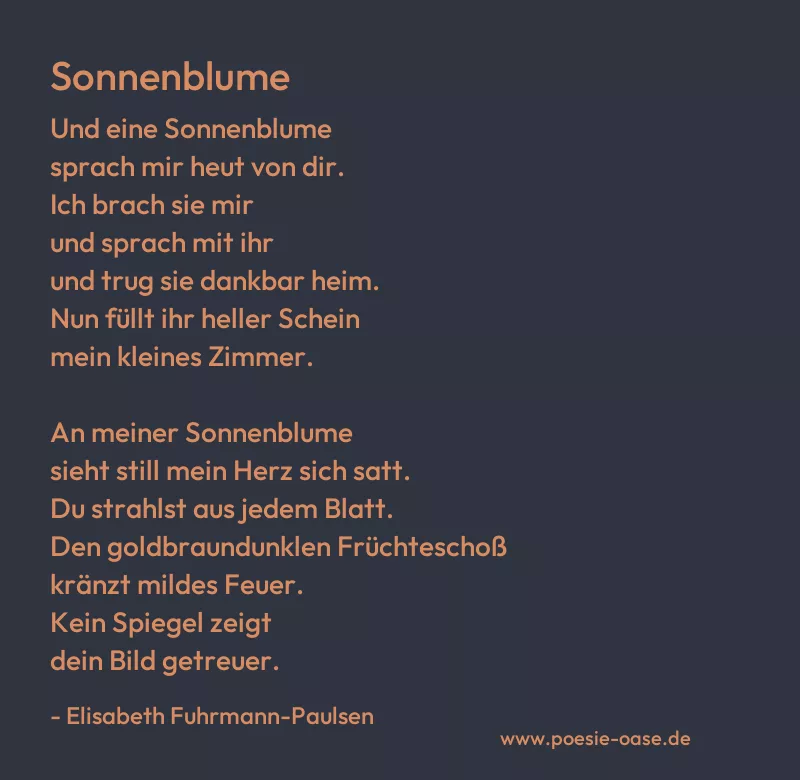
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sonnenblume“ von Elisabeth Fuhrmann-Paulsen verbindet die Blume mit der Erinnerung an eine geliebte Person. Die Sonnenblume wird zur Mittlerin zwischen dem lyrischen Ich und dem abwesenden Du. Indem das lyrische Ich die Blume pflückt, mit ihr spricht und sie nach Hause trägt, entsteht eine tiefe emotionale Verbindung. Der helle Schein der Sonnenblume erfüllt nicht nur das Zimmer, sondern scheint auch Trost und Nähe zu spenden.
Die zweite Strophe verstärkt die Symbolik der Sonnenblume als Spiegelbild der geliebten Person. Das lyrische Ich „sieht sich satt“ an ihr, als könne es darin die Präsenz des Du spüren. Besonders eindrucksvoll ist das Bild der Blütenmitte als „goldbraundunklen Früchteschoß“, der von „mildem Feuer“ umkränzt wird. Dies lässt die Sonnenblume als lebendiges Symbol für Wärme, Lebenskraft und vielleicht auch eine sanfte Sehnsucht erscheinen.
Die letzten Zeilen betonen, dass kein Spiegel das Bild der geliebten Person so wahrhaftig wiedergeben kann wie die Blume selbst. Damit wird die Sonnenblume zu einem Sinnbild für Erinnerung und Verbundenheit – sie bewahrt das Bild des Du besser als jedes Spiegelbild, weil sie nicht nur äußere Ähnlichkeit, sondern auch emotionale Tiefe vermittelt. Das Gedicht schafft so eine poetische Verbindung zwischen Natur, Erinnerung und Liebe.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.