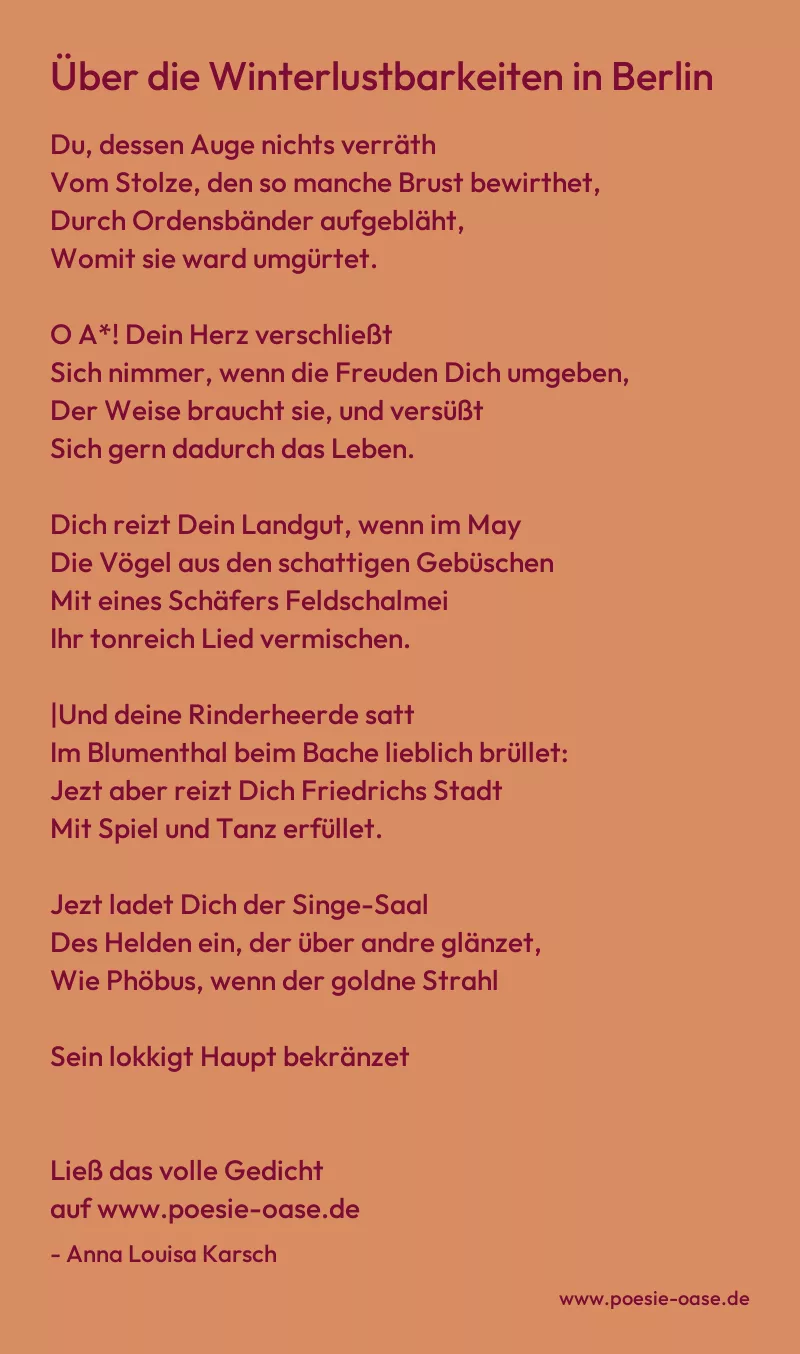Du, dessen Auge nichts verräth
Vom Stolze, den so manche Brust bewirthet,
Durch Ordensbänder aufgebläht,
Womit sie ward umgürtet.
O A*! Dein Herz verschließt
Sich nimmer, wenn die Freuden Dich umgeben,
Der Weise braucht sie, und versüßt
Sich gern dadurch das Leben.
Dich reizt Dein Landgut, wenn im May
Die Vögel aus den schattigen Gebüschen
Mit eines Schäfers Feldschalmei
Ihr tonreich Lied vermischen.
|Und deine Rinderheerde satt
Im Blumenthal beim Bache lieblich brüllet:
Jezt aber reizt Dich Friedrichs Stadt
Mit Spiel und Tanz erfüllet.
Jezt ladet Dich der Singe-Saal
Des Helden ein, der über andre glänzet,
Wie Phöbus, wenn der goldne Strahl
Sein lokkigt Haupt bekränzet
Die Sterne ringsumher beschämt;
Hier herrschen hohe königliche Freuden,
Und selbst der Bürger, der sich grämt,
Verstaunt hier seine Leiden;
Vergißt den Mangel, der ihn drückt,
Und stürzt sich mit der zahlenlosen Menge
Ans Schauspielhaus, und wird erquickt
Vom Wohlklang der Gesänge.
Auch Du betäubest jezt in Dir
Des Ländereibesitzers kleinste Sorgen,
Bald aber lokket Dich von hier
Der Hornungs erster Morgen,
An welchem sich die Lerche schon
Hoch über Deine Saatenfelder schwinget,
Da sagt Dir ihrer Hymnen Ton
Mehr als der Sänger singet,
Dem Menschenkunst die Noten schrieb,
Und Könige zu ihrer Lust gedungen;
Der ungerührt bei Trillern blieb,
Die jedes Ohr durchdrungen:
Und einer Orgelpfeife gleicht
Die schmeichlerisch den Hörer überwindet,
Und bis zu Thränen ihn erweicht
Und selber nichts empfindet.