Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret!
Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun
Das vom Blut fette Schwert, die donnernde Karthaun
Hat aller Schweiß, und Fleiß, und Vorrat aufgezehret.
Die Türme stehn in Glut, die Kirch′ ist umgekehret.
Das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhaun,
Die Jungfern sind geschänd′t, und wo wir hin nur schaun
Ist Feuer, Pest, und Tod, der Herz und Geist durchfähret.
Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut.
Dreimal sind schon sechs Jahr, als unser Ströme Flut
Von Leichen fast verstopft, sich langsam fort gedrungen.
Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod,
Was grimmer denn die Pest, und Glut und Hungersnot,
Daß auch der Seelen Schatz so vielen abgezwungen.
Wir sind doch nunmehr ganz…
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
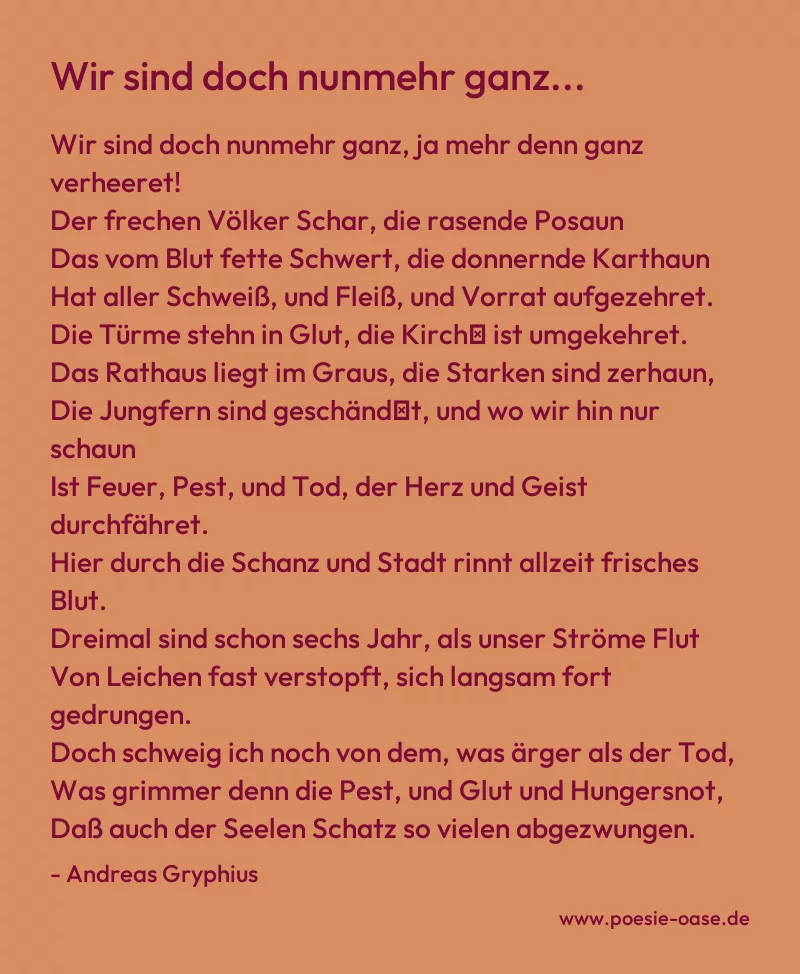
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Wir sind doch nunmehr ganz…“ von Andreas Gryphius ist ein erschütterndes Zeugnis der Verwüstung, die der Dreißigjährige Krieg in Deutschland anrichtete. Gryphius, der selbst von den Schrecken des Krieges betroffen war, zeichnet ein düsteres Bild des Leids und der Zerstörung, das in der klaren Sprache des Barock gehalten ist. Das Gedicht beginnt mit der Feststellung des totalen Ruins („verheeret“) und führt dann in einer Kette von Bildern die vielfältigen Auswirkungen des Krieges vor Augen.
Die ersten Strophen beschreiben die physische Zerstörung: Die „frechen Völker Schar“, das „Blut fette Schwert“ und die „donnernde Karthaun“ (Kanonen) haben alles vernichtet, was durch Fleiß und Mühe aufgebaut wurde. Türme stehen in Flammen, Kirchen sind zerstört, Rathäuser liegen im Trümmerfeld, und die Stärksten sind getötet. Die Gewalt erstreckt sich auch auf die Zivilbevölkerung, mit der Erwähnung geschändeter Jungfrauen, was das Ausmaß der Zerstörung und des menschlichen Leids unterstreicht. Die Aufzählung von Feuer, Pest und Tod illustriert eine Atmosphäre allgemeiner Verzweiflung.
In der zweiten Strophe wird das Ausmaß der Verwüstung durch die Beschreibung der blutigen Flüsse („frisches Blut“) verstärkt, welche sich durch die Stadt ziehen und das Bild der Toten, welche die Flüsse verstopfen. Die lange Zeitspanne („Dreimal sind schon sechs Jahr“) verdeutlicht die Dauer der Leiden und die Hoffnungslosigkeit der Situation. Gryphius vermeidet jedoch nicht, auch die seelische Verwüstung zu thematisieren, und deutet damit das Leiden an, das die körperlichen Wunden noch übersteigt.
Der letzte Teil des Gedichts lenkt den Blick auf eine noch tiefere Tragödie als die äußere Zerstörung: „Was grimmer denn die Pest, und Glut und Hungersnot“, die Zerstörung des „Seelen Schatz“, eine Anspielung auf den Verlust von Glauben, Moral und Hoffnung. Gryphius deutet damit an, dass der Krieg nicht nur die äußere Welt verwüstet, sondern auch die inneren Werte und die Seele des Menschen zerstört. Dieses erschütternde Gedicht ist ein eindringliches Mahnmal für die Schrecken des Krieges und die Notwendigkeit, Frieden zu bewahren.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
