Ich will nicht viel – nein,
Ich will nur deine Hand in meiner fühlen
Und gläubig sein.
Und aber – fühlen, wie verwandt
Dein Herz in meinen Fingern zittert –
O gib mir, gib mir deine Hand!
Ich will nicht viel – nein,
Ich will nur deine Hand in meiner fühlen
Und gläubig sein.
Und aber – fühlen, wie verwandt
Dein Herz in meinen Fingern zittert –
O gib mir, gib mir deine Hand!
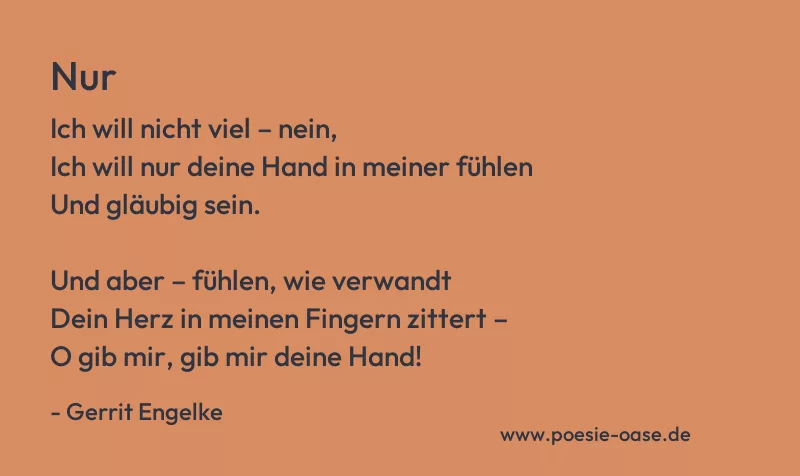
Das Gedicht „Nur“ von Gerrit Engelke ist eine schlichte, aber eindringliche Liebeserklärung, die die Sehnsucht nach Nähe und Verbundenheit in wenigen Zeilen verdichtet. Es thematisiert die essenzielle, fast existenzielle Bedeutung einer Berührung – nicht als bloße Geste, sondern als tief empfundene Verbindung zwischen zwei Menschen.
Die erste Strophe betont die Bescheidenheit des Wunsches: Das lyrische Ich verlangt nicht viel, sondern nur die Hand des geliebten Menschen. Doch in dieser kleinen Geste steckt eine große Sehnsucht nach Vertrauen und Geborgenheit. Der Ausdruck „gläubig sein“ deutet darauf hin, dass es um mehr als eine physische Berührung geht – es geht um einen tiefen, fast spirituellen Glauben an die Echtheit der Gefühle.
In der zweiten Strophe steigert sich die Intensität des Verlangens. Das Herz der geliebten Person scheint in den eigenen Fingern zu zittern, wodurch die emotionale und körperliche Nähe verschmelzen. Die wiederholte Bitte „O gib mir, gib mir deine Hand!“ verstärkt die Dringlichkeit und die innere Unruhe des Sprechers. Das Gedicht lebt von seiner schlichten Sprache und direkten Ansprache, wodurch es eine unmittelbare und berührende Wirkung entfaltet. Es ist ein Gedicht über die Kraft der Berührung – ein Ausdruck von Sehnsucht, Liebe und der tiefen Hoffnung auf Gegenseitigkeit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.