Ich hätte dir eine Sonne schenken können
Und den halben Mond
Und zwei Hände voll Sternblumen –
Aber du wolltest nicht.
Nun ist die Sonne fortgeflogen,
Die Sterne sind ausgestreut,
Meine Hände sind leer –
Und dich will ich nicht.
Ich hätte dir eine Sonne schenken können
Und den halben Mond
Und zwei Hände voll Sternblumen –
Aber du wolltest nicht.
Nun ist die Sonne fortgeflogen,
Die Sterne sind ausgestreut,
Meine Hände sind leer –
Und dich will ich nicht.
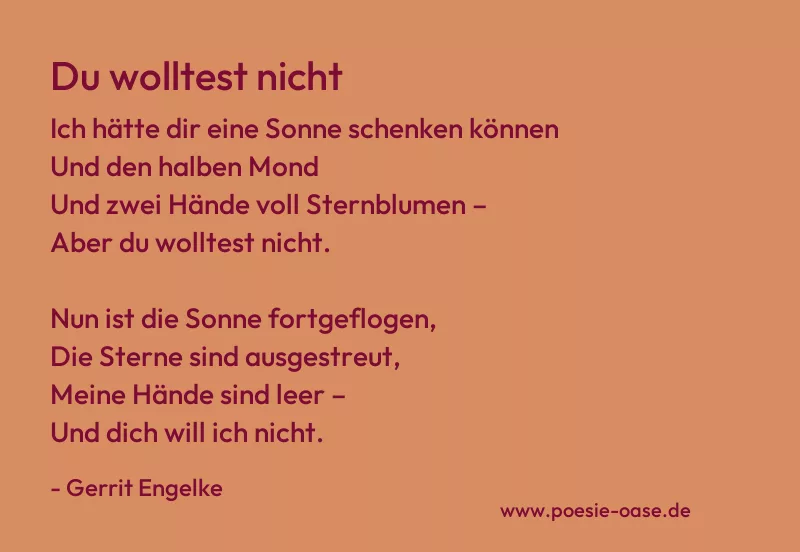
Das Gedicht „Du wolltest nicht“ von Gerrit Engelke ist eine kurze, aber eindringliche Reflexion über unerwiderte Liebe und den darauf folgenden Schmerz. Das lyrische Ich spricht eine Person an, der es großzügige, fast überirdische Geschenke machen wollte – Sonne, Mond und Sterne stehen hier als Symbole für grenzenlose Zuneigung und Hingabe. Doch die geliebte Person weist diese Liebe zurück, was im schlichten, aber endgültigen „Aber du wolltest nicht“ kulminiert.
Die zweite Strophe zeigt die Konsequenzen dieser Zurückweisung: Die leuchtenden Bilder der ersten Strophe verschwinden, was den Verlust und die Ernüchterung des lyrischen Ichs verdeutlicht. Die Sonne „fliegt fort“, die Sterne werden „ausgestreut“, und am Ende bleiben nur leere Hände zurück – ein starkes Symbol für die Vergeblichkeit der eigenen Gefühle. Die Bildsprache unterstreicht dabei die emotionale Leere, die der Zurückweisung folgt.
Der letzte Vers, „Und dich will ich nicht“, stellt einen Wendepunkt dar. Das lyrische Ich versucht, sich von der einst geliebten Person zu lösen und ihr die gleiche Zurückweisung entgegenzusetzen. Ob diese Aussage wirklich aus Überzeugung oder eher aus Trotz und verletztem Stolz getroffen wird, bleibt offen. Insgesamt beschreibt das Gedicht mit wenigen, aber kraftvollen Worten den Übergang von tiefer Zuneigung zu Enttäuschung und Ablehnung, wobei die klare, reduzierte Sprache die Schärfe dieser Emotionen noch verstärkt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.