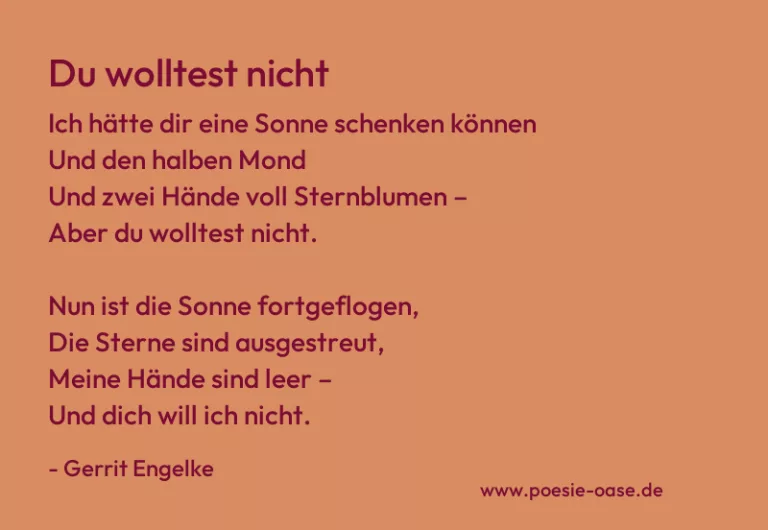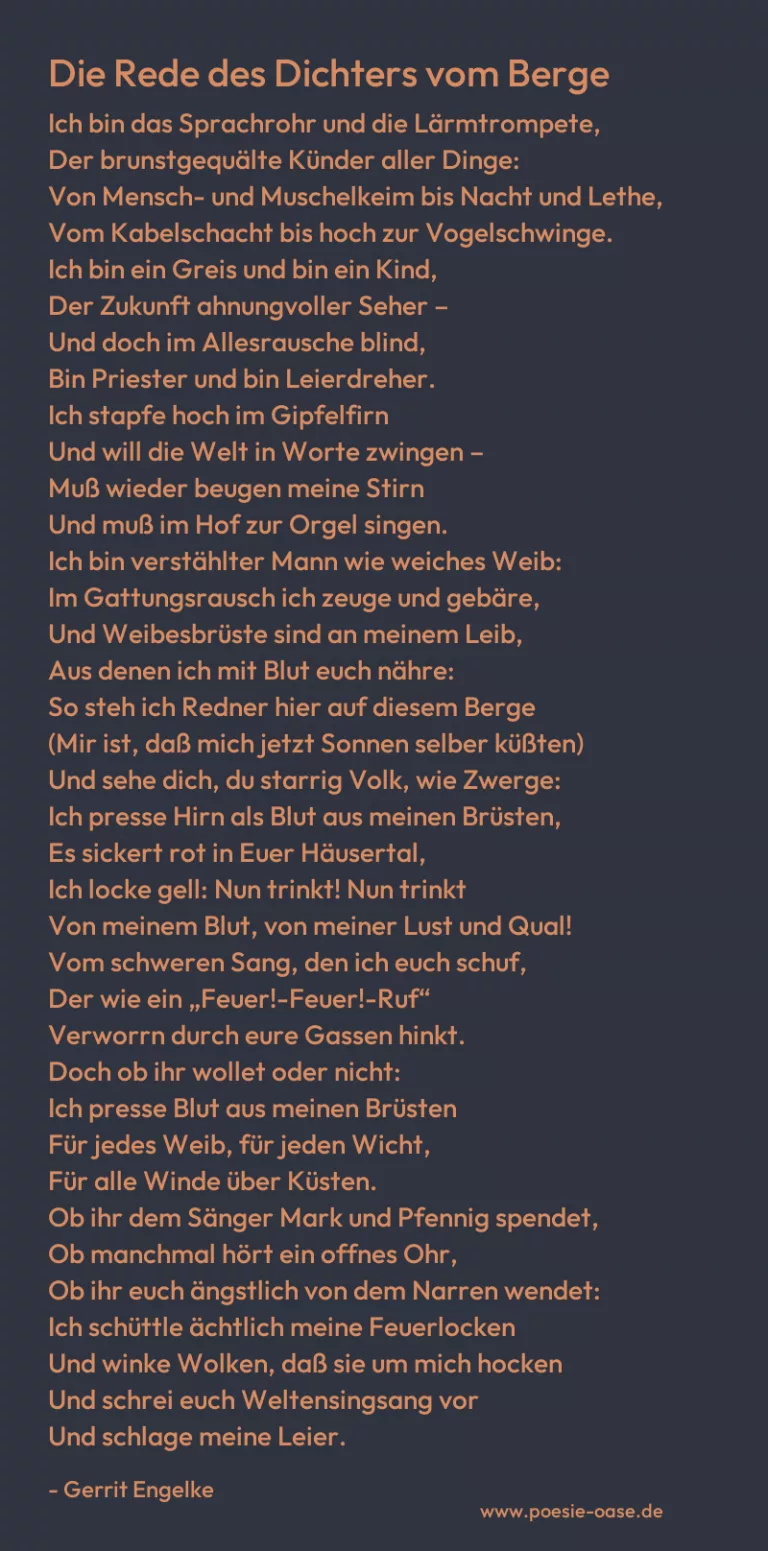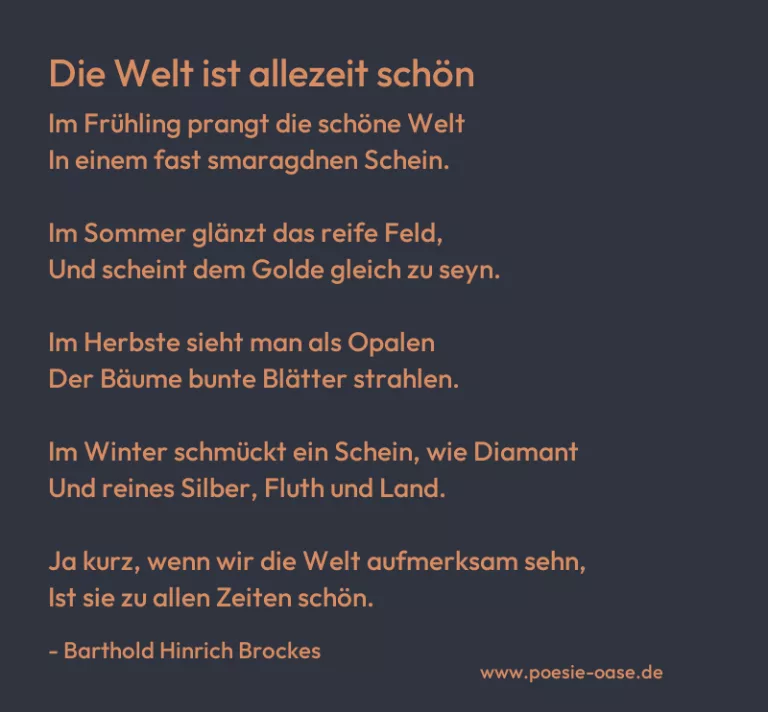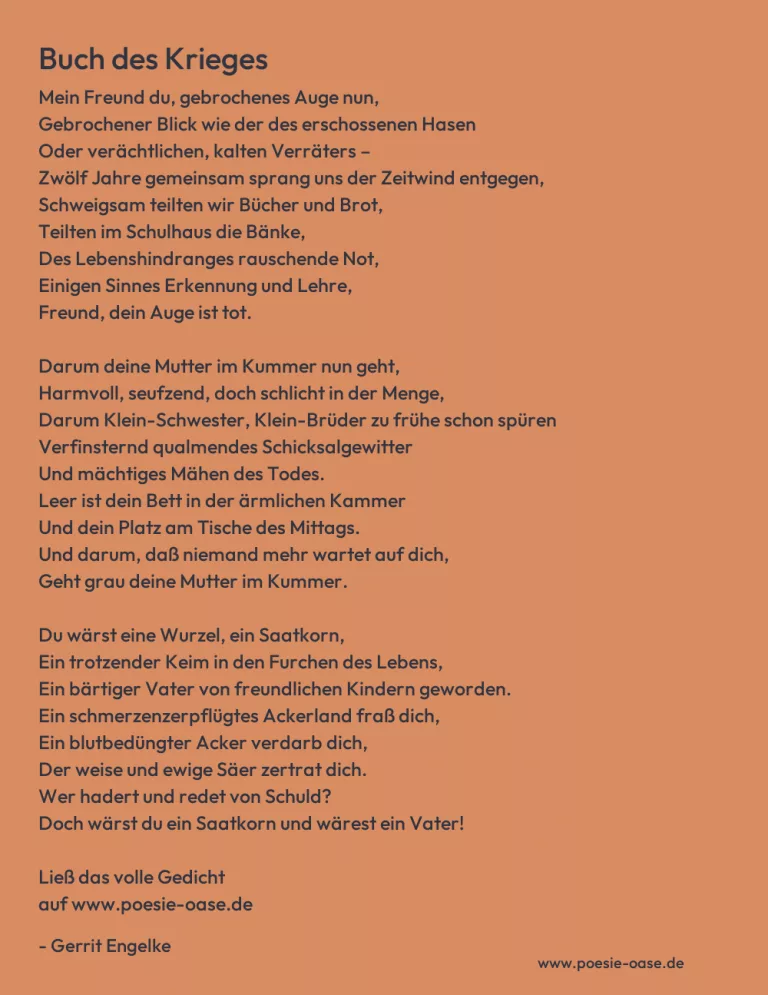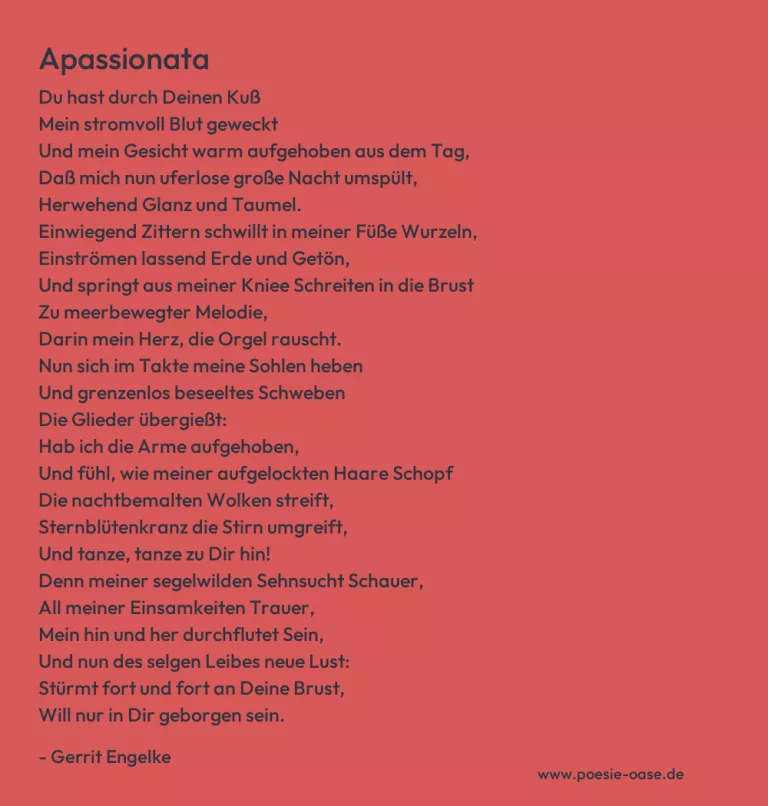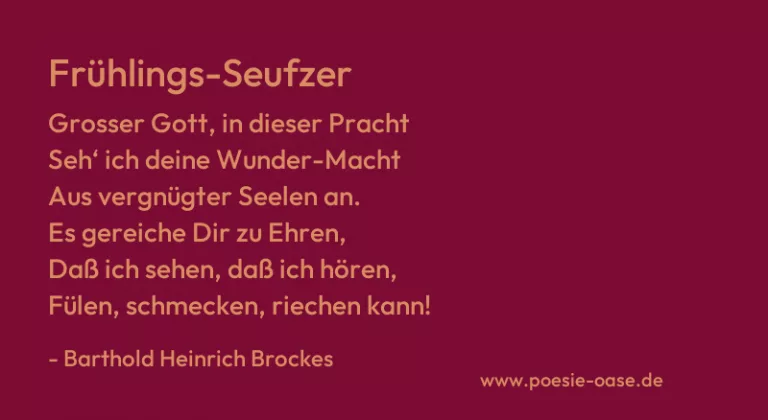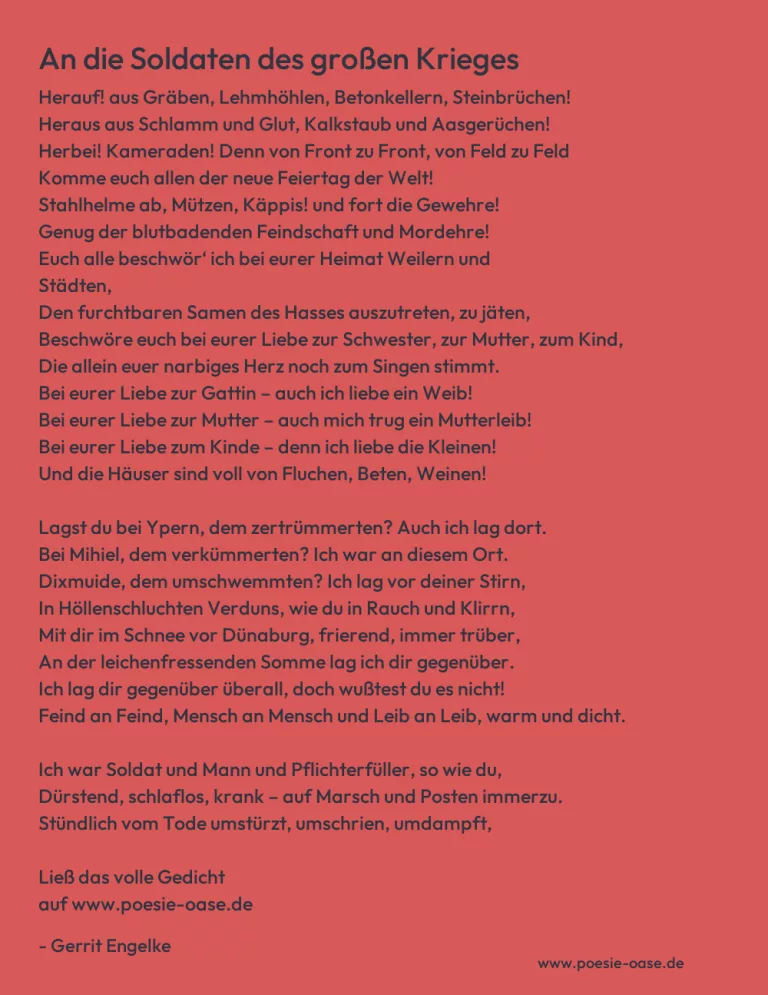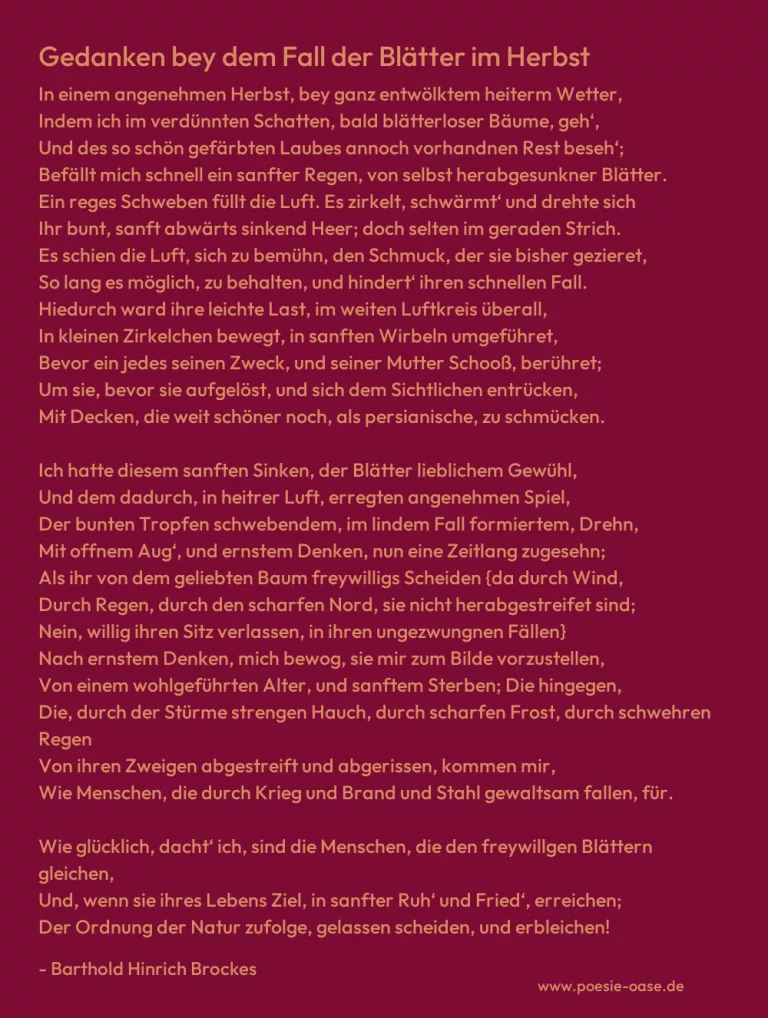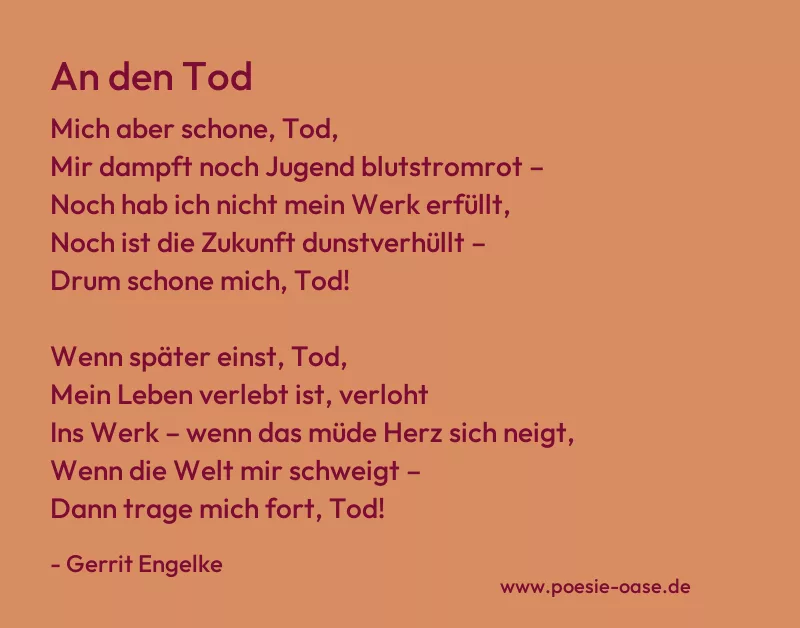An den Tod
Mich aber schone, Tod,
Mir dampft noch Jugend blutstromrot –
Noch hab ich nicht mein Werk erfüllt,
Noch ist die Zukunft dunstverhüllt –
Drum schone mich, Tod!
Wenn später einst, Tod,
Mein Leben verlebt ist, verloht
Ins Werk – wenn das müde Herz sich neigt,
Wenn die Welt mir schweigt –
Dann trage mich fort, Tod!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
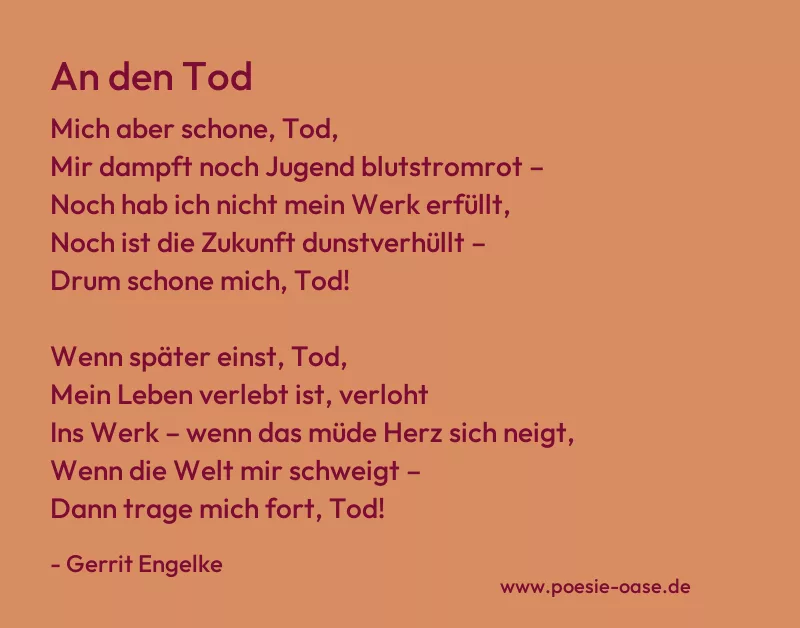
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An den Tod“ von Gerrit Engelke ist eine eindringliche Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit und dem Wunsch, den Tod hinauszuzögern, bis das Leben seine Erfüllung gefunden hat. Das lyrische Ich spricht den Tod direkt an und bittet ihn, noch zu warten, da die Jugend und die damit verbundene Kraft und Schaffensfreude noch ungebrochen sind. Die Metapher des „blutstromroten“ Dampfes unterstreicht die Vitalität und Energie, die noch nicht versiegen darf.
Der zweite Versabschnitt stellt dem Drängen der Jugend die spätere Akzeptanz des Todes gegenüber. Erst wenn das Leben gelebt, das Werk vollbracht und das Herz müde geworden ist, soll der Tod kommen. Besonders die Formulierung „verlebt, verloht ins Werk“ zeigt die Vorstellung, dass das Leben erst dann seinen Sinn erfüllt hat, wenn es in schöpferischer Tätigkeit aufgegangen ist. Die Welt wird dann nicht mehr von Bedeutung sein, und das lyrische Ich wird bereit sein, sich dem Tod zu überlassen.
Die klare, fast flehende Struktur des Gedichts betont die existenzielle Dringlichkeit des Wunsches, noch nicht gehen zu müssen. Gleichzeitig schwingt eine unausgesprochene Gewissheit mit: Der Tod ist unvermeidlich, aber er soll erst dann eintreten, wenn das Leben in vollem Maße ausgeschöpft wurde. Engelke verbindet hier den Kampfgeist der Jugend mit einer tiefen Ehrfurcht vor dem natürlichen Lebenszyklus, wodurch das Gedicht eine Mischung aus Trotz, Hoffnung und letztendlicher Hingabe vermittelt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.