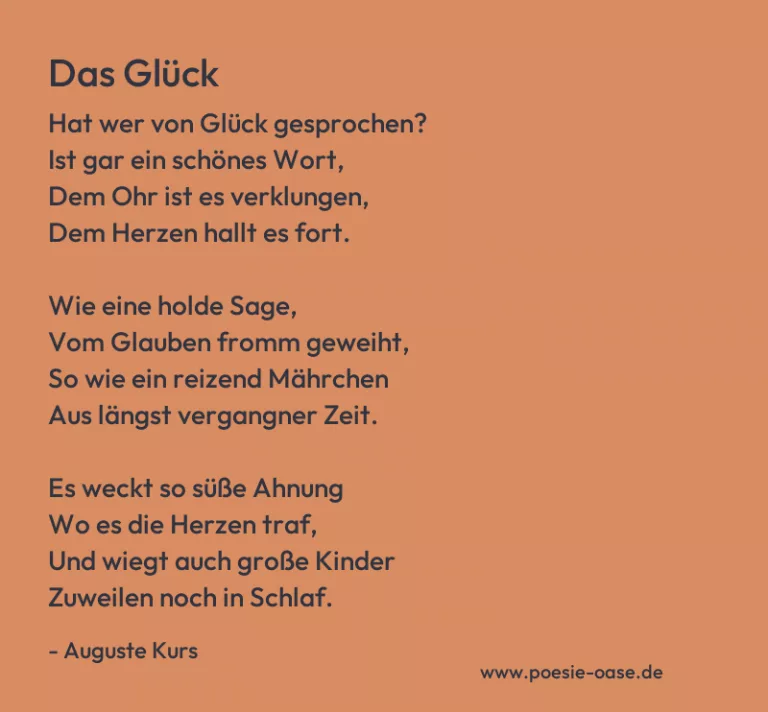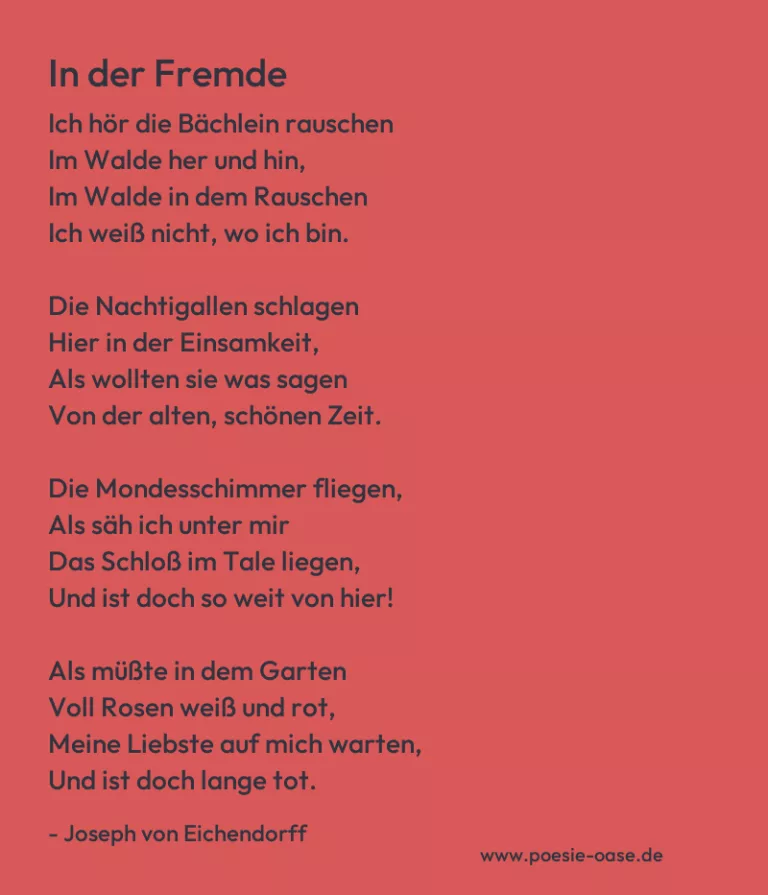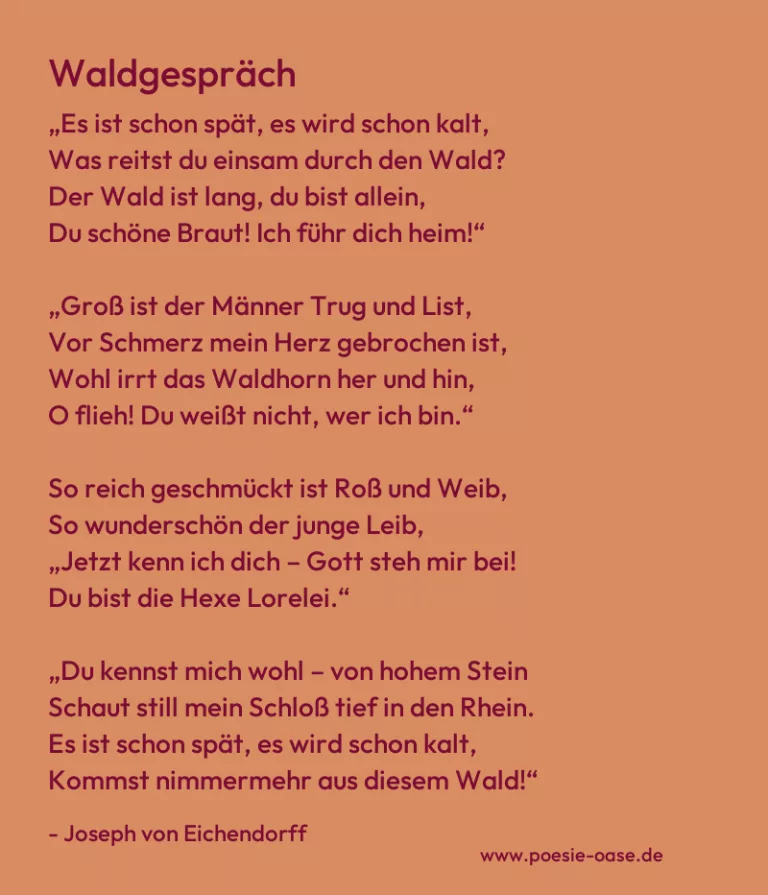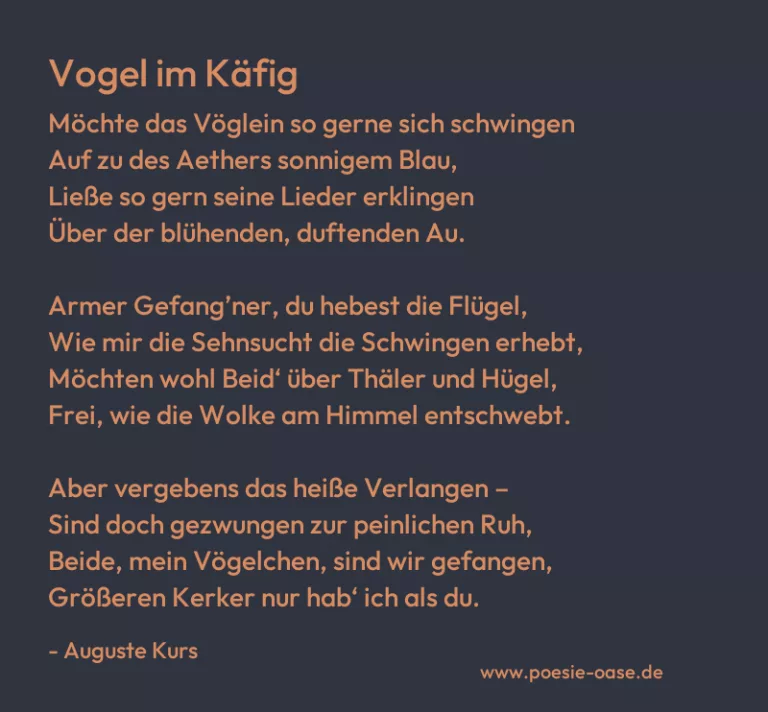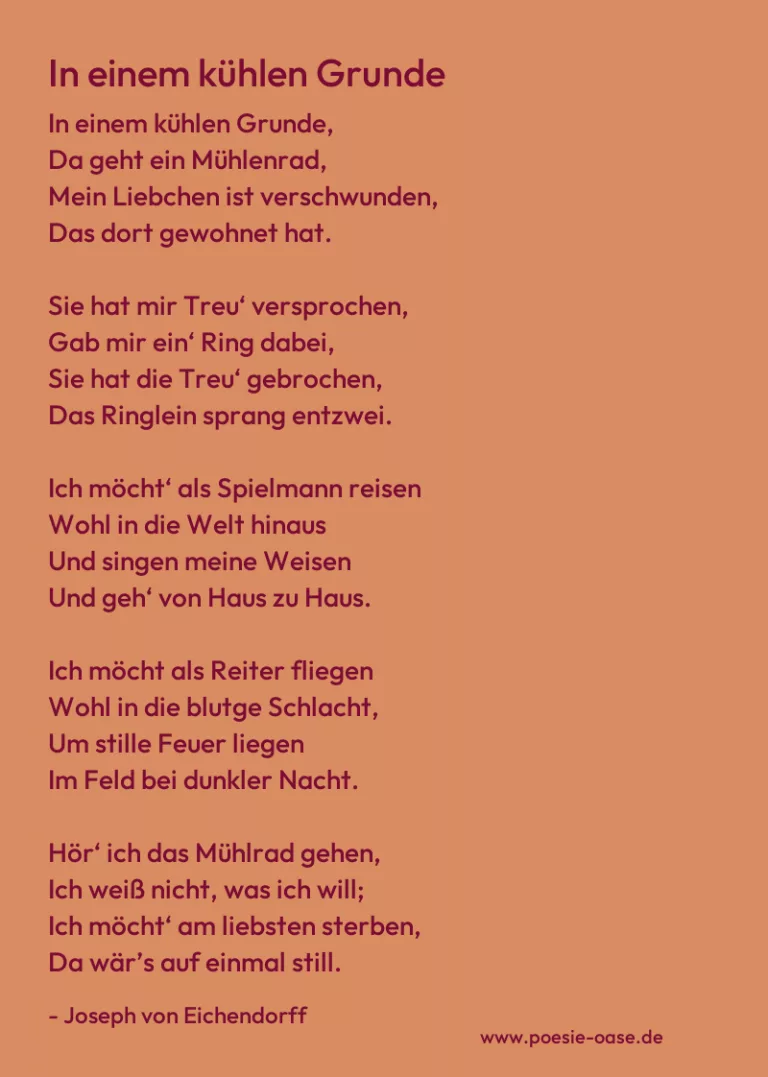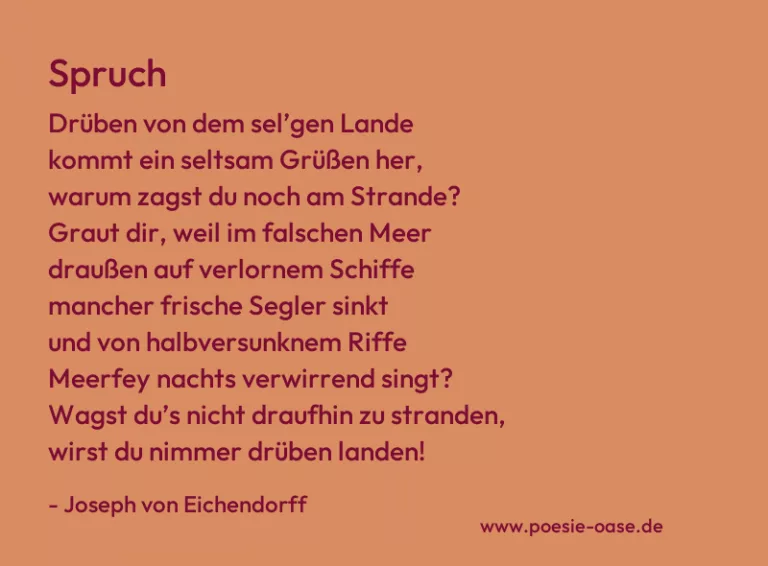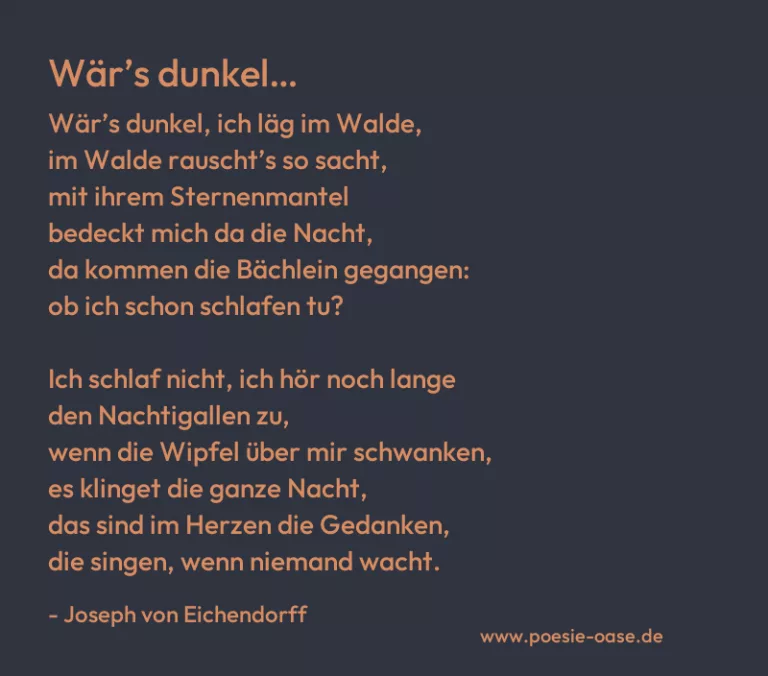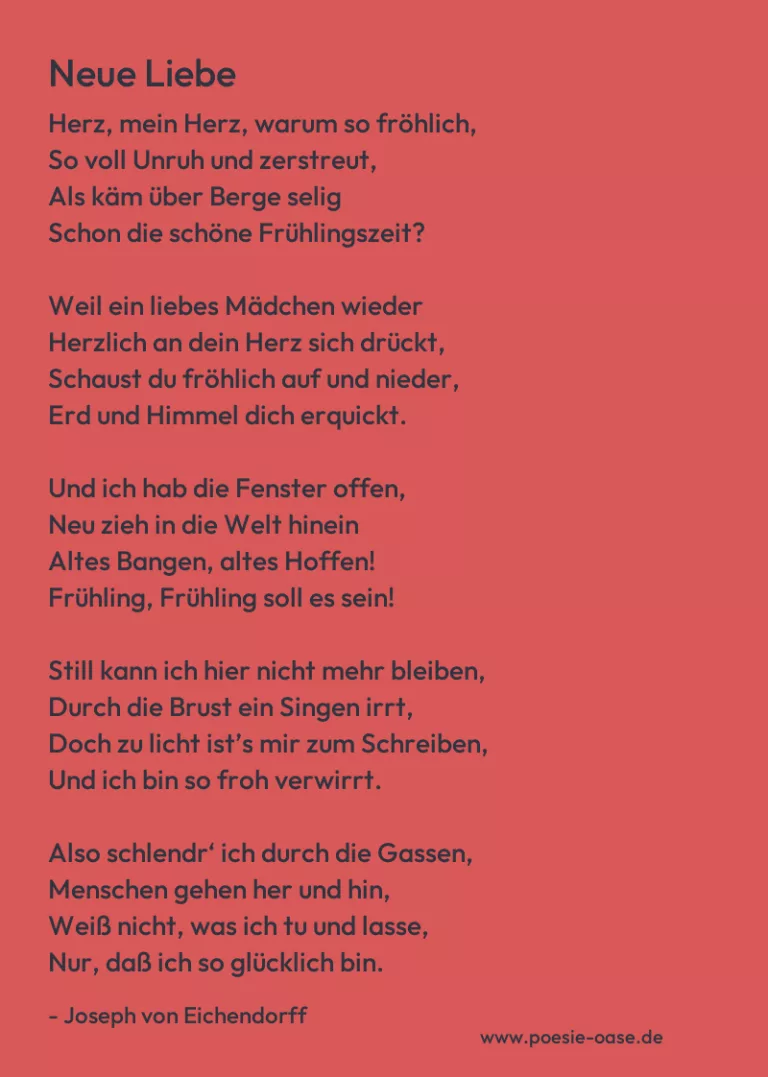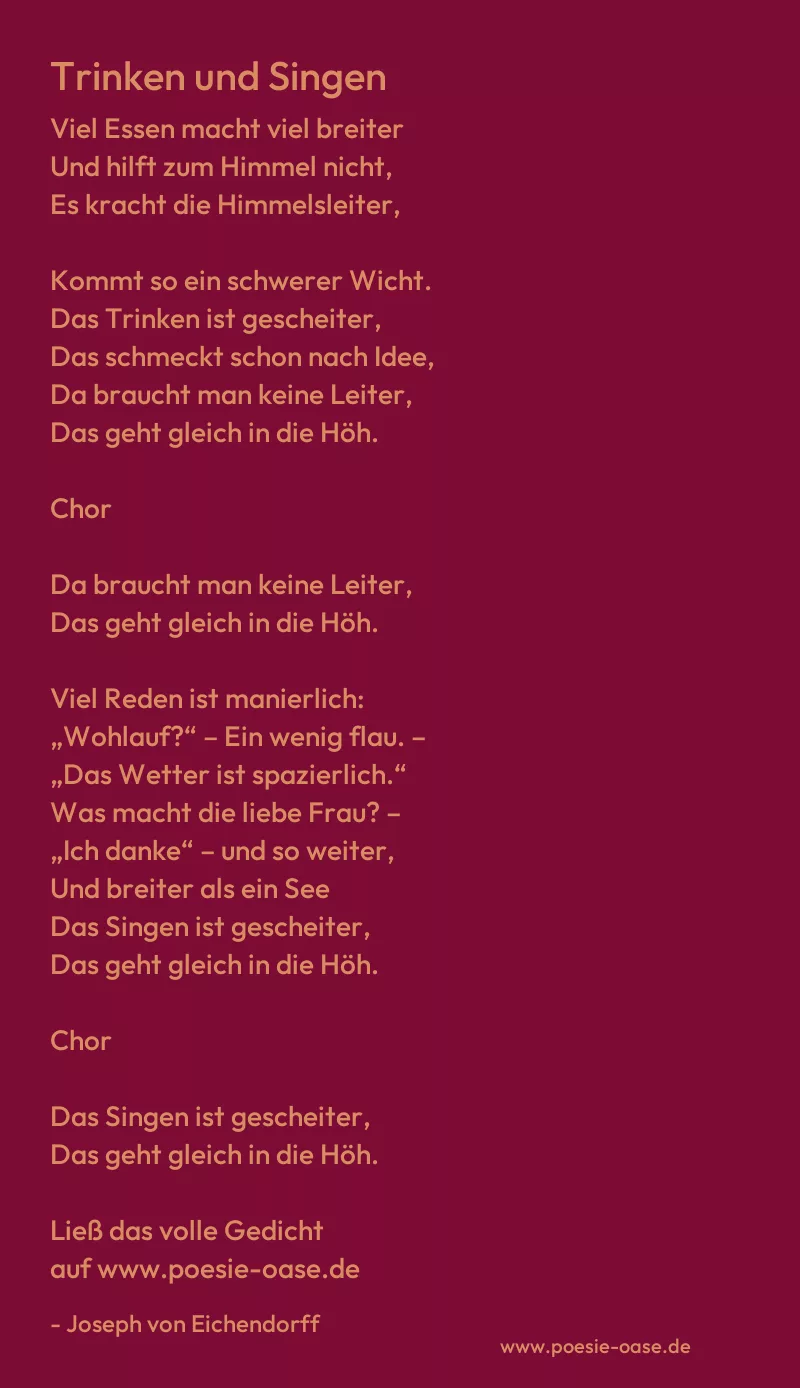Viel Essen macht viel breiter
Und hilft zum Himmel nicht,
Es kracht die Himmelsleiter,
Kommt so ein schwerer Wicht.
Das Trinken ist gescheiter,
Das schmeckt schon nach Idee,
Da braucht man keine Leiter,
Das geht gleich in die Höh.
Chor
Da braucht man keine Leiter,
Das geht gleich in die Höh.
Viel Reden ist manierlich:
„Wohlauf?“ – Ein wenig flau. –
„Das Wetter ist spazierlich.“
Was macht die liebe Frau? –
„Ich danke“ – und so weiter,
Und breiter als ein See
Das Singen ist gescheiter,
Das geht gleich in die Höh.
Chor
Das Singen ist gescheiter,
Das geht gleich in die Höh.
Die Fisch und Musikanten
Die trinken beide frisch,
Die Wein, die andern Wasser –
Drum hat der dumme Fisch
Statt Flügel Flederwische
Und liegt elend im See –
Doch wir sind keine Fische,
Das geht gleich in die Höh.
Chor
Doch wir sind keine Fische,
Das geht gleich in die Höh.
Ja, Trinken frisch und Singen
Das bricht durch alles Weh,
Das sind zwei gute Schwingen,
Gemeine Welt, ade!
Du Erd mit deinem Plunder,
Ihr Fische samt der See,
’s geht alles, alles unter,
Wir aber in die Höh!
Chor
’s geht alles, alles unter,
Wir aber in die Höh!