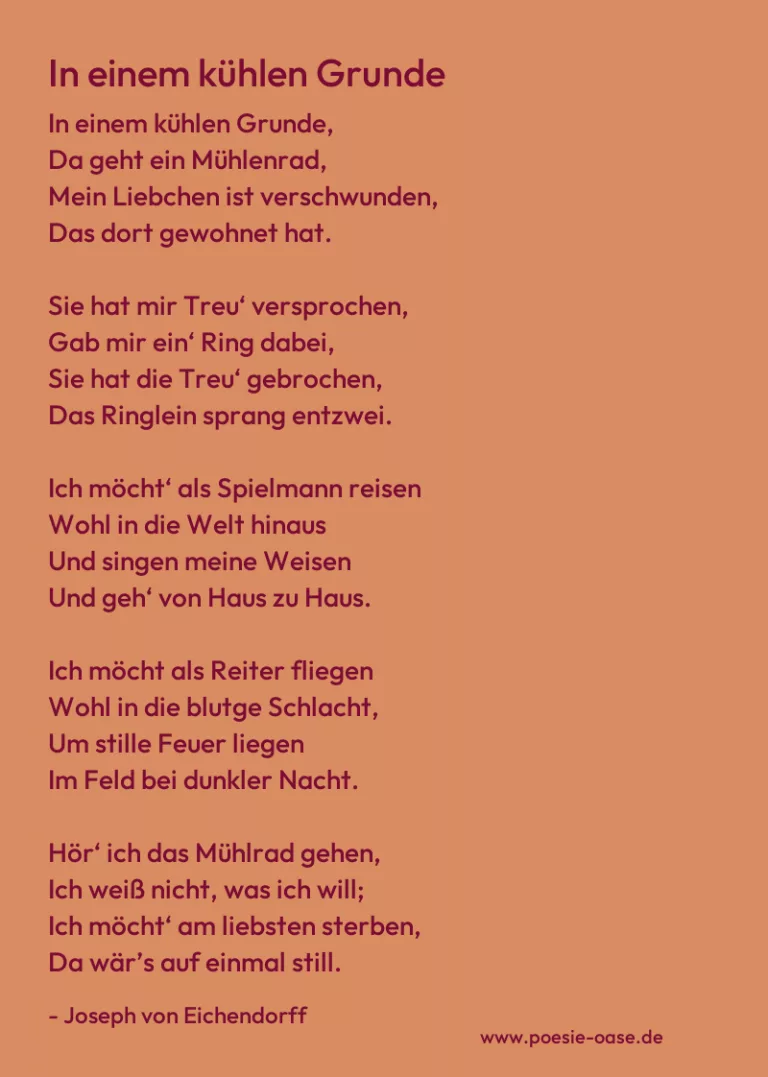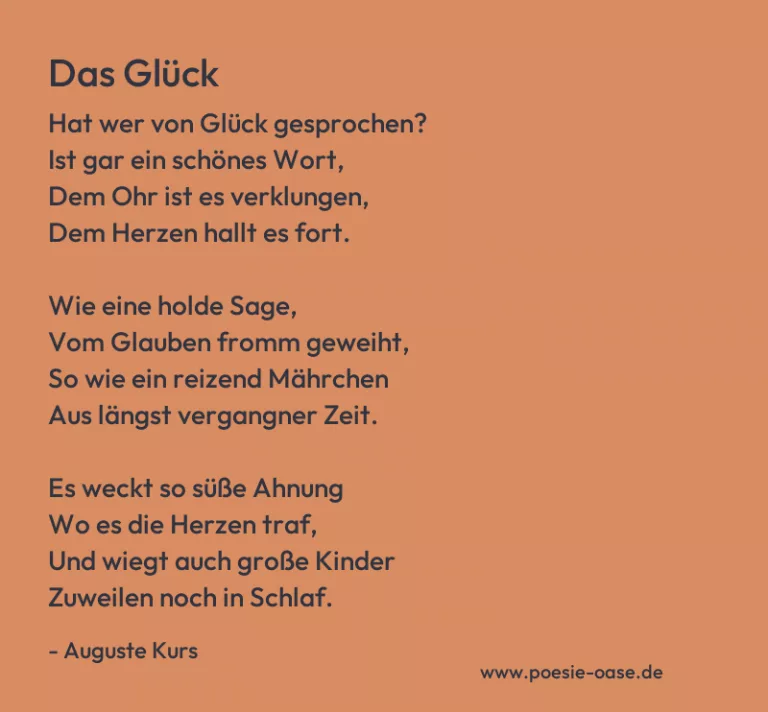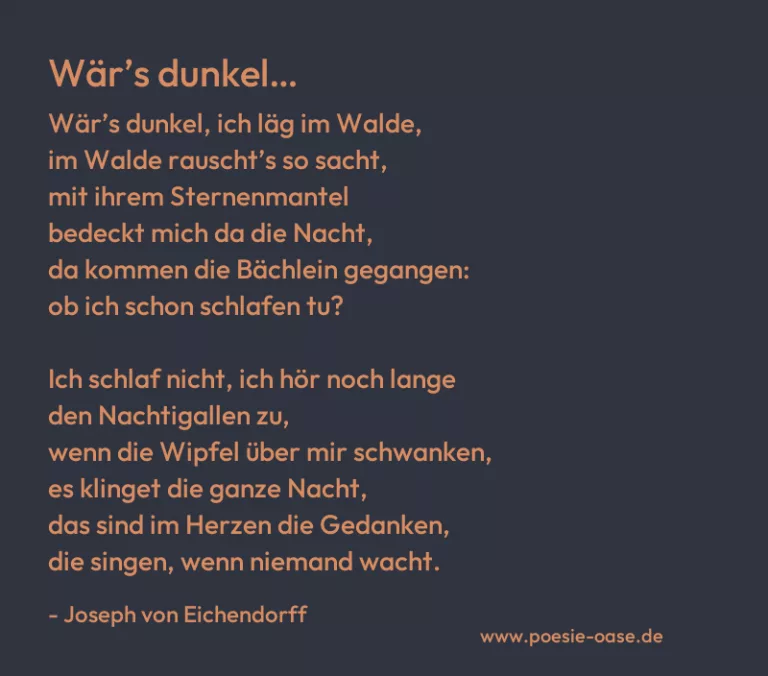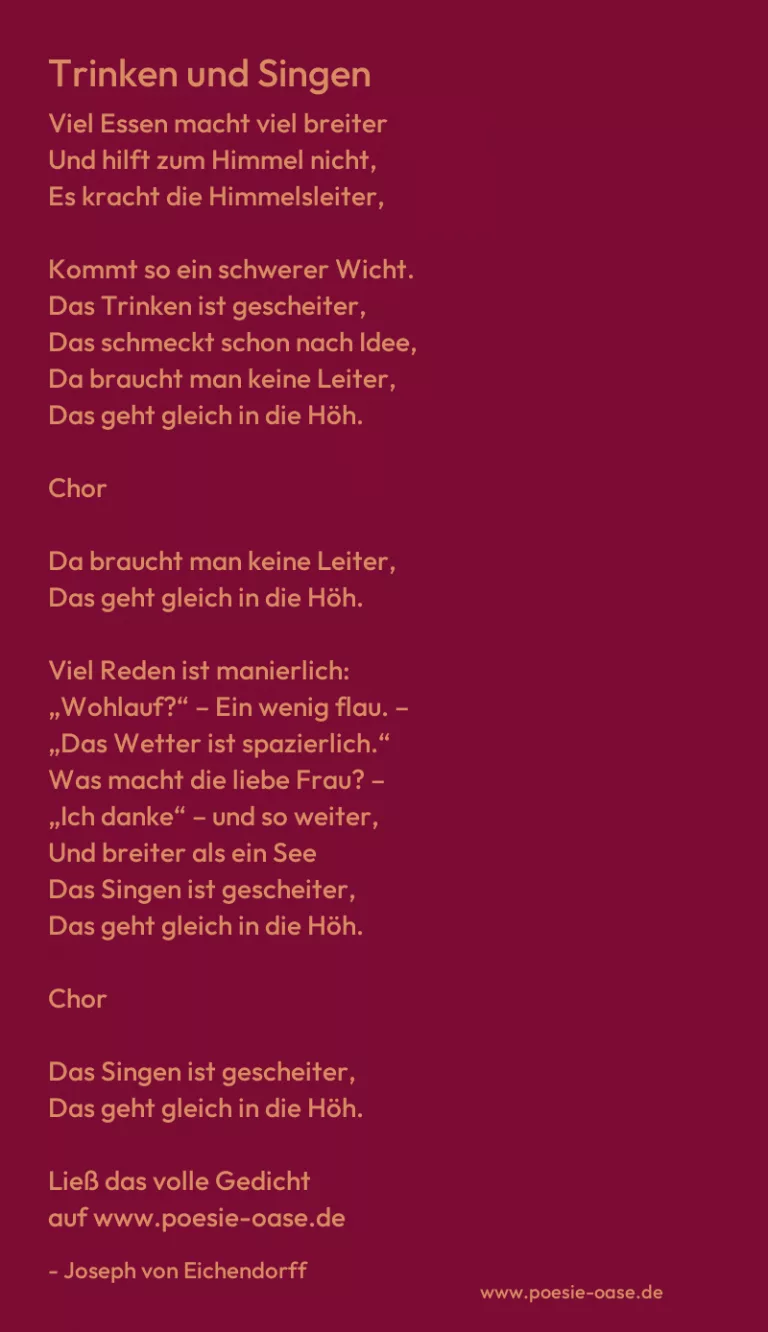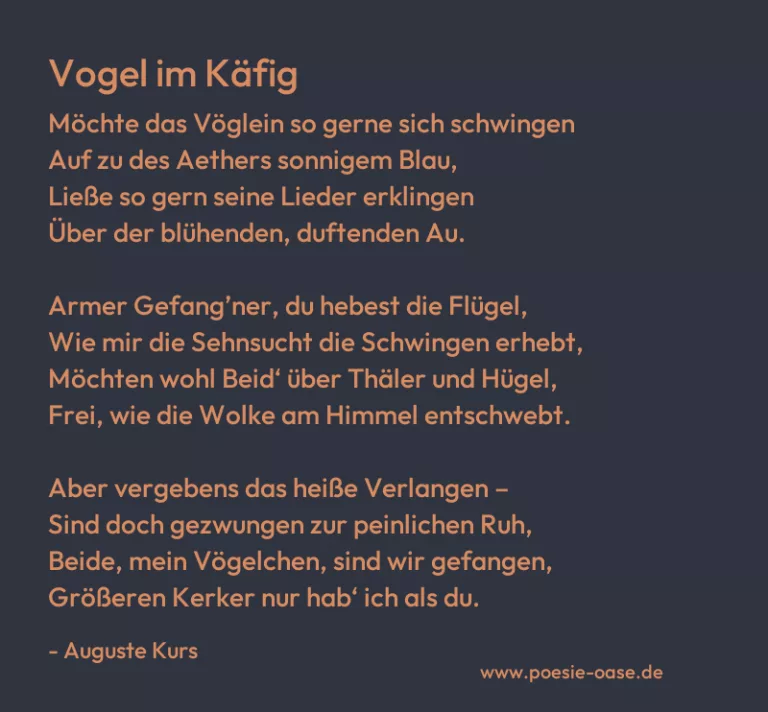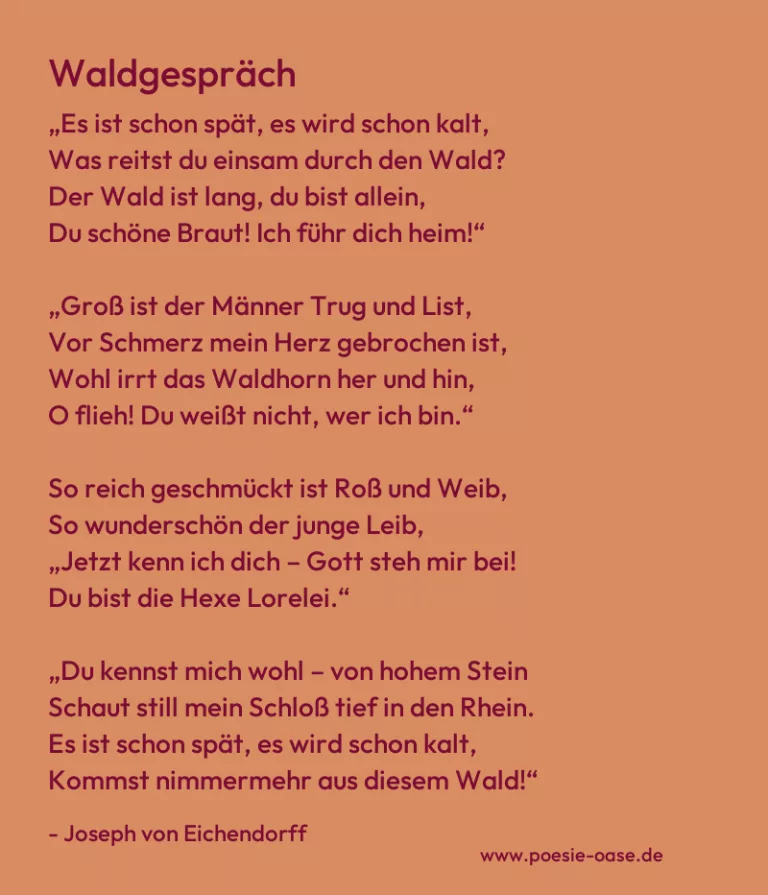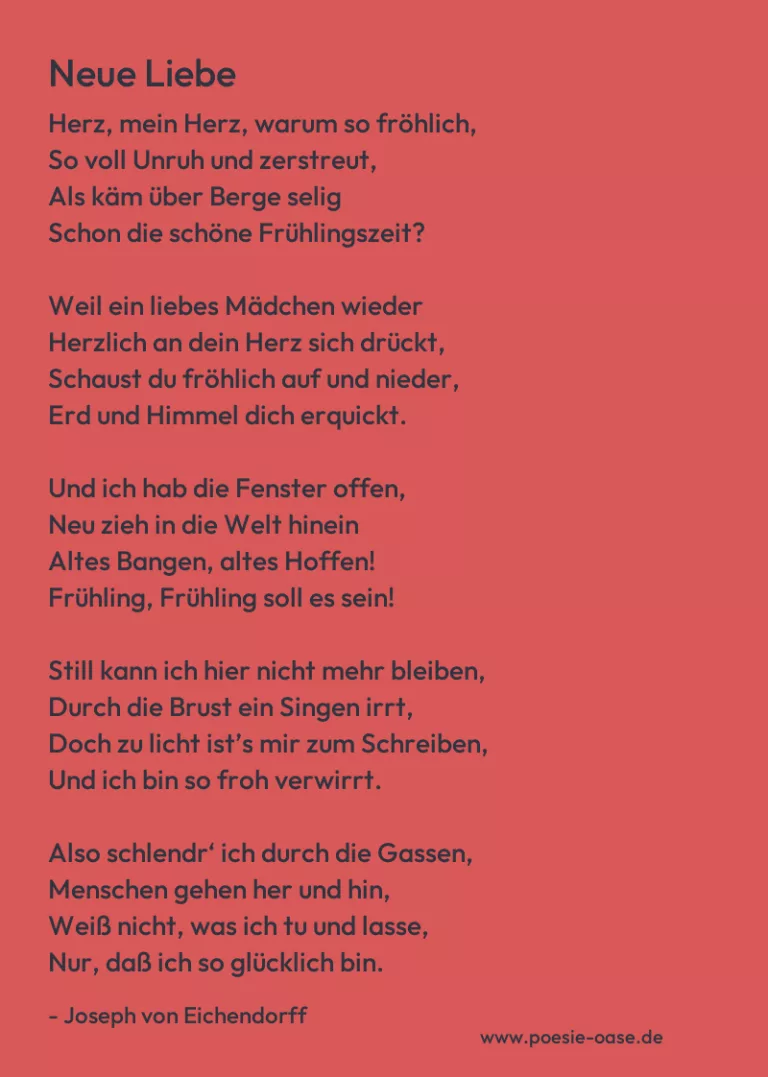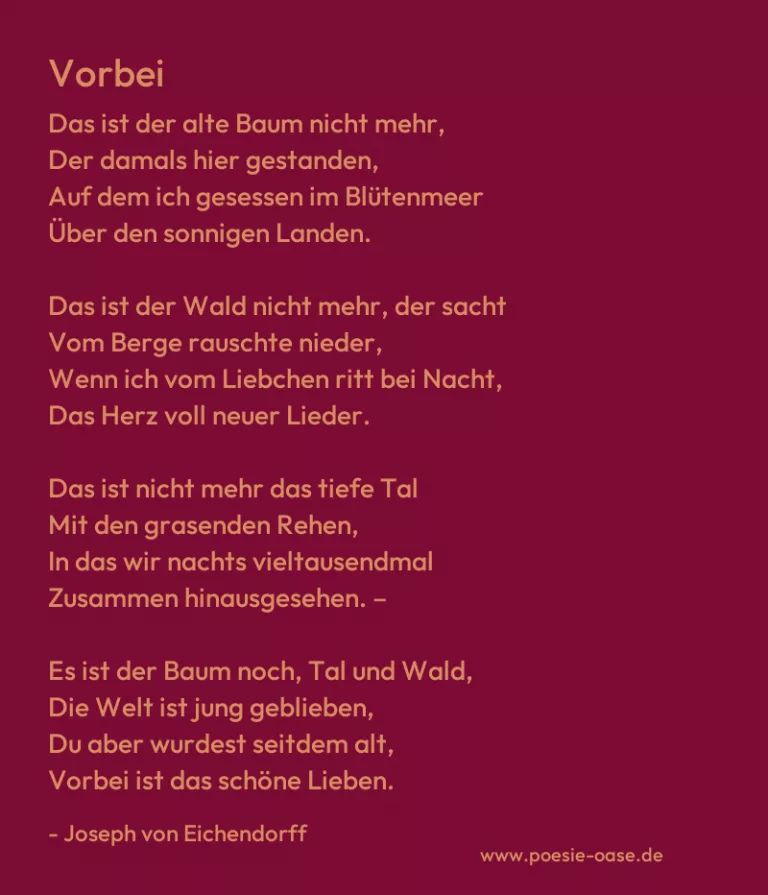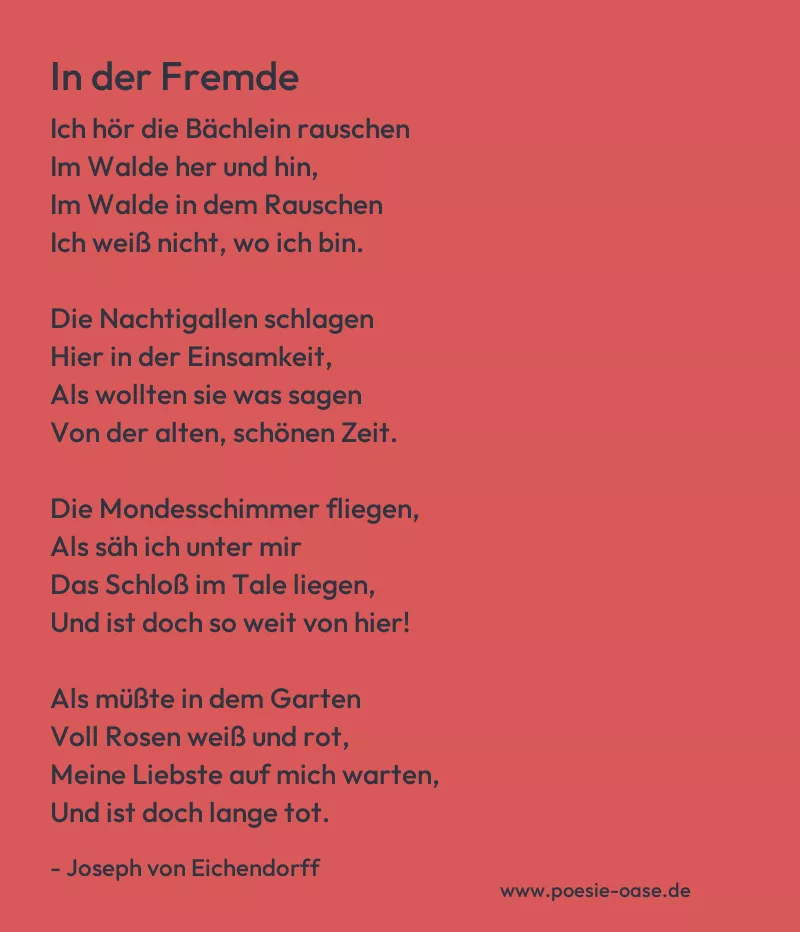In der Fremde
Ich hör die Bächlein rauschen
Im Walde her und hin,
Im Walde in dem Rauschen
Ich weiß nicht, wo ich bin.
Die Nachtigallen schlagen
Hier in der Einsamkeit,
Als wollten sie was sagen
Von der alten, schönen Zeit.
Die Mondesschimmer fliegen,
Als säh ich unter mir
Das Schloß im Tale liegen,
Und ist doch so weit von hier!
Als müßte in dem Garten
Voll Rosen weiß und rot,
Meine Liebste auf mich warten,
Und ist doch lange tot.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
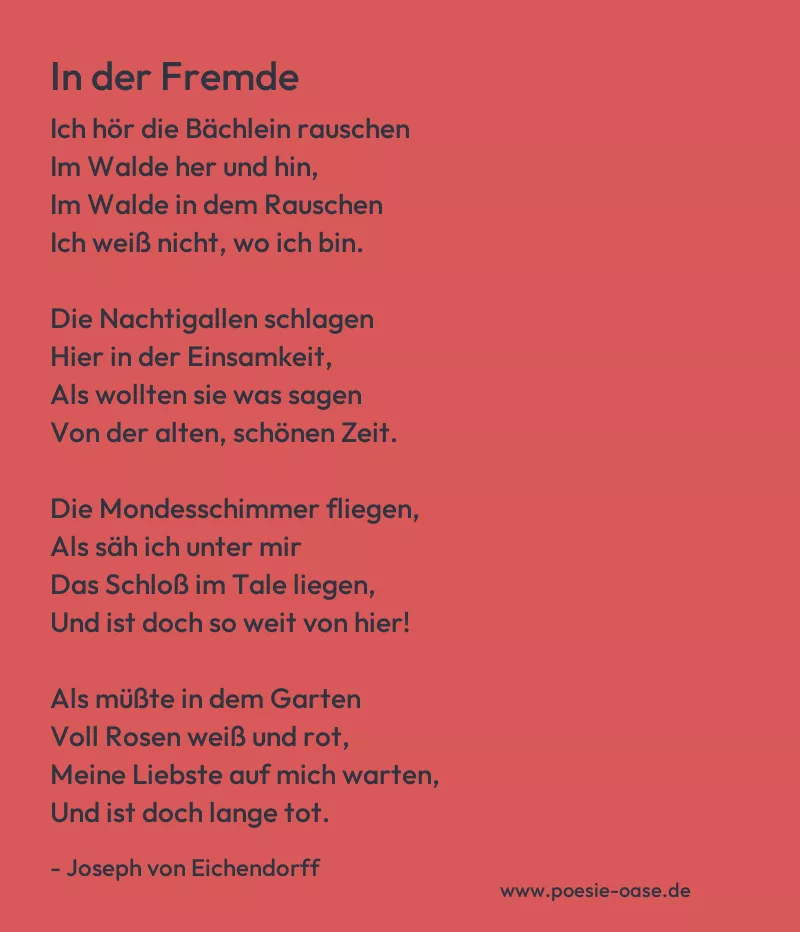
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „In der Fremde“ von Joseph von Eichendorff beschreibt das Gefühl der Sehnsucht und der Entfremdung, das der lyrische Sprecher in der Einsamkeit der Natur erlebt. Schon zu Beginn hört der Sprecher die „Bächlein rauschen“ und verspürt eine Orientierungslosigkeit, da er „nicht weiß, wo [er] bin“. Das Rauschen der Bäche und das Gefühl der Verlorenheit spiegeln eine innere Zerrissenheit wider, die durch den Bezug zur Natur noch verstärkt wird. Die Natur wird hier nicht nur als äußere Umgebung, sondern als Spiegelbild des inneren Zustands des Sprechers genutzt.
Die zweite Strophe bringt eine stärkere emotionale Wendung, als die Nachtigallen singen. Ihr Gesang wird als eine Art Botschaft von der „alten, schönen Zeit“ interpretiert, was auf eine vergangene Ära der Glückseligkeit und Liebe hinweist. Der Sprecher fühlt sich von der Musik der Vögel an etwas längst Vergangenes erinnert, was möglicherweise auf verlorene Liebe oder eine ferne Heimat verweist. Das Rauschen und Singen der Natur verleiht dem Gedicht eine mystische, beinahe übernatürliche Atmosphäre.
In der dritten Strophe, als der Mondenschein „fliegt“ und der Sprecher das Bild eines Schlosses im Tal sieht, wird die Sehnsucht nach einer idealisierten Vergangenheit weiter verstärkt. Das Bild des Schlosses als Symbol für eine verklärte Erinnerung wird jedoch von der Tatsache überschattet, dass dieses Schloss „so weit von hier“ ist. Es wird eine Entfernung zwischen dem Sprecher und seinem Wunschziel deutlich, die sowohl geographisch als auch emotional ist.
Die letzte Strophe gipfelt in der traurigen Erkenntnis, dass „die Liebste“ auf den Sprecher wartet, jedoch „lange tot“ ist. Dieser Vers drückt den Verlust und die Endlichkeit des Lebens aus. Es wird deutlich, dass die „Liebste“ ein Symbol für etwas Vergangenes und Unerreichbares ist. Die Rose als Symbol der Liebe und Schönheit ist in dieser Strophe zugleich ein Zeichen der Vergänglichkeit. Das Gedicht endet mit einer melancholischen Reflexion über die Unwiederbringlichkeit von Vergangenheit und Liebe, die der Sprecher in der Fremde als schmerzhafte Erinnerung erlebt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.