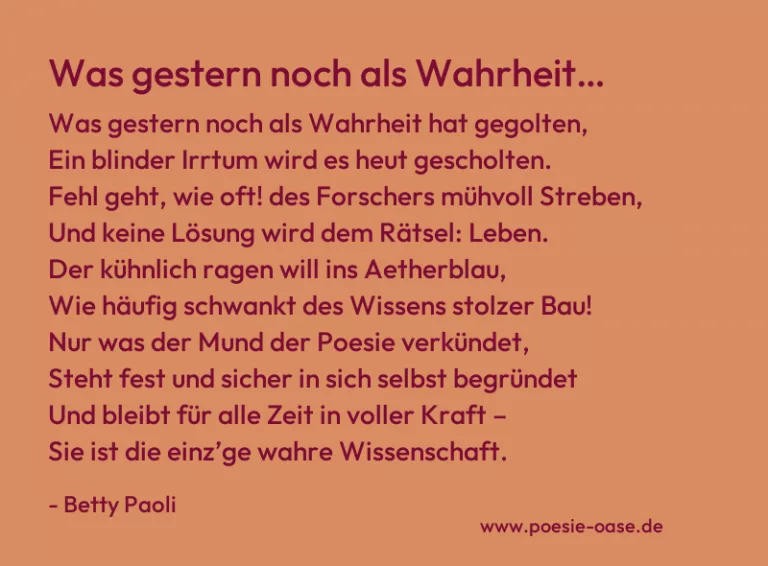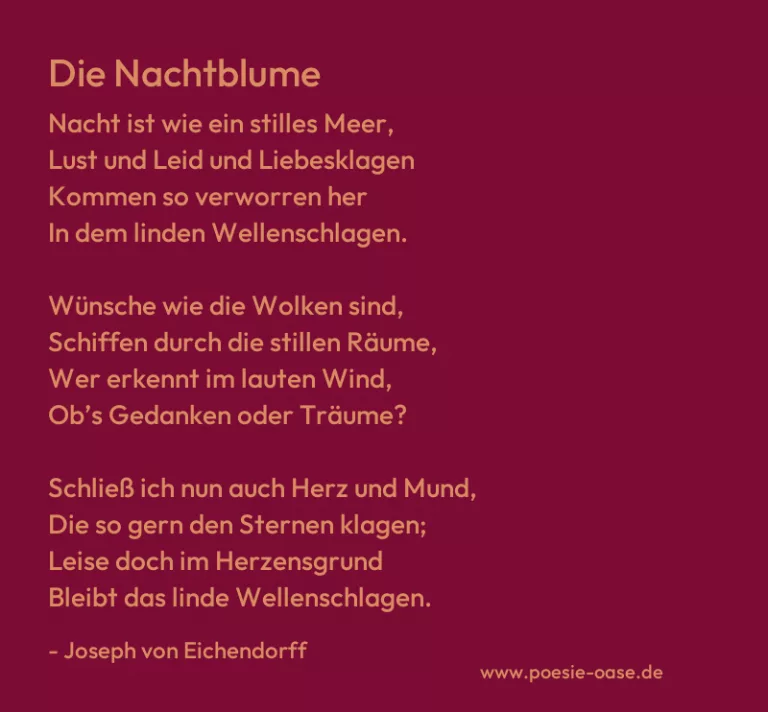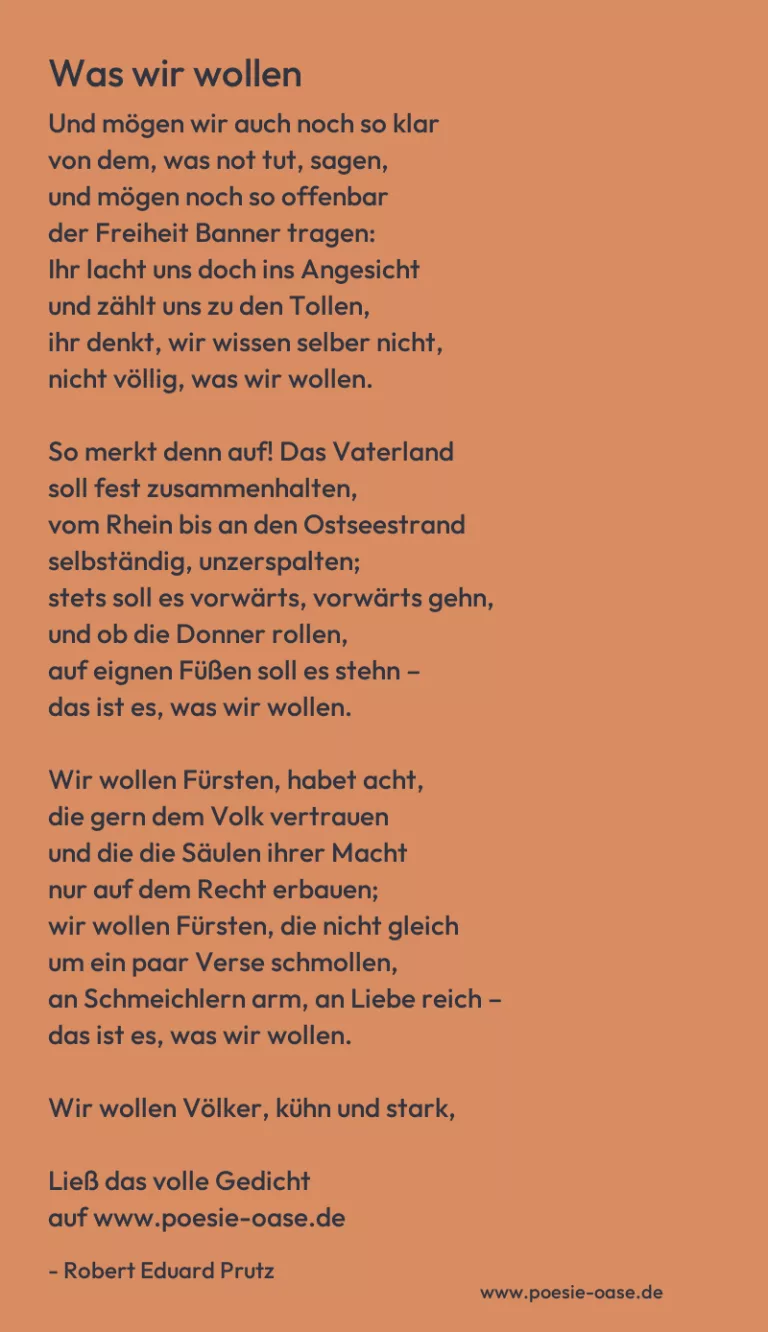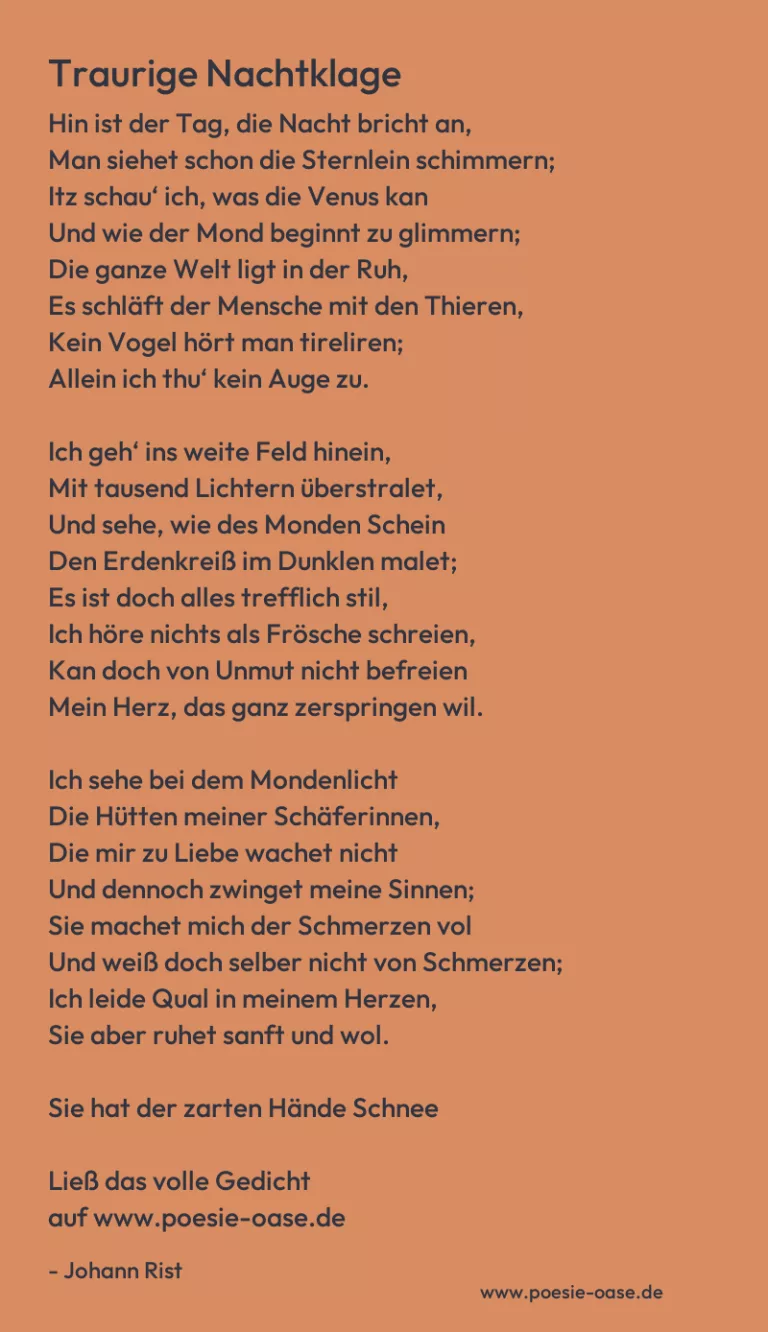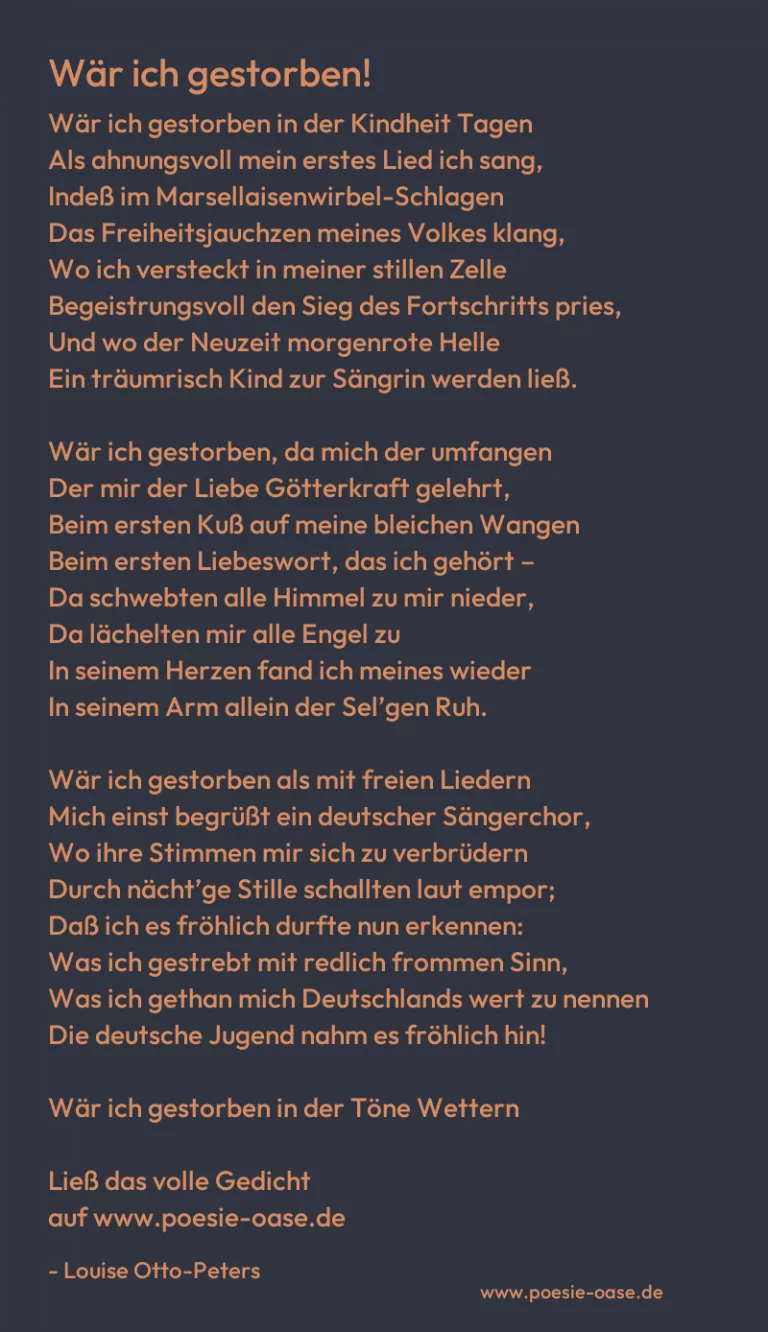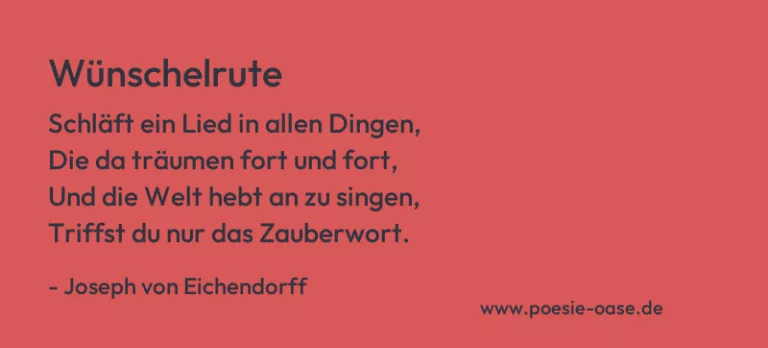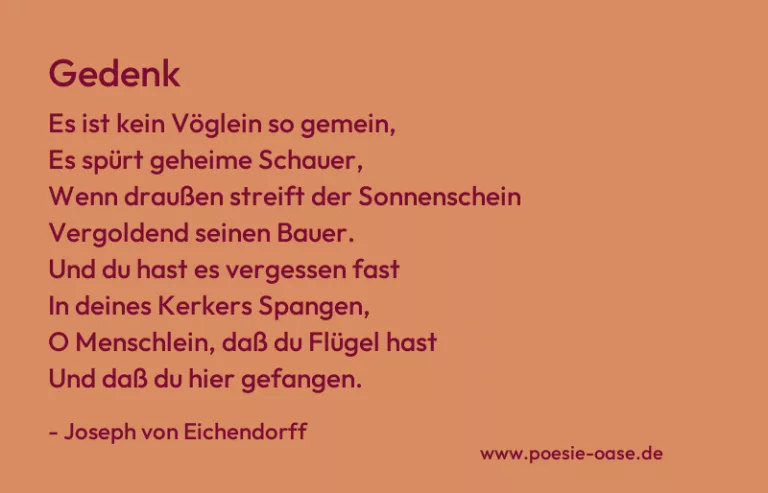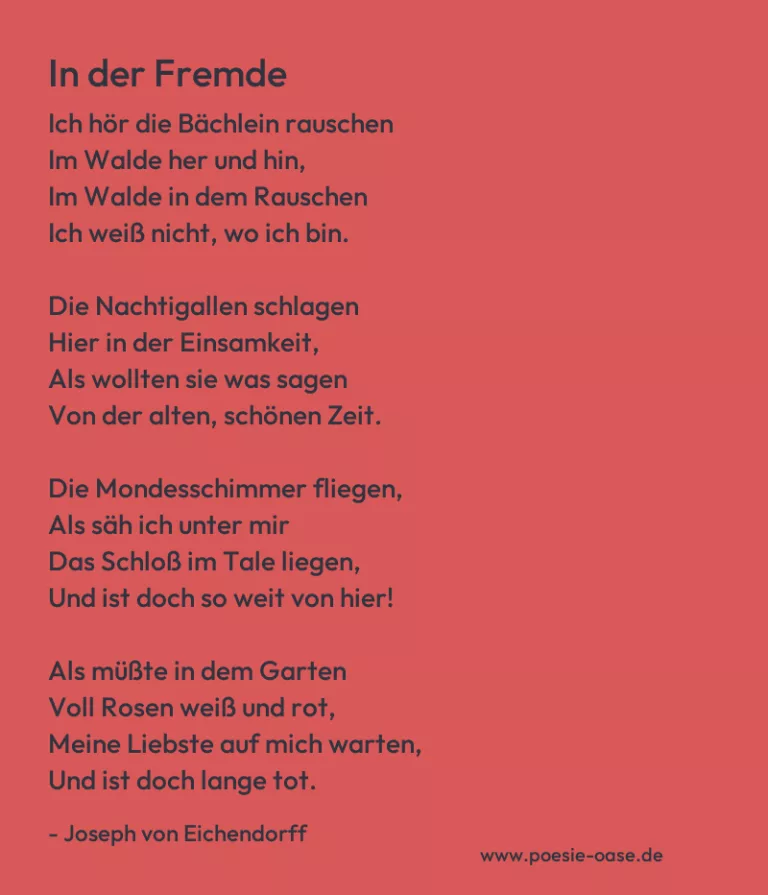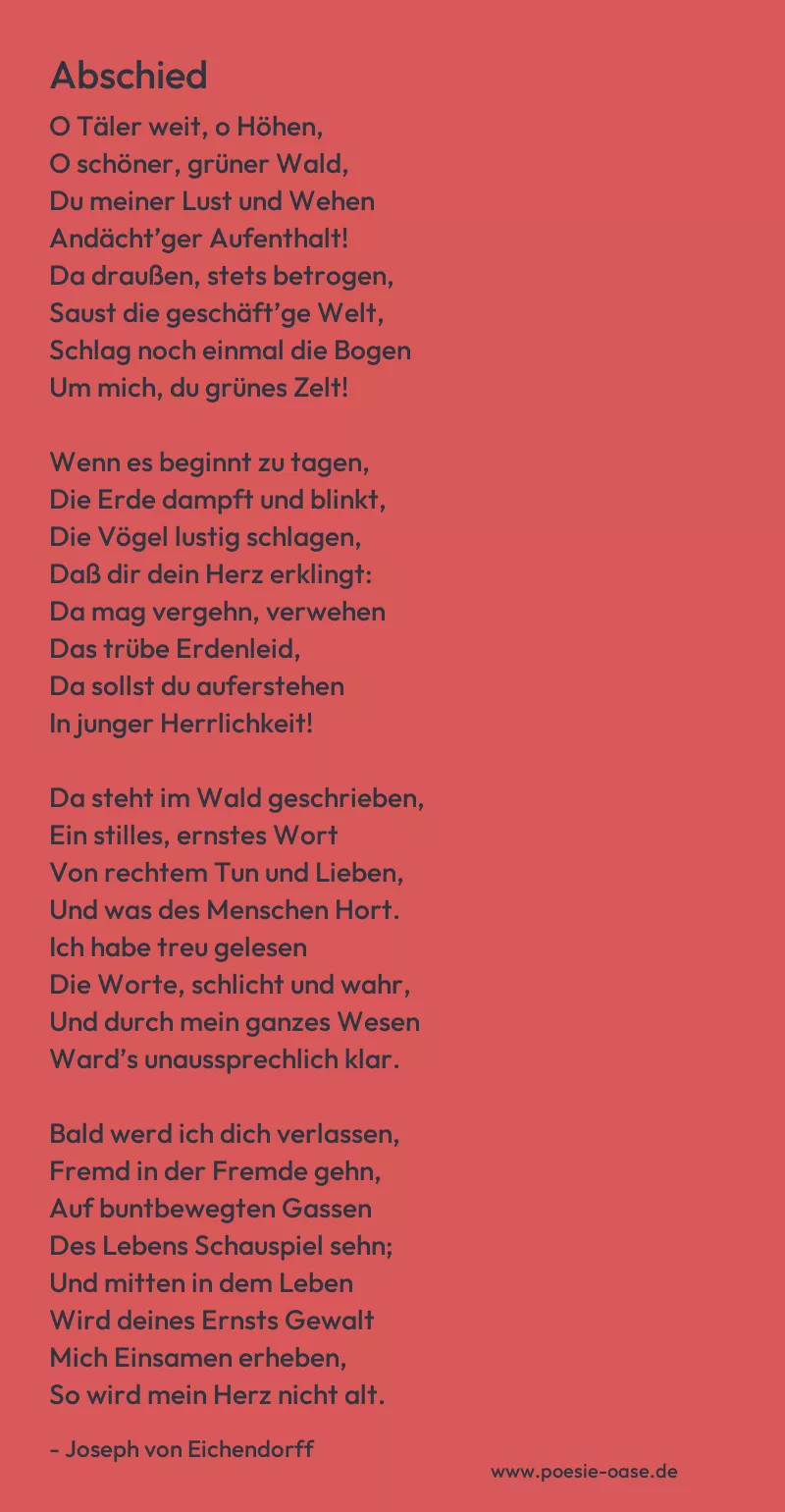Abenteuer & Reisen, Alltag, Berge & Täler, Geld, Gemeinfrei, Helden & Prinzessinnen, Krieg, Leidenschaft, Märchen & Fantasie, Mythen & Legenden, Natur
Abschied
O Täler weit, o Höhen,
O schöner, grüner Wald,
Du meiner Lust und Wehen
Andächt’ger Aufenthalt!
Da draußen, stets betrogen,
Saust die geschäft’ge Welt,
Schlag noch einmal die Bogen
Um mich, du grünes Zelt!
Wenn es beginnt zu tagen,
Die Erde dampft und blinkt,
Die Vögel lustig schlagen,
Daß dir dein Herz erklingt:
Da mag vergehn, verwehen
Das trübe Erdenleid,
Da sollst du auferstehen
In junger Herrlichkeit!
Da steht im Wald geschrieben,
Ein stilles, ernstes Wort
Von rechtem Tun und Lieben,
Und was des Menschen Hort.
Ich habe treu gelesen
Die Worte, schlicht und wahr,
Und durch mein ganzes Wesen
Ward’s unaussprechlich klar.
Bald werd ich dich verlassen,
Fremd in der Fremde gehn,
Auf buntbewegten Gassen
Des Lebens Schauspiel sehn;
Und mitten in dem Leben
Wird deines Ernsts Gewalt
Mich Einsamen erheben,
So wird mein Herz nicht alt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
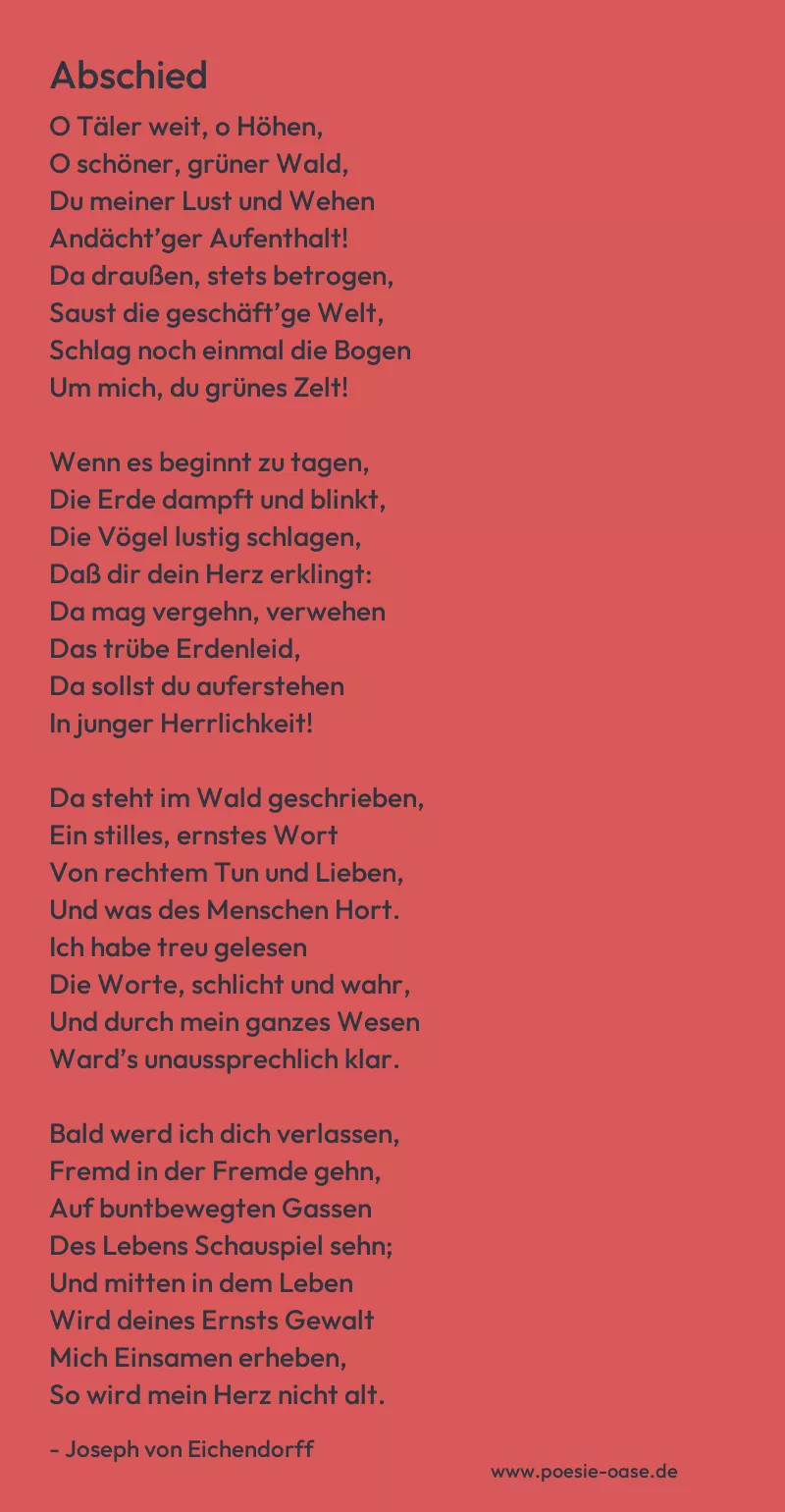
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Abschied“ von Joseph von Eichendorff ist ein poetisches Abschiednehmen von der Natur und zugleich ein Aufbruch in die Welt des Lebens. Zu Beginn des Gedichts beschreibt der Sprecher die Natur als „Täler weit“ und „grüner Wald“, der ihm sowohl Freude als auch Leid bietet und zu einem „andächtigen Aufenthalt“ wird. Die Natur wird hier als ein Ort des inneren Friedens und der Reflexion dargestellt, der als Zuflucht vor der „geschäft’gen Welt“ dient, die der Sprecher als betrügerisch und unbeständig empfindet. Das Bild des „grünen Zeltes“ verweist auf die Geborgenheit und Schutz, die die Natur ihm bietet, als würde sie ihn in ihren Schößling aufnehmen.
Im zweiten Abschnitt geht es um den Übergang von der Nacht zum Tag, der mit dem Erwachen der Erde und dem Singen der Vögel verbunden ist. Diese Morgendämmerung wird als Symbol für Erneuerung und Befreiung vom „trüben Erdenleid“ beschrieben. Die Natur wird zur Quelle der Inspiration und des Trostes, die dem Sprecher eine „junge Herrlichkeit“ verleiht – eine Art spirituelle Wiedergeburt. Die Schönheit der Natur und ihre Verbindung zum Leben bieten dem Sprecher eine Perspektive der Hoffnung und Erneuerung, die ihm hilft, die Lasten der Welt zu überwinden.
Im dritten Vers reflektiert der Sprecher über die tiefere Bedeutung, die er in der Natur und ihren „stillen, ernsten“ Botschaften gefunden hat. Die „Worte von rechtem Tun und Lieben“ sind für ihn eine Quelle der Weisheit, die ihm eine klare und einfache Wahrheit vermittelt hat. Die Natur wird hier zu einem Lehrer, dessen Lektionen durch das „ganzes Wesen“ des Sprechers aufgenommen werden. Diese innere Klarheit ist ein Ausdruck einer spirituellen Erkenntnis, die über die rein weltliche Erfahrung hinausgeht und zu einer höheren Wahrhaftigkeit führt.
Im letzten Abschnitt kündigt der Sprecher an, dass er die Natur verlassen und in die Welt hinausziehen wird, um sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Trotz des Aufbruchs bleibt die „Gewalt“ der Natur in ihm, die ihm hilft, in der Fremde nicht zu verarmen oder zu verhärten. Die Verbindung zur Natur bleibt bestehen und gibt ihm die Kraft, auch inmitten der turbulenten Welt des Lebens und der „buntbewegten Gassen“ des Lebens einen inneren Halt zu finden. Das Gedicht endet mit der Hoffnung, dass diese innere Stärke ihn jung und lebendig halten wird, selbst im Angesicht der Schwierigkeiten, die das Leben mit sich bringt.
Insgesamt ist Eichendorffs „Abschied“ ein Gedicht über die tiefgründige Verbindung zwischen Mensch und Natur. Es drückt die Sehnsucht aus, in der Natur Trost zu finden, und die Erkenntnis, dass diese Verbindung eine Quelle der inneren Kraft ist, die den Sprecher auf seinem Lebensweg begleitet. Es ist ein Abschied von einem Ort des Friedens, aber auch eine Bestärkung für die Reise, die vor ihm liegt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.