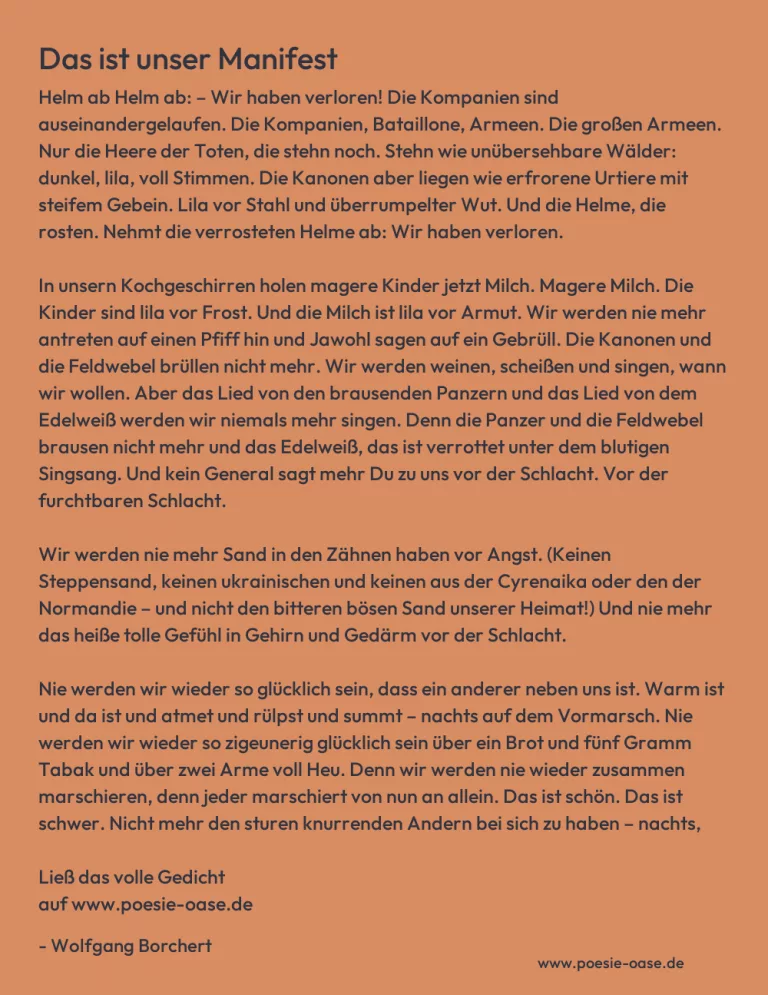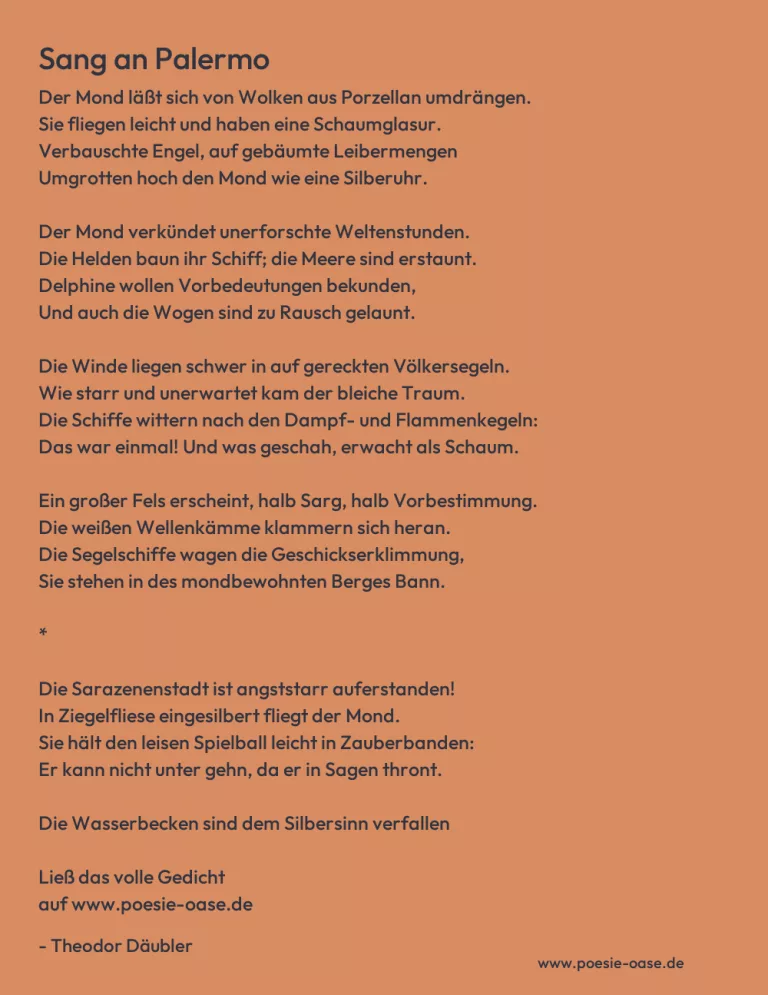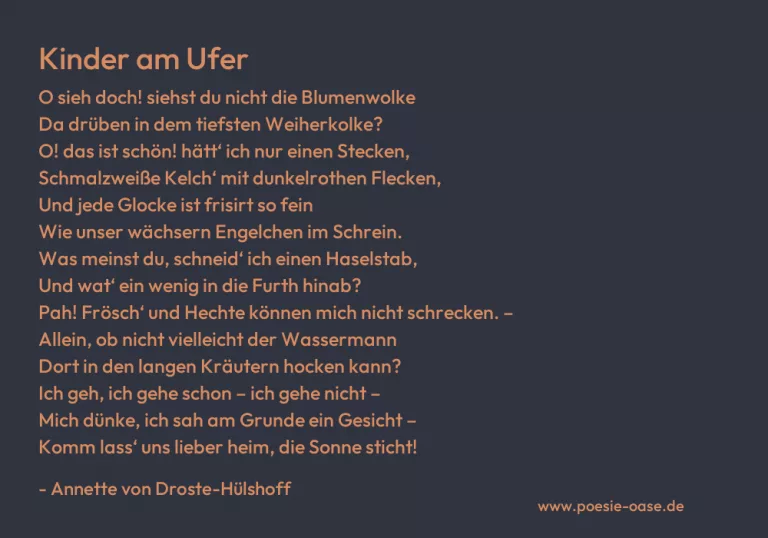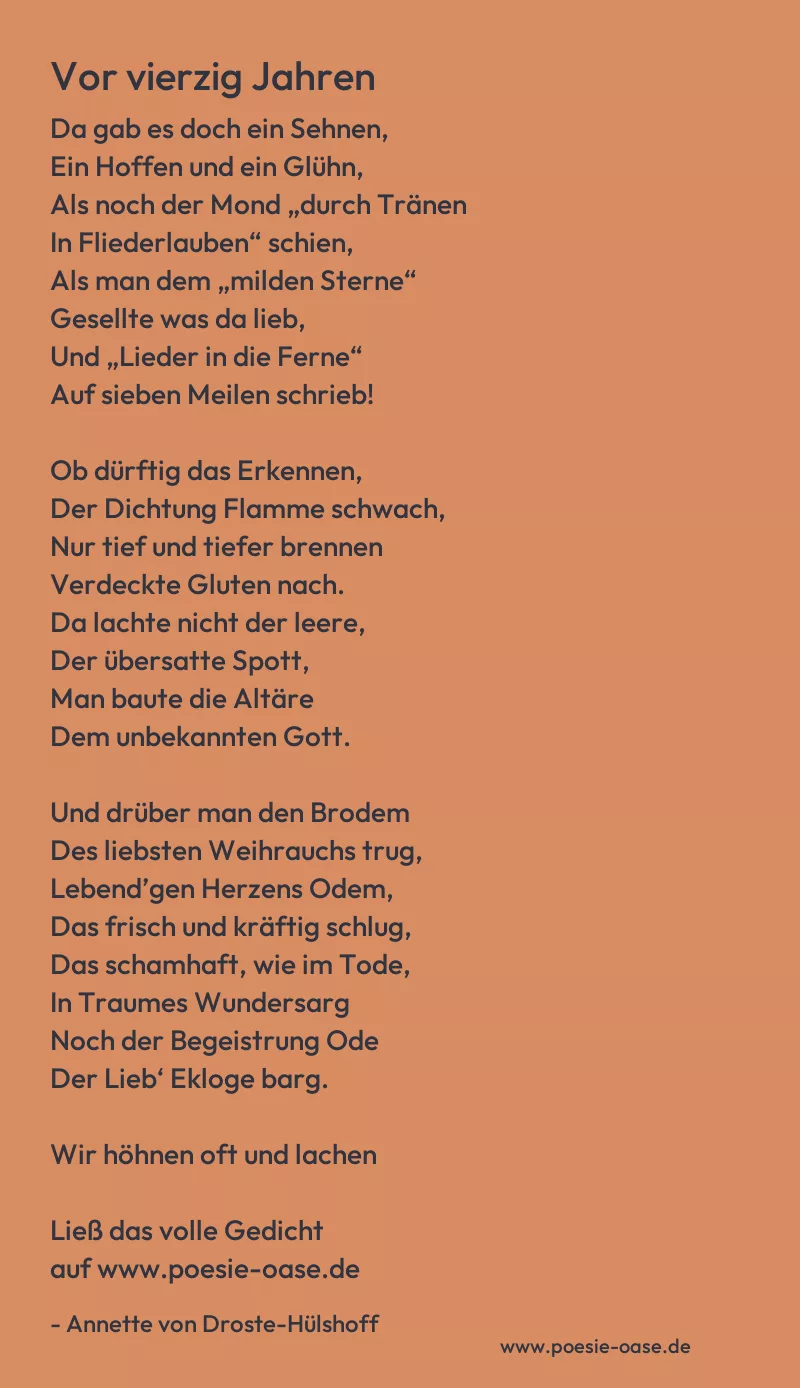Da gab es doch ein Sehnen,
Ein Hoffen und ein Glühn,
Als noch der Mond „durch Tränen
In Fliederlauben“ schien,
Als man dem „milden Sterne“
Gesellte was da lieb,
Und „Lieder in die Ferne“
Auf sieben Meilen schrieb!
Ob dürftig das Erkennen,
Der Dichtung Flamme schwach,
Nur tief und tiefer brennen
Verdeckte Gluten nach.
Da lachte nicht der leere,
Der übersatte Spott,
Man baute die Altäre
Dem unbekannten Gott.
Und drüber man den Brodem
Des liebsten Weihrauchs trug,
Lebend’gen Herzens Odem,
Das frisch und kräftig schlug,
Das schamhaft, wie im Tode,
In Traumes Wundersarg
Noch der Begeistrung Ode
Der Lieb‘ Ekloge barg.
Wir höhnen oft und lachen
Der kaum vergangnen Zeit,
Und in der Wüste machen
Wie Strauße wir uns breit.
Ist Wissen denn Besitzen?
Ist denn Genießen Glück?
Auch Eises Gletscher blitzen
Und Basiliskenblick.
Ihr Greise, die gesunken
Wie Kinder in die Gruft,
Im letzten Hauche trunken
Von Lieb‘ und Ätherduft,
Ihr habt am Lebensbaume
Die reinste Frucht gepflegt,
In karger Spannen Raume
Ein Eden euch gehegt.
Nun aber sind die Zeiten,
Die überwerten, da,
Wo offen alle Weiten,
Und jede Ferne nah.
Wir wühlen in den Schätzen,
Wir schmettern in den Kampf,
Windsbräuten gleich versetzen
Uns Geistesflug und Dampf.
Mit unsres Spottes Gerten
Zerhaun wir was nicht Stahl,
Und wie Morganas Gärten
Zerrinnt das Ideal;
Was wir daheim gelassen
Das wird uns arm und klein,
Was Fremdes wir erfassen
Wird in der Hand zu Stein.
Es wogt von End‘ zu Ende,
Es grüßt im Fluge her,
Wir reichen unsre Hände,
– Sie bleiben kalt und leer. –
Nichts liebend, achtend wen’ge
Wird Herz und Wange bleich,
Und bettelhafte Kön’ge
Stehn wir im Steppenreich.