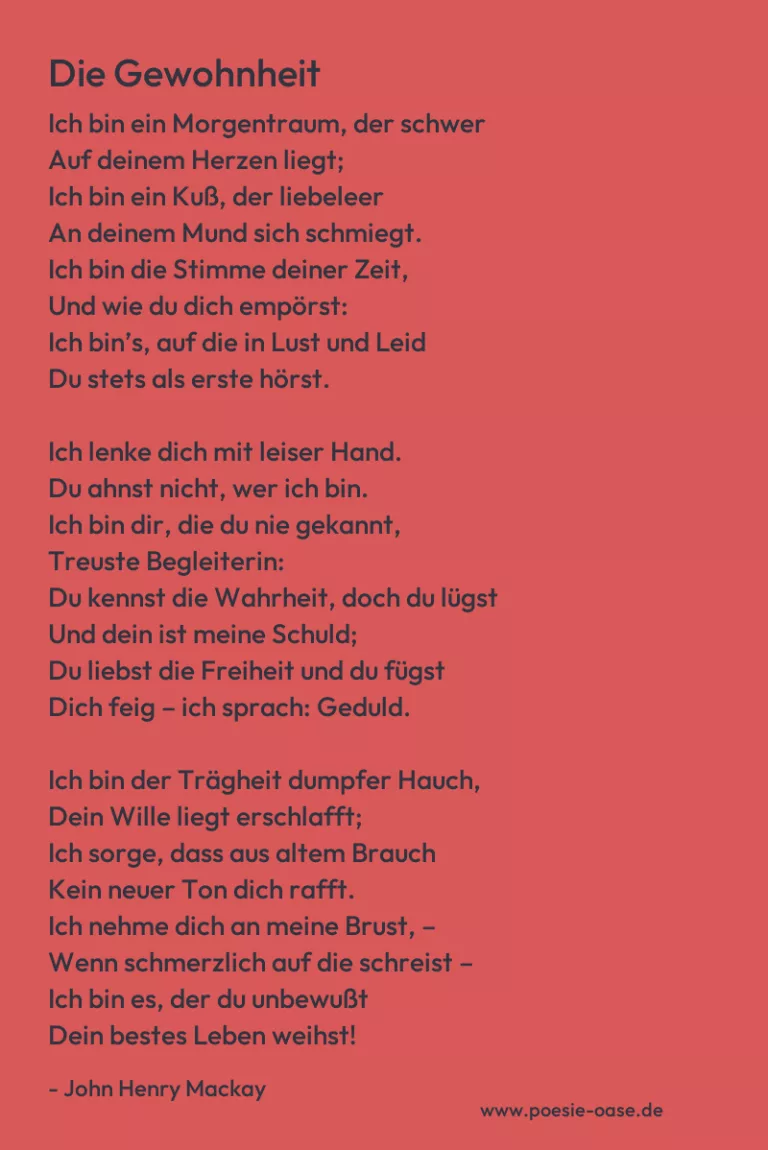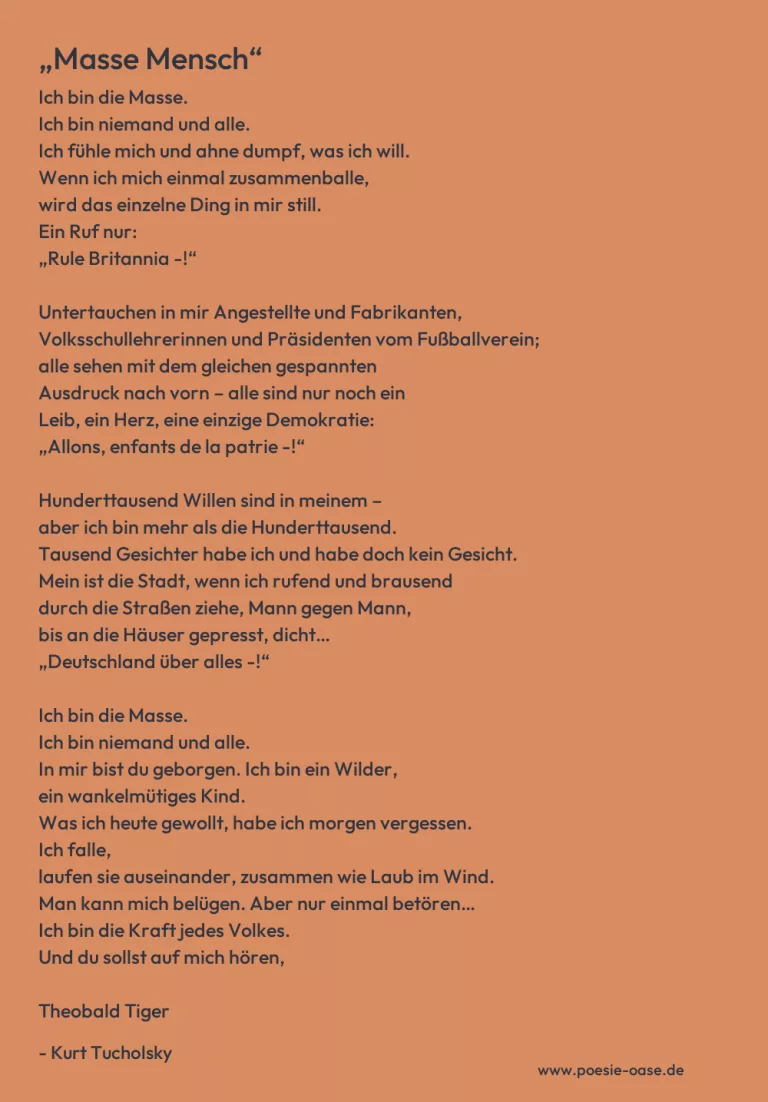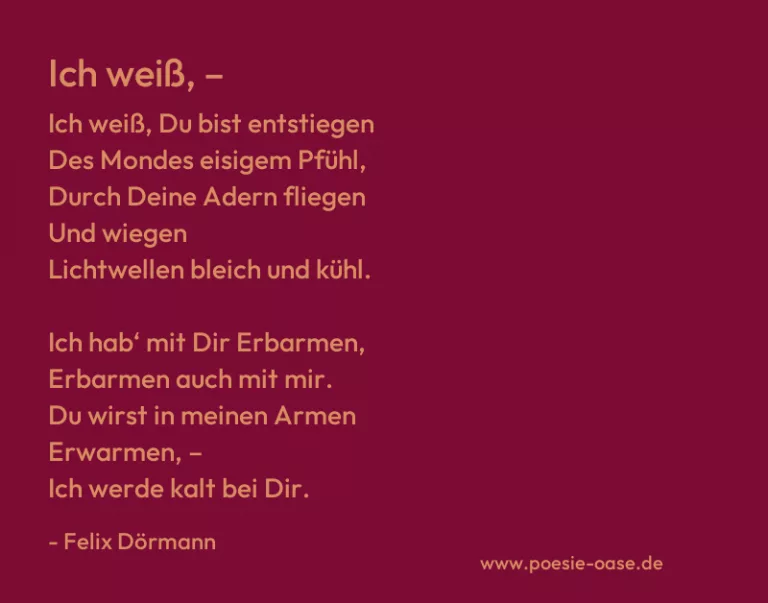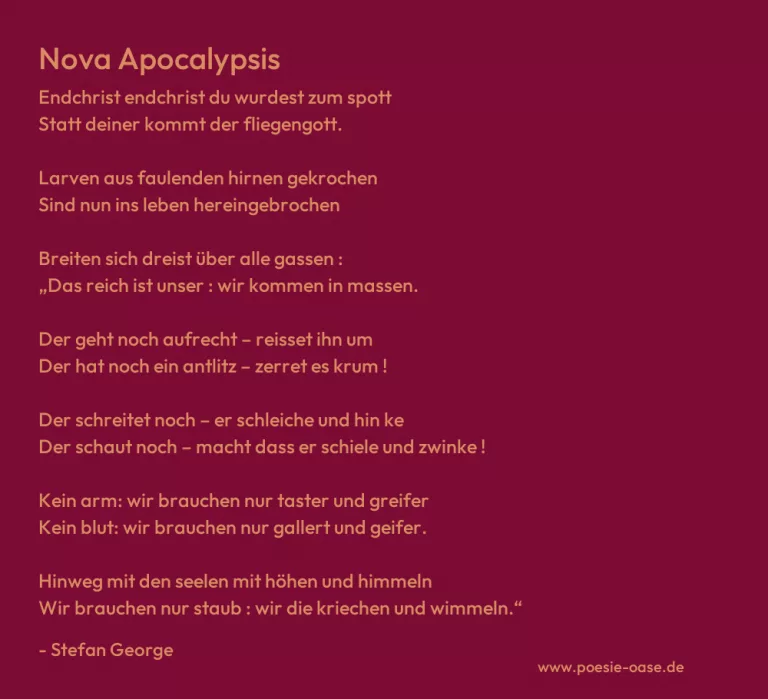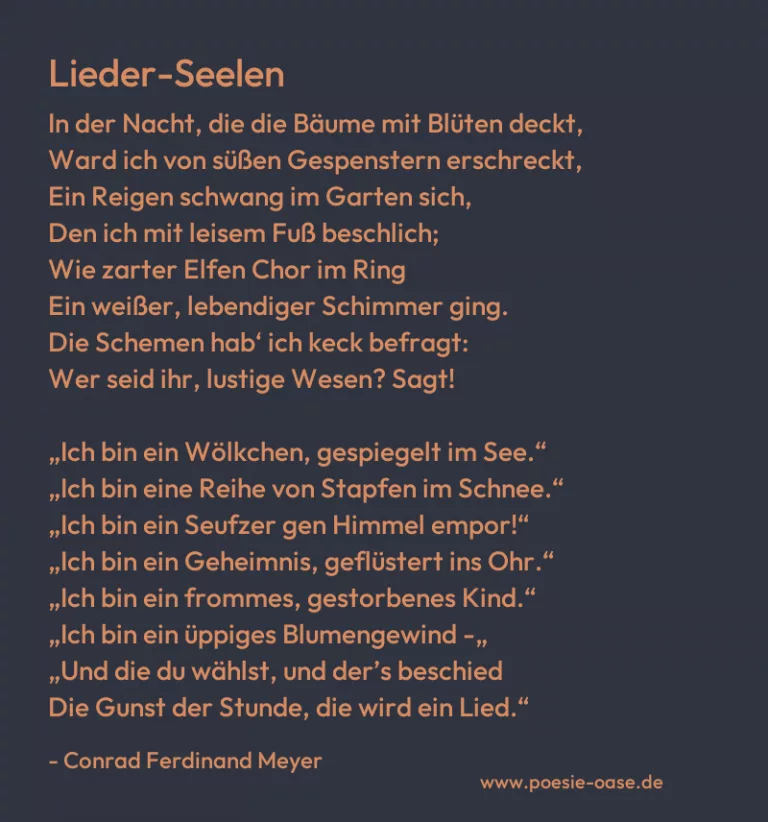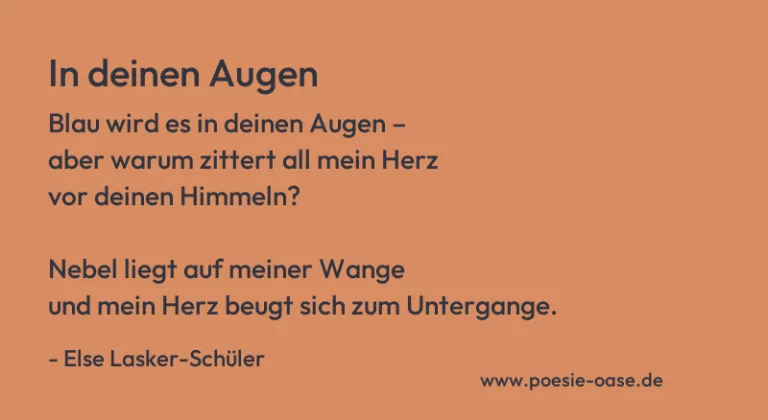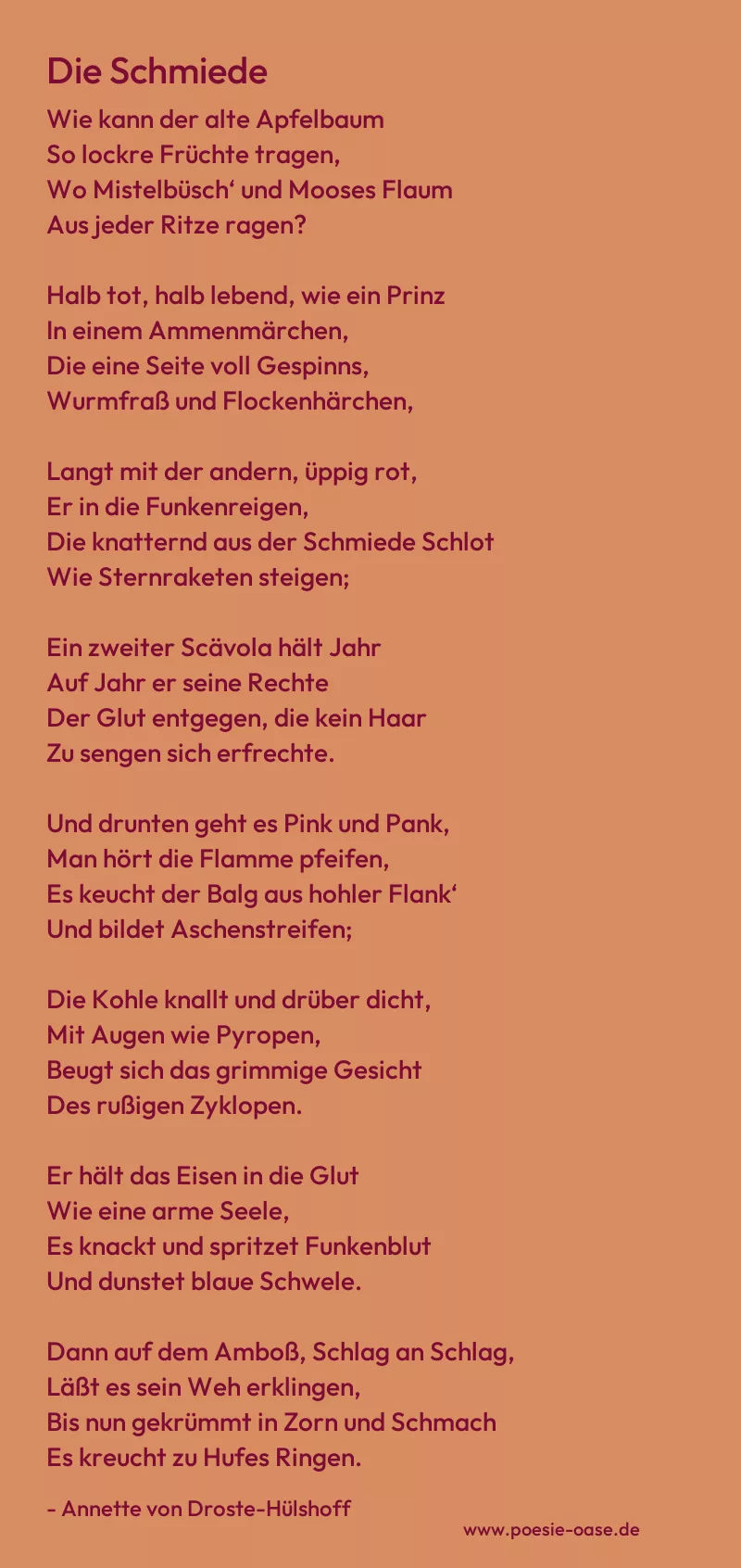Die Schmiede
Wie kann der alte Apfelbaum
So lockre Früchte tragen,
Wo Mistelbüsch‘ und Mooses Flaum
Aus jeder Ritze ragen?
Halb tot, halb lebend, wie ein Prinz
In einem Ammenmärchen,
Die eine Seite voll Gespinns,
Wurmfraß und Flockenhärchen,
Langt mit der andern, üppig rot,
Er in die Funkenreigen,
Die knatternd aus der Schmiede Schlot
Wie Sternraketen steigen;
Ein zweiter Scävola hält Jahr
Auf Jahr er seine Rechte
Der Glut entgegen, die kein Haar
Zu sengen sich erfrechte.
Und drunten geht es Pink und Pank,
Man hört die Flamme pfeifen,
Es keucht der Balg aus hohler Flank‘
Und bildet Aschenstreifen;
Die Kohle knallt und drüber dicht,
Mit Augen wie Pyropen,
Beugt sich das grimmige Gesicht
Des rußigen Zyklopen.
Er hält das Eisen in die Glut
Wie eine arme Seele,
Es knackt und spritzet Funkenblut
Und dunstet blaue Schwele.
Dann auf dem Amboß, Schlag an Schlag,
Läßt es sein Weh erklingen,
Bis nun gekrümmt in Zorn und Schmach
Es kreucht zu Hufes Ringen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
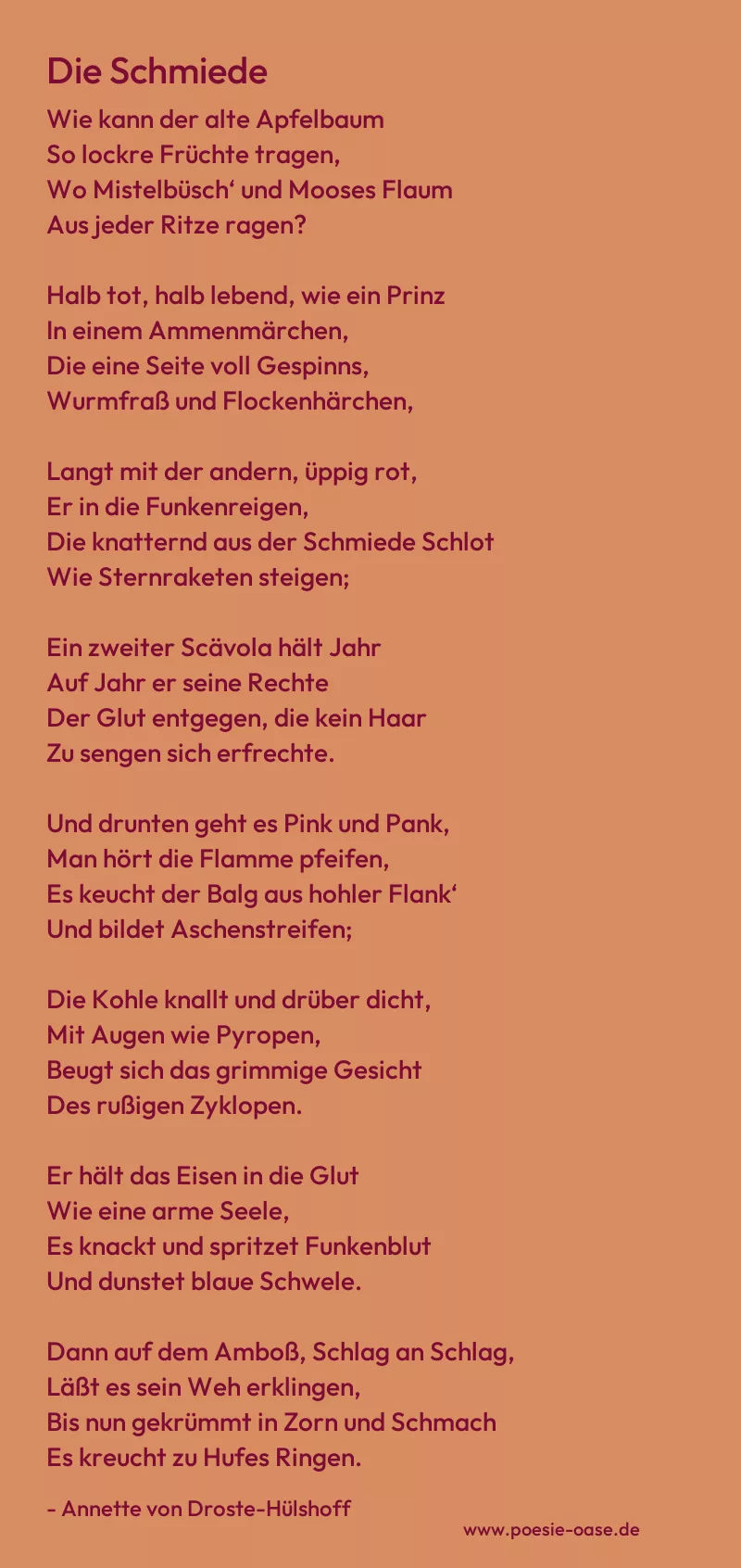
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Schmiede“ von Annette von Droste-Hülshoff ist ein kraftvolles und bildgewaltiges Werk, das die harte Arbeit und die Transformation des Materials in der Schmiede beschreibt. In einer Mischung aus Naturmetaphern und mythologischen Anklängen wird die Schmiedekunst als ein alchemistischer Prozess dargestellt, der sowohl mit Schöpfung als auch mit Zerstörung verbunden ist. Die Metaphorik des alten Apfelbaums und der Schmiede wird genutzt, um die Spannungen zwischen Leben und Tod, zwischen Schönheit und Zerstörung darzustellen.
Zu Beginn des Gedichts wird der alte Apfelbaum als Symbol für das Leben und den Verfall beschrieben. Der Baum ist „halb tot, halb lebend“ und trägt „lockre Früchte“, die von „Mistelbüsch“ und „Mooses Flaum“ umgeben sind. Diese Darstellung verweist auf das Leben in seiner ganzen Ambivalenz: Einerseits gibt der Baum Früchte, andererseits ist er von Verfall und Krankheit befallen. Das Bild des Baumes als „Prinz in einem Ammenmärchen“ verweist auf das Märchenhafte und die Verwandlungskraft, die sowohl im Leben als auch im Verfall wirkt. Diese Spannung zwischen Leben und Tod zieht sich wie ein roter Faden durch das Gedicht.
Im zweiten Teil des Gedichts wird die Schmiede als ein Ort beschrieben, an dem Transformation und Zerstörung miteinander verschmelzen. Der Schmied, dargestellt als ein „grimmiger Zyklop“, der mit einer „armen Seele“ das glühende Eisen bearbeitet, wird zu einer fast übermenschlichen Figur. Der Vorgang des Schmiedens ist mit einer mystischen und fast höllischen Energie aufgeladen: Die „Funken“ steigen wie „Sternraketen“ in die Luft, und das Eisen „knackt und spritzet Funkenblut“, was den dramatischen, gefährlichen Charakter des Schöpfungsprozesses unterstreicht.
Die Schmiede wird durch das Bild des „grimmigen Gesichts“ des Zyklopen und der glühenden Kohle als eine Art düsterer Schöpfungsort dargestellt. Hier ist der Prozess der Verwandlung nicht nur ein kreativer Akt, sondern auch ein Akt der Gewalt, der das Material zwingt, seine Form zu verändern. Die Kohle und das glühende Eisen sind Symbole für das feurige Element der Zerstörung und der Erneuerung, das im Schmiedehandwerk seine Parallele findet. Der Schmied selbst steht als Symbol für den kreativen Künstler, der sich in der Arbeit mit dem Material transformiert und gleichzeitig das Material transformiert.
Am Ende des Gedichts, wenn das Eisen „gekümmert“ und „in Zorn und Schmach“ zu „Hufes Ringen“ gekrümmt ist, wird die Schmiedearbeit als ein Werk des Leidens und der Qual dargestellt. Das Eisen, das nun geformt ist, trägt die Spuren des Leidens und der Transformation, die es durch den Prozess der Schmiedekunst erfahren hat. In diesem Bild wird das Schmieden zur Metapher für das Leben selbst – ein ständiger Prozess der Veränderung, des Kampfes und der Schöpfung, der oft von Zerstörung begleitet wird. Das Gedicht endet somit mit einem Bild der Ambivalenz: Der Schöpfungsprozess ist zugleich ein Akt des Leidens und der Zerstörung, aber auch der Erneuerung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.