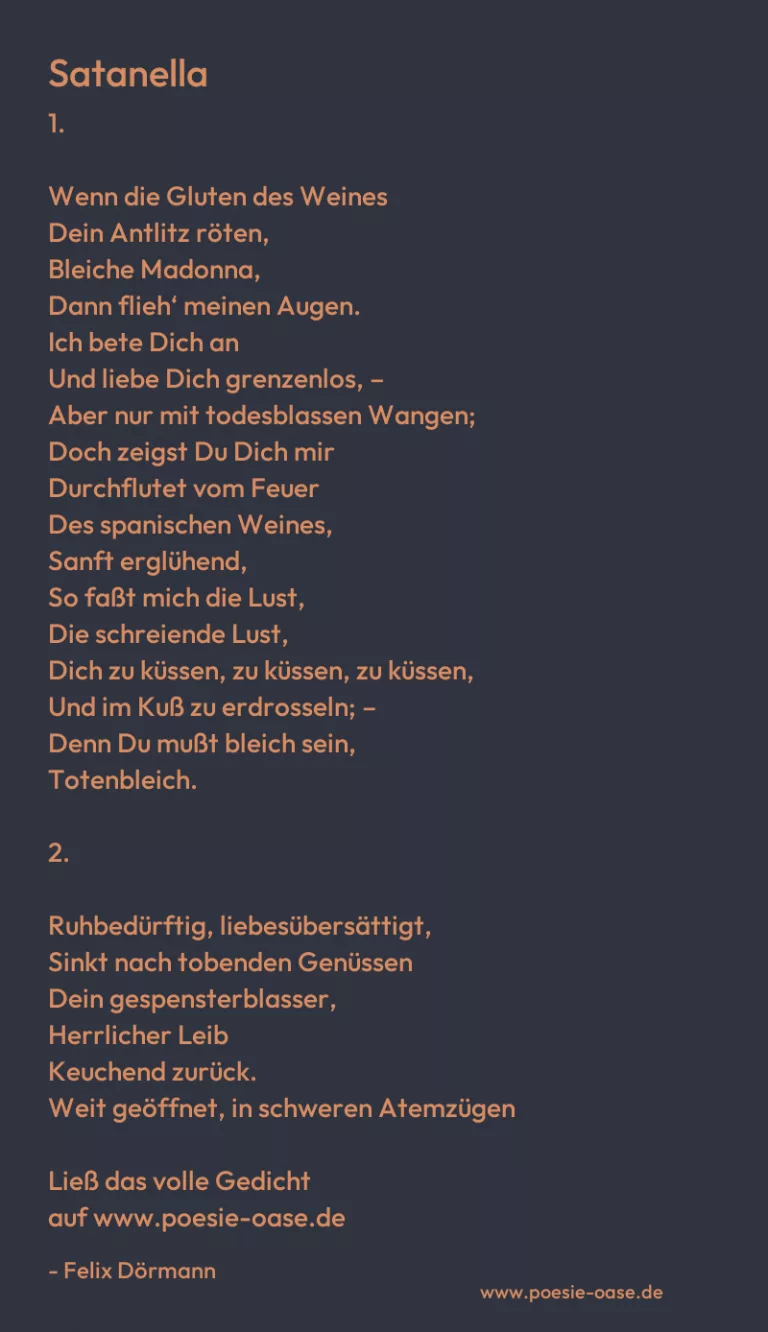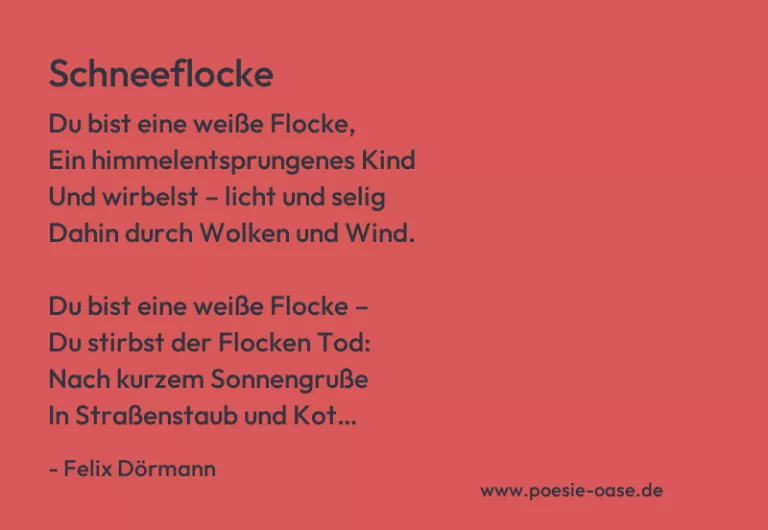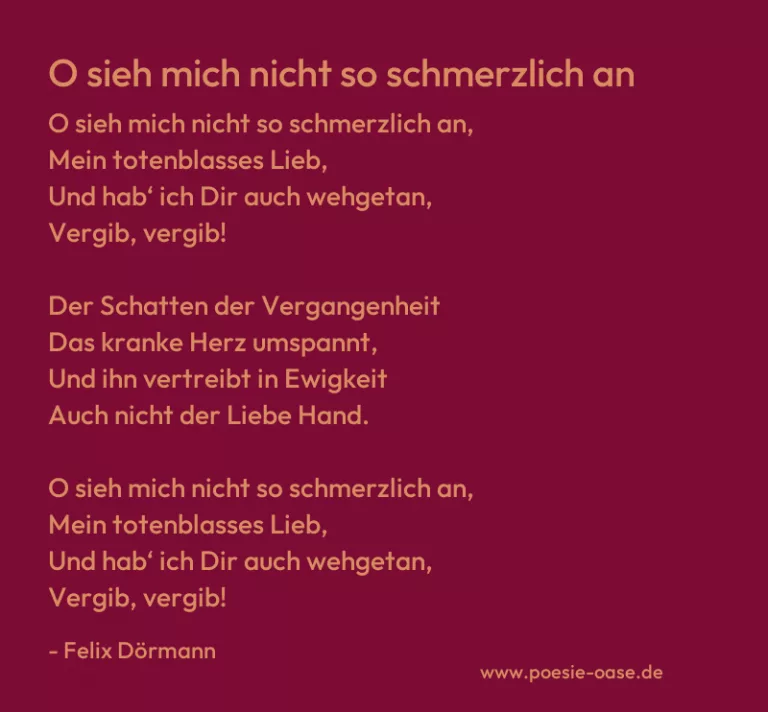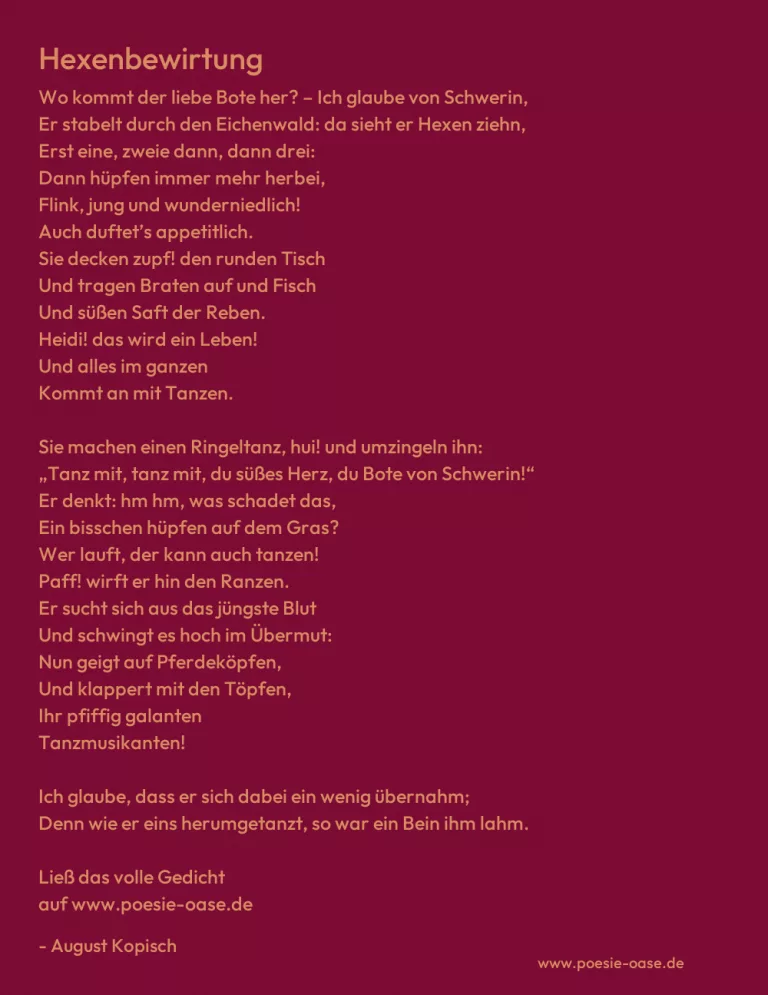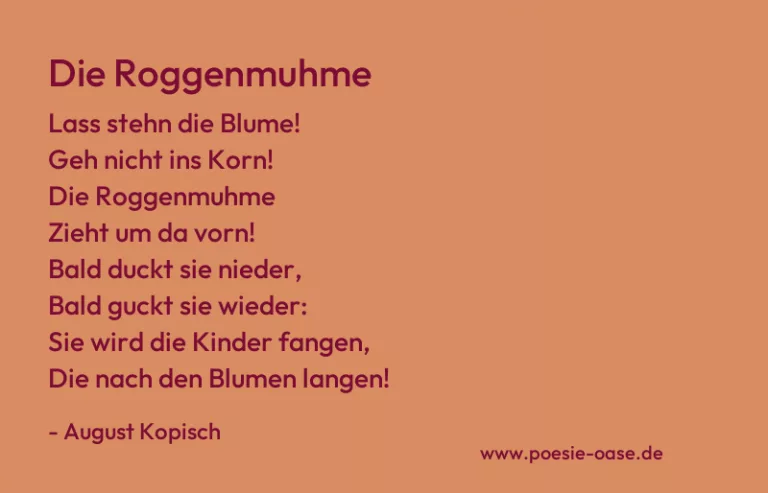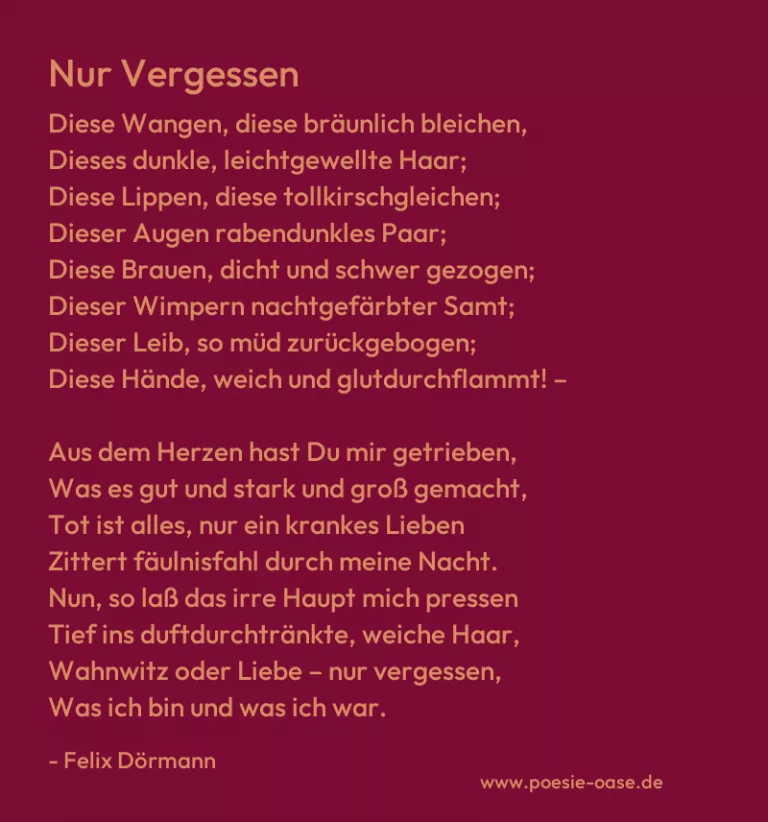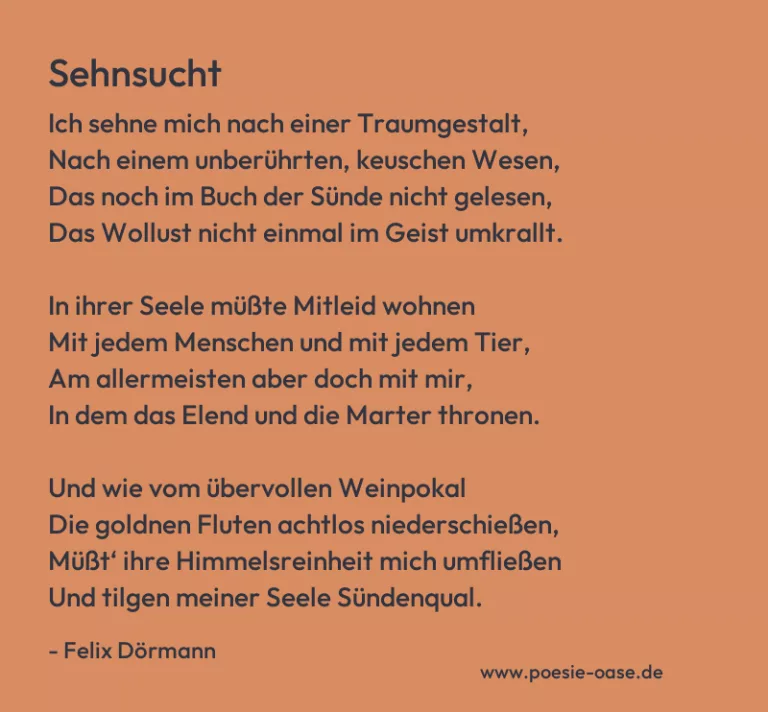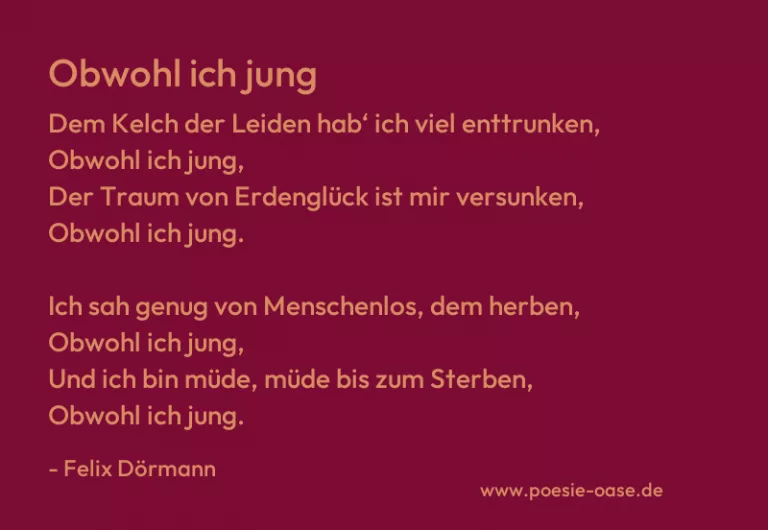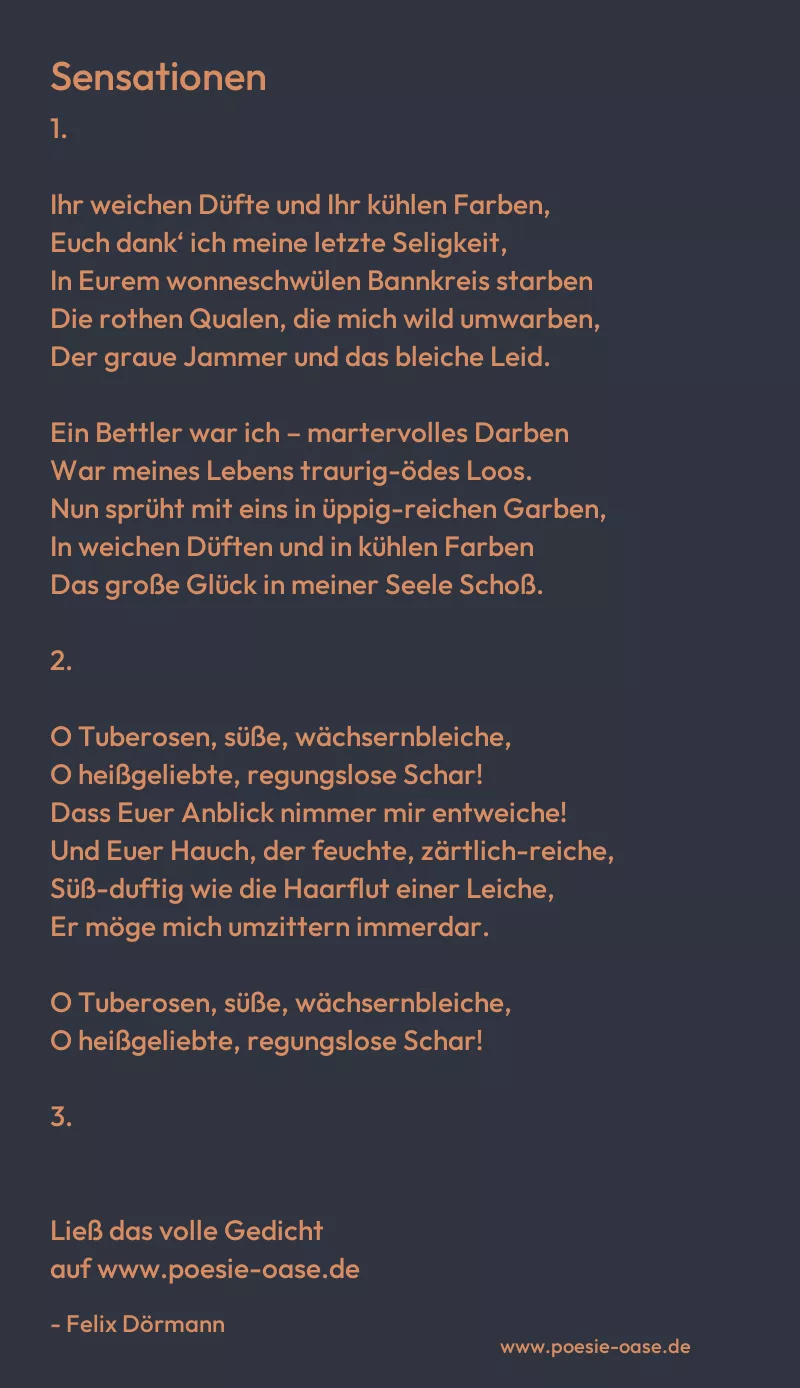1.
Ihr weichen Düfte und Ihr kühlen Farben,
Euch dank‘ ich meine letzte Seligkeit,
In Eurem wonneschwülen Bannkreis starben
Die rothen Qualen, die mich wild umwarben,
Der graue Jammer und das bleiche Leid.
Ein Bettler war ich – martervolles Darben
War meines Lebens traurig-ödes Loos.
Nun sprüht mit eins in üppig-reichen Garben,
In weichen Düften und in kühlen Farben
Das große Glück in meiner Seele Schoß.
2.
O Tuberosen, süße, wächsernbleiche,
O heißgeliebte, regungslose Schar!
Dass Euer Anblick nimmer mir entweiche!
Und Euer Hauch, der feuchte, zärtlich-reiche,
Süß-duftig wie die Haarflut einer Leiche,
Er möge mich umzittern immerdar.
O Tuberosen, süße, wächsernbleiche,
O heißgeliebte, regungslose Schar!
3.
In grauer Flut ist mir die Welt versunken,
Ein nebeltrübes, ödes Traumgebild,
Und farbenjauchzend, schwerer Düfte trunken
Die neue Welt aus meiner Seele quillt. –
O Silberlila, Deine weichen Wellen,
Wie Kinderseelen lilienkeusch und klar,
In meine flammenmüde Seele quellen,
Und meine Seele wird zum Hochaltar,
Wo Jubelhymnen Deiner Süße schwellen.
4.
O lasst mich, lasst mich ruh’n auf grünem Rasen,
In seinen Farbenzauber mich versenken,
Entfliehen allem qualvoll-heißen Denken
Zu meiner Seele schweigenden Extasen.
O lichtes Grün, wie Du die Seele weitest,
Um jede Nervenfaser zärtlich kost,
In’s Unermess’ne das Gefühl verbreitest,
O lichtes Wiesengrün – mein treuer Trost.
Wenn meine Seele sich vor Grausen sträubet,
Wenn alles öd und ekel ist geworden,
Wenn Qual und Sehnsucht jedes Glück ermorden,
Dein sanfter Schleier einzig sie betäubet.