Dein Auge glüht und funkelt
Wie Morgensonnenlicht,
Und meines, qualenverdunkelt,
Von fressendem Elend spricht.
Was treibt den asketischen Schwärmer
Zu Deines Daseins Pracht?
Er kehrt ja nur schroffer und ärmer
Zurück in die heimische Nacht!
Dein Auge glüht und funkelt
Wie Morgensonnenlicht,
Und meines, qualenverdunkelt,
Von fressendem Elend spricht.
Was treibt den asketischen Schwärmer
Zu Deines Daseins Pracht?
Er kehrt ja nur schroffer und ärmer
Zurück in die heimische Nacht!
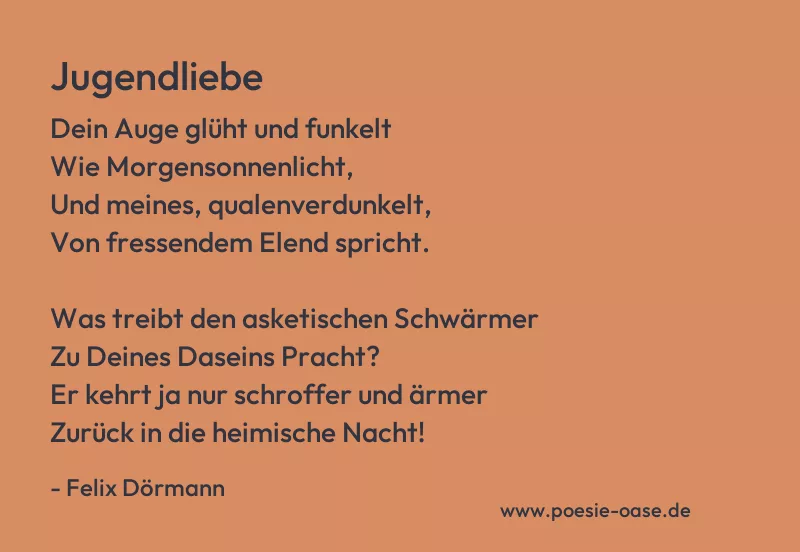
Das Gedicht „Jugendliebe“ von Felix Dörmann thematisiert die Kontraste zwischen jugendlicher Leidenschaft und der Realität von Schmerz und Entbehrung. Die erste Strophe stellt zwei gegensätzliche Blickwinkel gegenüber: Das „glühende und funkelnde“ Auge des Geliebten, das mit Energie und Lebensfreude strahlt, wird dem „qualenverdunkelten“ Auge des Sprechers gegenübergestellt. Das Auge des Sprechers ist von „fressendem Elend“ gezeichnet, was auf tiefe innere Qualen, möglicherweise durch unerwiderte Liebe oder das Fehlen von Erfüllung, hinweist. Die Dunkelheit des Sprechers steht in starkem Kontrast zur Helligkeit und Unbeschwertheit des Geliebten, was die Entfremdung zwischen den beiden Figuren verdeutlicht.
In der zweiten Strophe wird der „asketische Schwärmer“ als eine Person beschrieben, die in ihrer Zuneigung zu einem Ideal lebt, das im Widerspruch zur Realität steht. Der Schwärmer strebt nach einer „Pracht“, die das Leben seines Geliebten widerspiegelt – eine Pracht, die jedoch nur zu einem noch größeren Verlust führt. Der Schwärmer „kehrt schroffer und ärmer“ zurück in die „heimische Nacht“, was bedeutet, dass er, trotz seines Strebens nach Schönheit und Erfüllung, immer wieder von der tristen Realität eingeholt wird. Diese Rückkehr in die Dunkelheit der Nacht könnte als Symbol für den Rückzug in das Alltägliche und Enttäuschende nach der Erhebung in eine idealisierte, unerreichbare Liebe verstanden werden.
Das Gedicht drückt die Spannung zwischen Idealismus und Realität aus. Während die Jugendliebe und die Suche nach Schönheit anziehend wirken, zeigen die letzten Zeilen die Ernüchterung und das schmerzhafte Zurückkommen in die Realität. Der „asketische Schwärmer“ gibt alles für eine Liebe oder ein Ideal, das ihm nicht gerecht wird, und verliert dabei seine ursprüngliche Unschuld und Hoffnung. Die Existenz des Sprechers ist von Schmerz und Enttäuschung durchzogen, was eine düstere, fast tragische Sichtweise auf die Liebe und das Leben insgesamt vermittelt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.