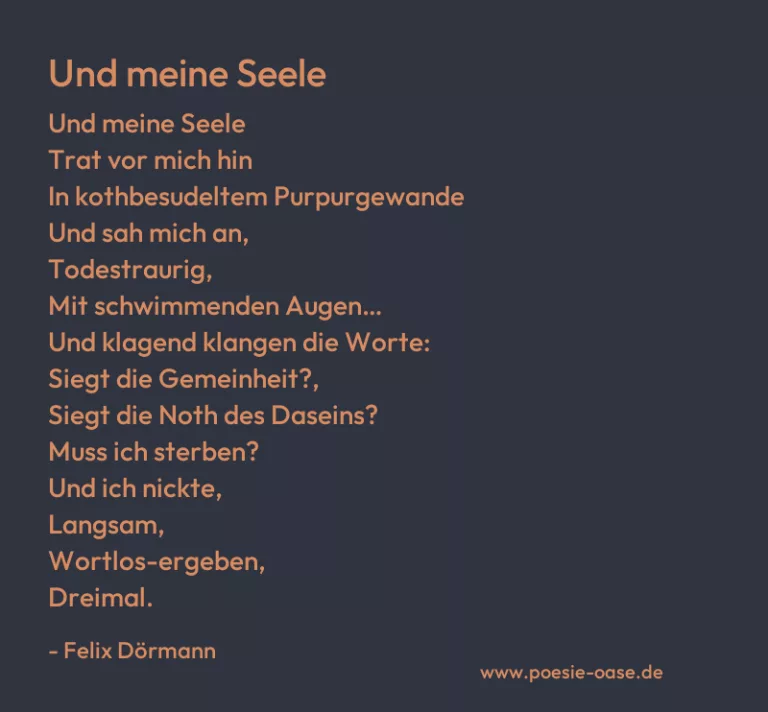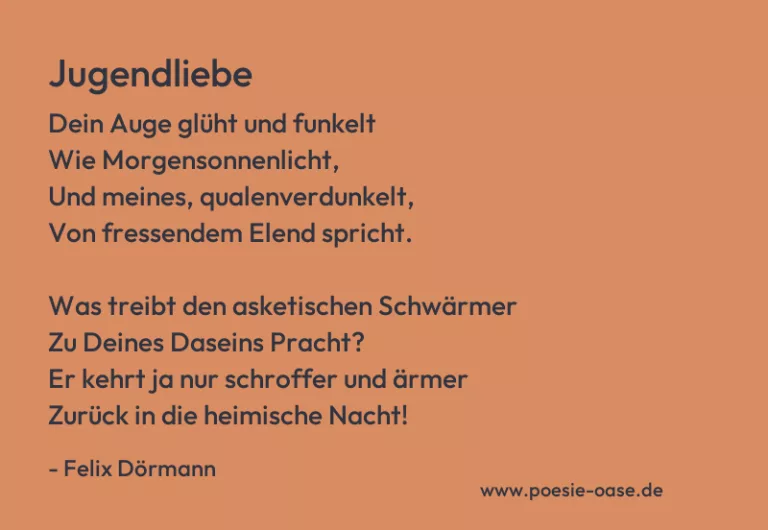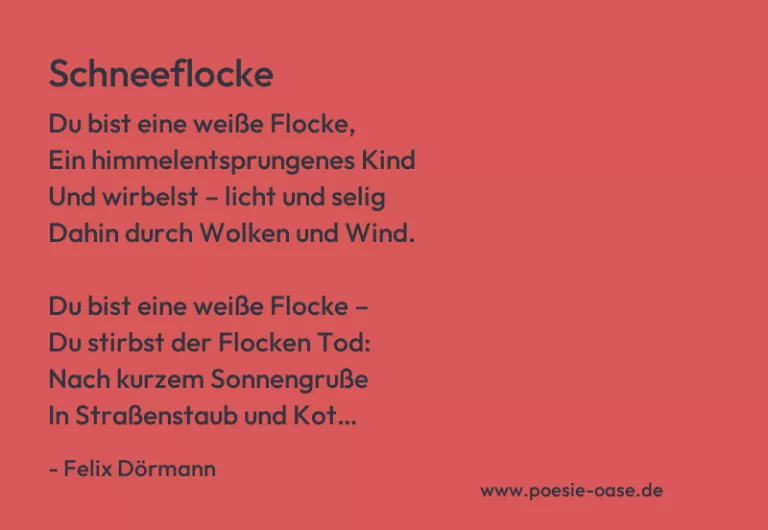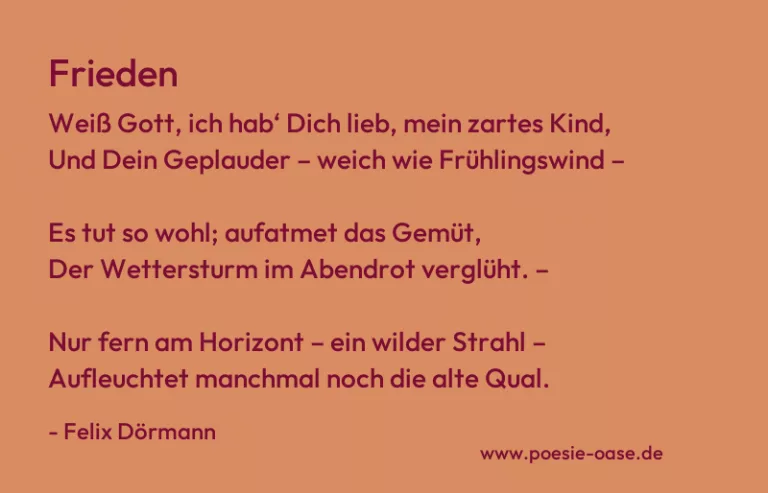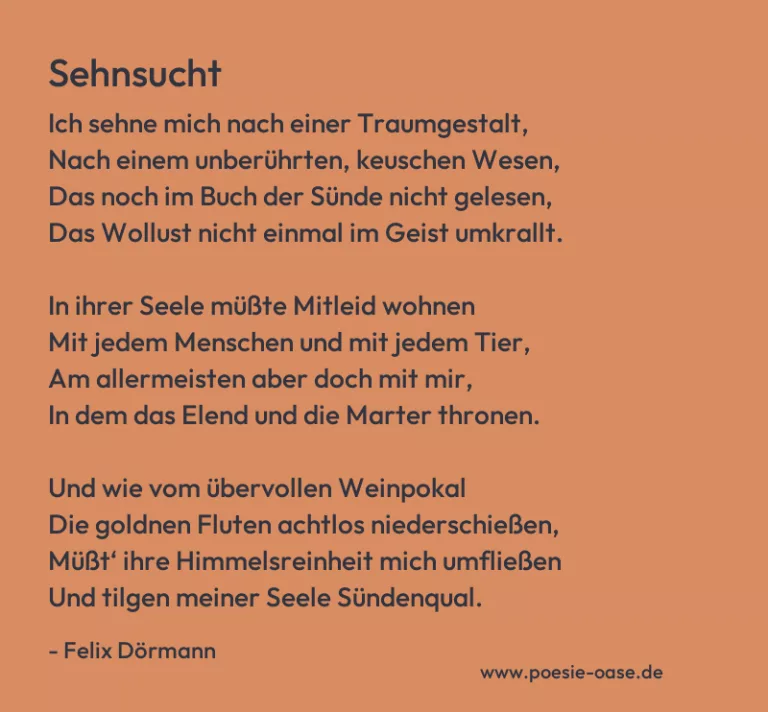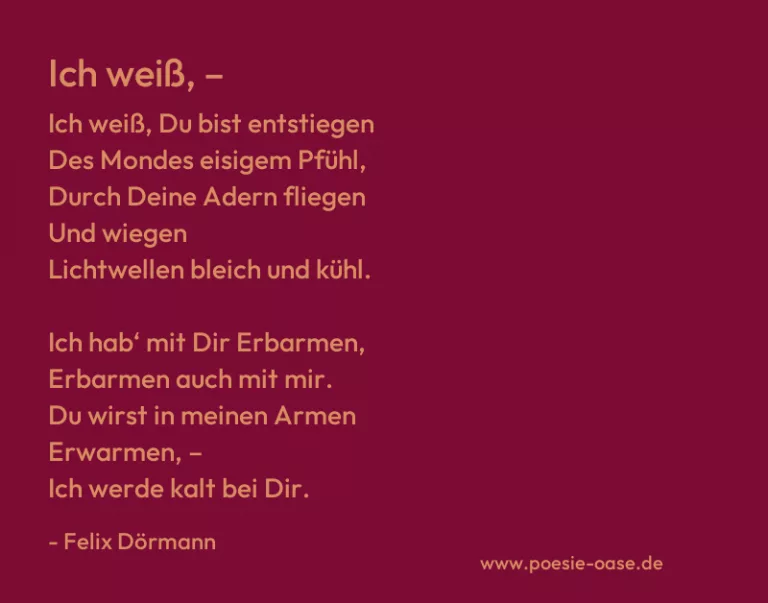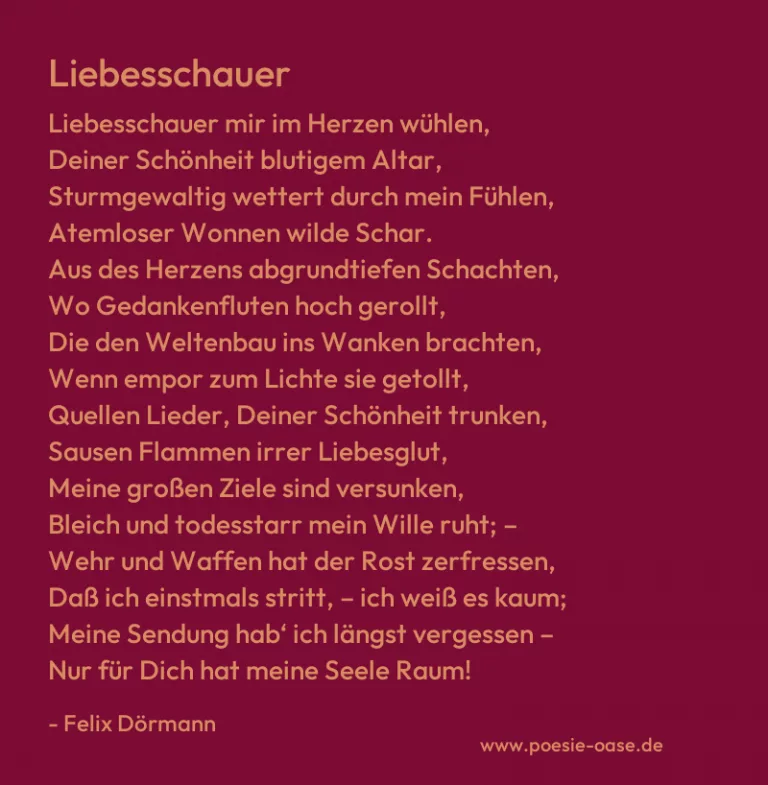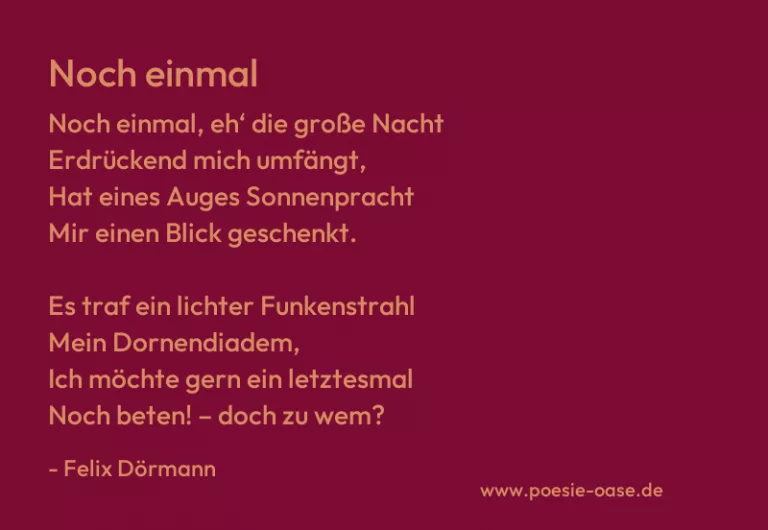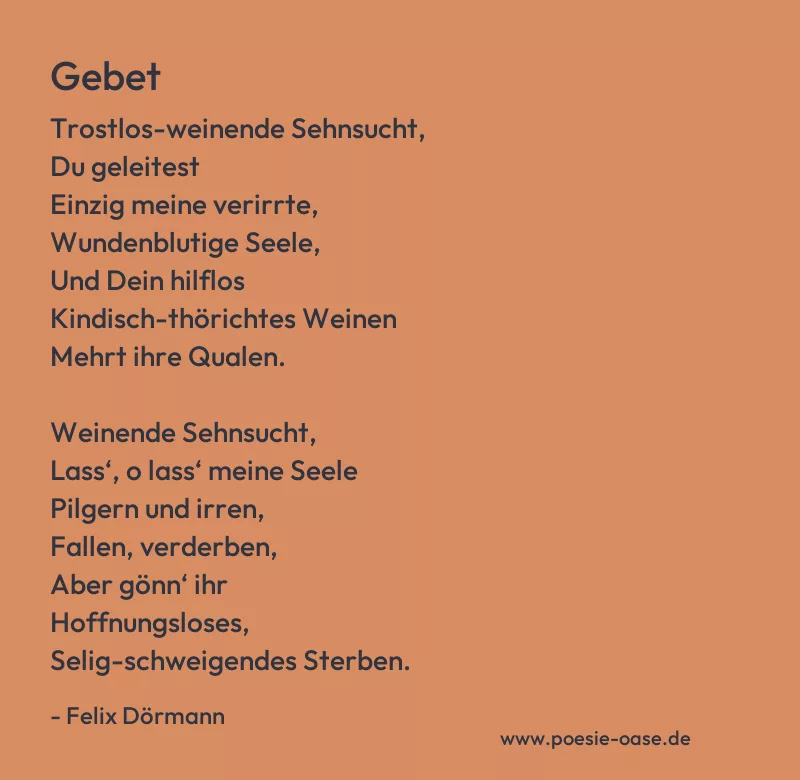Gebet
Trostlos-weinende Sehnsucht,
Du geleitest
Einzig meine verirrte,
Wundenblutige Seele,
Und Dein hilflos
Kindisch-thörichtes Weinen
Mehrt ihre Qualen.
Weinende Sehnsucht,
Lass‘, o lass‘ meine Seele
Pilgern und irren,
Fallen, verderben,
Aber gönn‘ ihr
Hoffnungsloses,
Selig-schweigendes Sterben.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
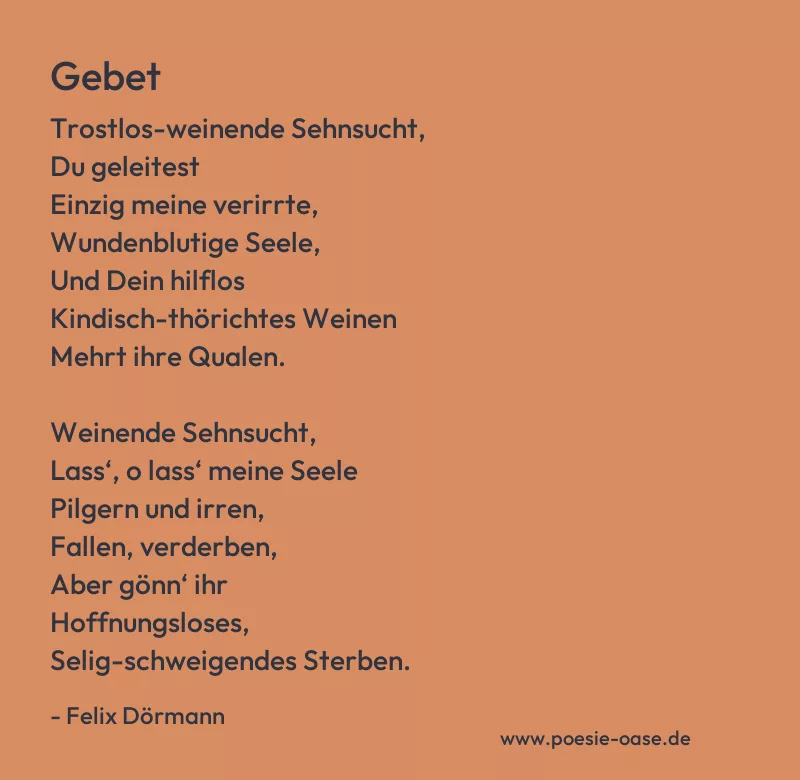
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Gebet“ von Felix Dörmann thematisiert die tiefe Erschöpfung und Verzweiflung des lyrischen Ichs, das von einer unaufhörlichen, „weinenden Sehnsucht“ begleitet wird. Diese Sehnsucht wird personifiziert und als eine treibende Kraft dargestellt, die die „wundenblutige Seele“ immer weiter ins Leiden stürzt. Die Sprache ist von Schmerz und Hoffnungslosigkeit geprägt, was das Gedicht zu einer Art innerem Hilferuf macht.
Die „Sehnsucht“ erscheint nicht als tröstliche oder inspirierende Kraft, sondern als kindlich-naives Weinen, das die Qualen der Seele nur noch vergrößert. Die Wiederholung von „weinende Sehnsucht“ unterstreicht die Hilflosigkeit und die Unausweichlichkeit dieses inneren Zustands. Die Sehnsucht wirkt dabei wie ein blinder Begleiter, der das lyrische Ich immer tiefer in den Abgrund führt.
Das eigentliche „Gebet“ richtet sich an diese Sehnsucht selbst: Das lyrische Ich bittet darum, die eigene Seele endlich loszulassen, ihr das Pilgern, Fallen und Verderben zu gestatten – letztlich aber auch das „hoffnungslose, selig-schweigende Sterben“. Der Wunsch nach dem Tod erscheint hier nicht als dramatische Flucht, sondern als Erlösung von einem unaufhörlichen inneren Schmerz.
Dörmann verleiht dem Gedicht eine resignative und zugleich erlösungssehnsüchtige Atmosphäre. Das lyrische Ich hat den Kampf gegen das Leid aufgegeben und bittet um das Verstummen der zermürbenden Sehnsucht, um im Tod einen stillen Frieden zu finden. Damit wird „Gebet“ zu einer eindringlichen Darstellung seelischer Erschöpfung und dem Wunsch nach endgültiger Ruhe.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.