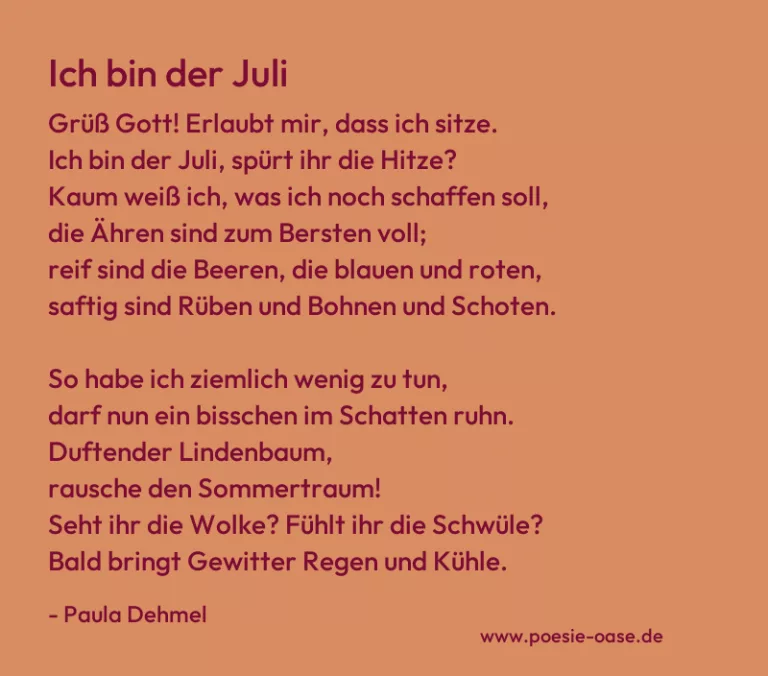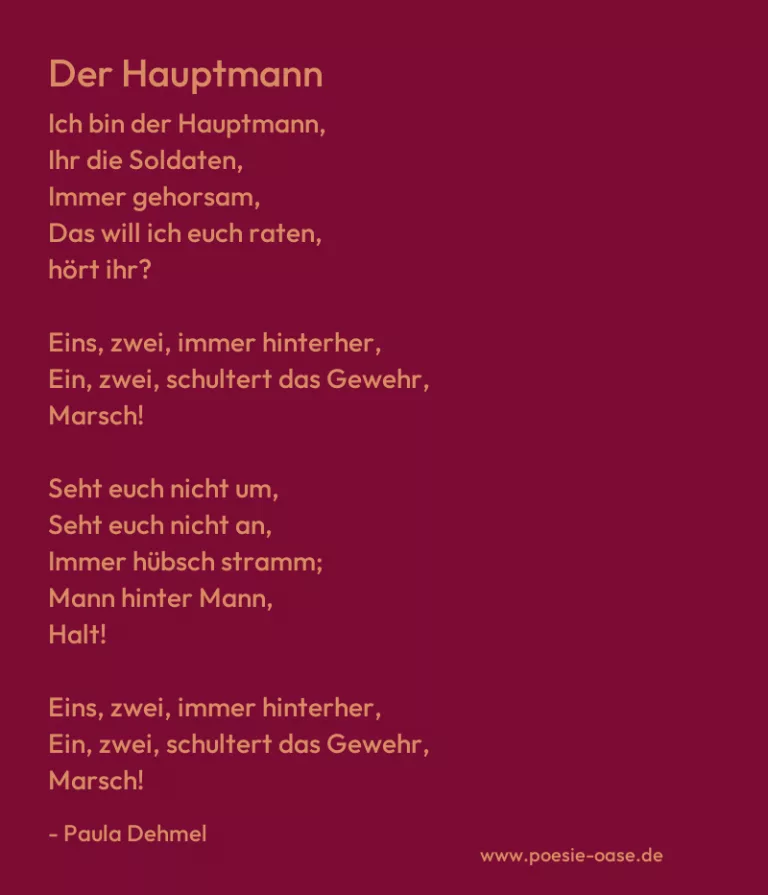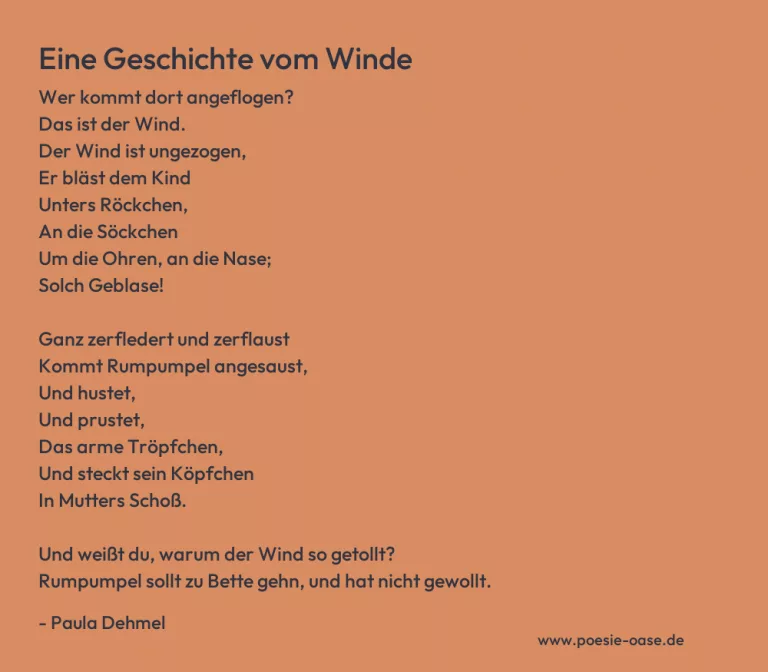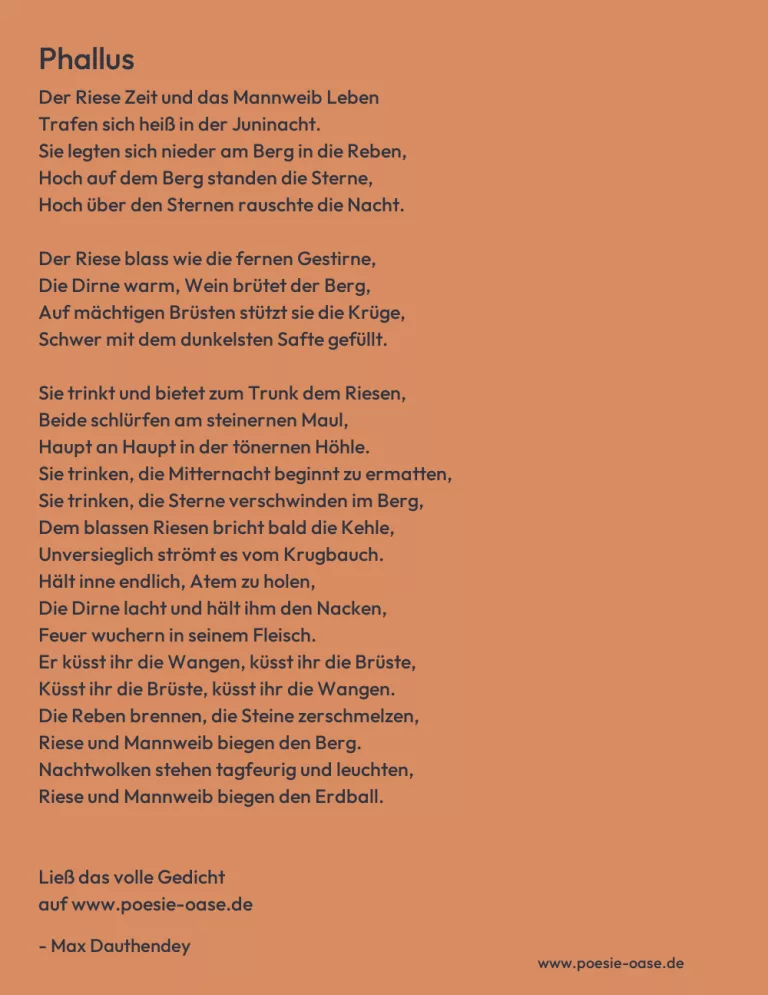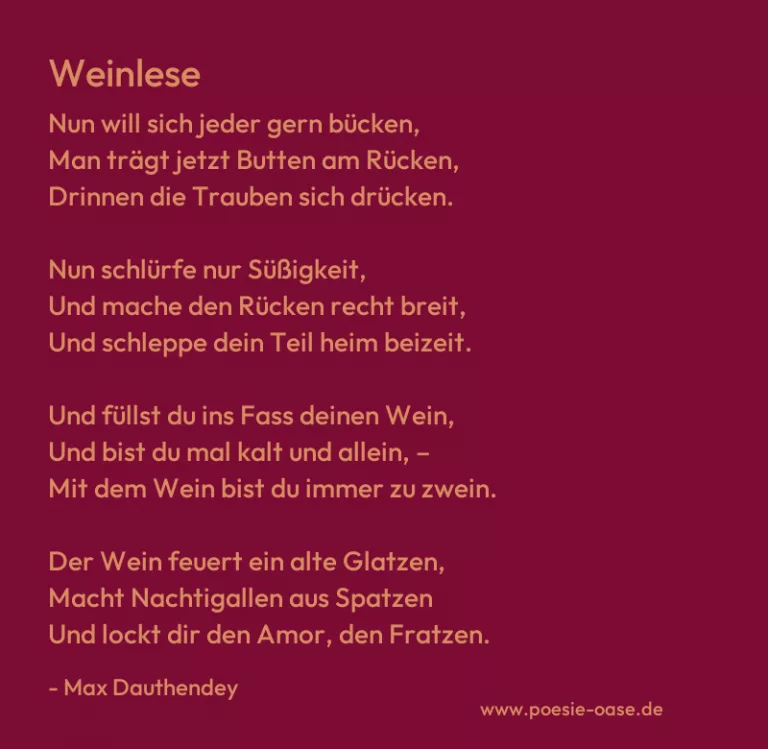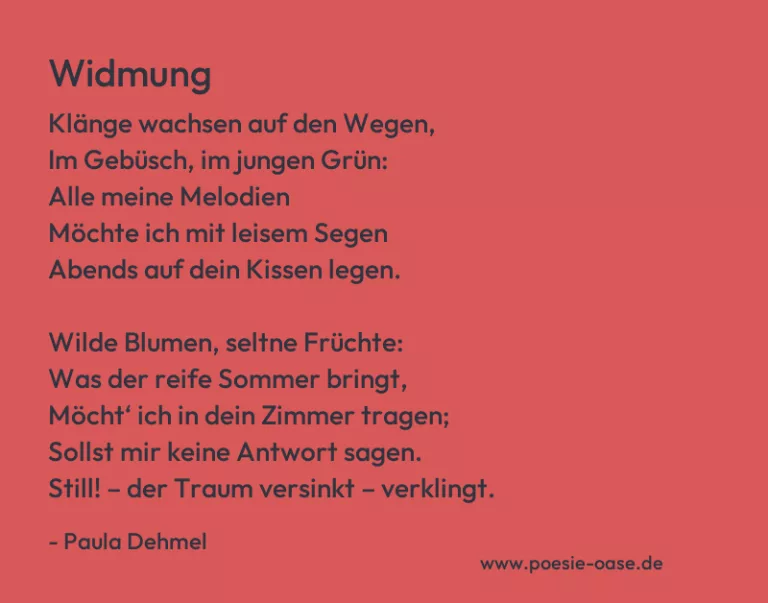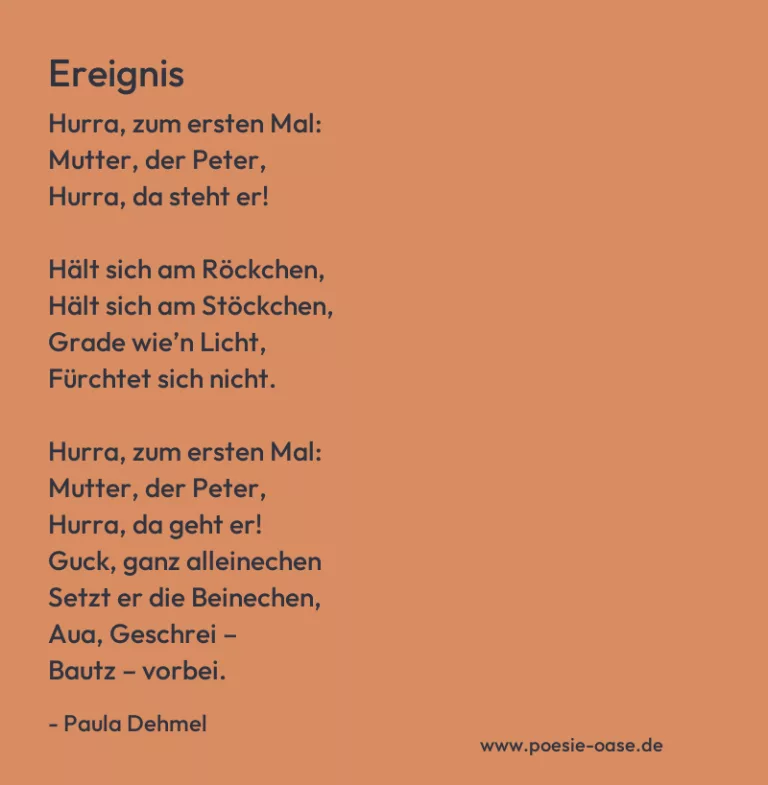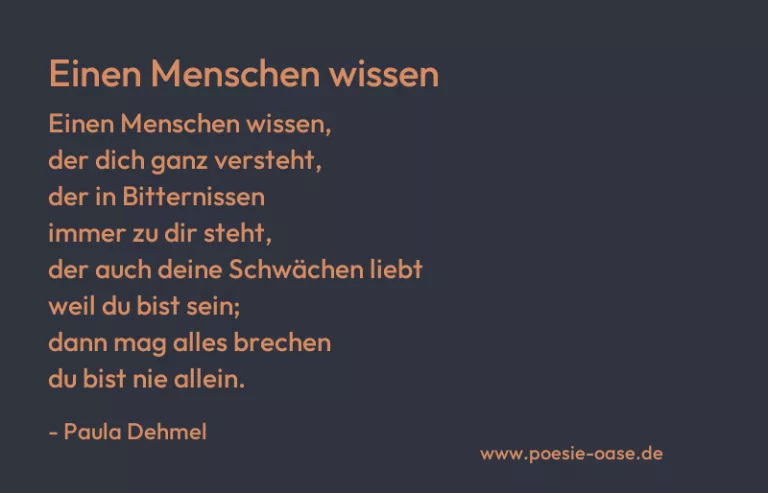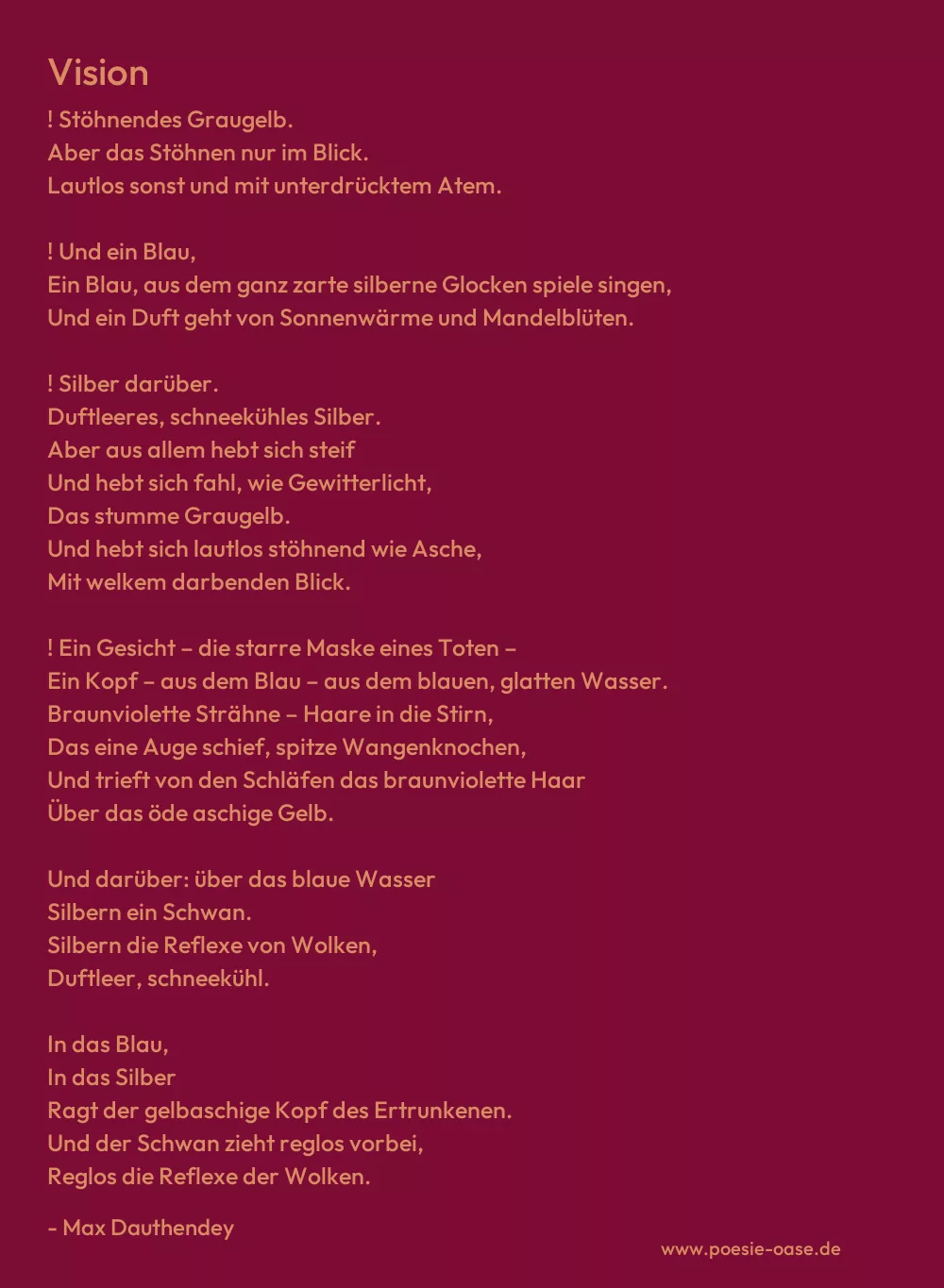Vision
! Stöhnendes Graugelb.
Aber das Stöhnen nur im Blick.
Lautlos sonst und mit unterdrücktem Atem.
! Und ein Blau,
Ein Blau, aus dem ganz zarte silberne Glocken spiele singen,
Und ein Duft geht von Sonnenwärme und Mandelblüten.
! Silber darüber.
Duftleeres, schneekühles Silber.
Aber aus allem hebt sich steif
Und hebt sich fahl, wie Gewitterlicht,
Das stumme Graugelb.
Und hebt sich lautlos stöhnend wie Asche,
Mit welkem darbenden Blick.
! Ein Gesicht – die starre Maske eines Toten –
Ein Kopf – aus dem Blau – aus dem blauen, glatten Wasser.
Braunviolette Strähne – Haare in die Stirn,
Das eine Auge schief, spitze Wangenknochen,
Und trieft von den Schläfen das braunviolette Haar
Über das öde aschige Gelb.
Und darüber: über das blaue Wasser
Silbern ein Schwan.
Silbern die Reflexe von Wolken,
Duftleer, schneekühl.
In das Blau,
In das Silber
Ragt der gelbaschige Kopf des Ertrunkenen.
Und der Schwan zieht reglos vorbei,
Reglos die Reflexe der Wolken.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
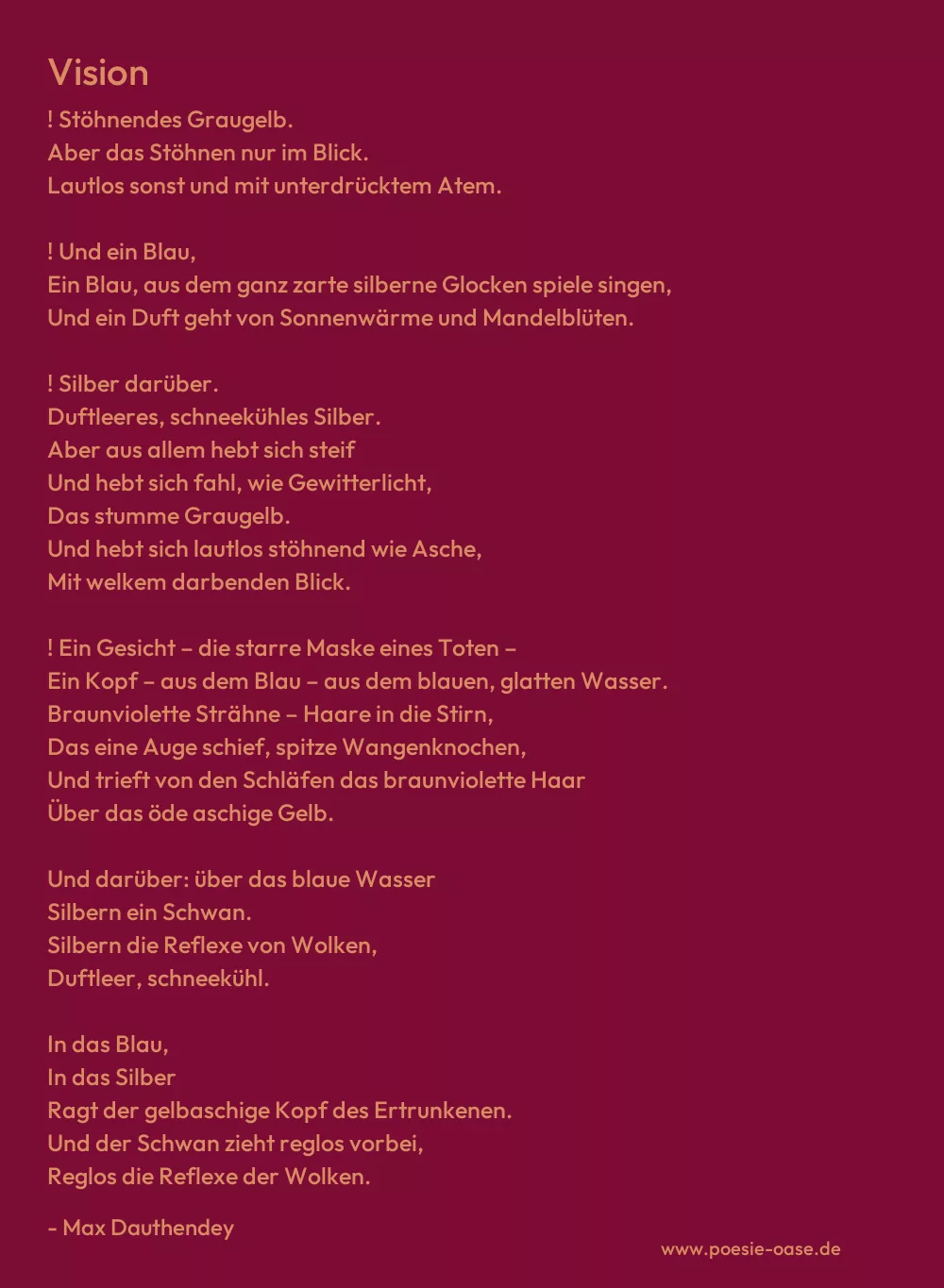
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Vision“ von Max Dauthendey entführt den Leser in eine düstere, beinahe surreale Szenerie, die von Farben, Licht und einer unheimlichen Stille geprägt ist. Zu Beginn wird eine Landschaft aus „stöhnendem Graugelb“ beschrieben, die durch die Wortwahl eine beklemmende, fast schmerzliche Atmosphäre hervorruft. Das „Stöhnen nur im Blick“ deutet auf eine stille, innere Qual hin, die im Blick des Erzählers oder der beobachteten Figur zum Ausdruck kommt, aber ohne äußeren Laut oder Bewegung. Das „Graugelb“ steht als Symbol für eine trostlose, ausgebrannte Welt, in der sich nichts rührt und alles von einer dumpfen Schwere erfasst wird.
Im Kontrast dazu erscheint das „Blau“, das mit „zarten silbernen Glocken“ und dem Duft von „Sonnenwärme und Mandelblüten“ in Verbindung gebracht wird, fast wie ein Traum oder eine Erinnerung an bessere Zeiten. Diese sanften, fast ätherischen Bilder des Duftes und des Spiels von Licht wirken wie eine Flucht aus der tristen Welt des Graugelbs. Doch auch dieses Blau, trotz seiner Schönheit, ist von einer unerreichbaren Ferne geprägt, als ob es die Kluft zwischen Hoffnung und Realität darstellt. Die „silberne“ Welt bleibt distanziert und kalt, die Düfte und das Licht berühren den Betrachter nur flüchtig.
Die Darstellung des „stummen Graugelbs“ hebt sich jedoch wieder hervor und wird zunehmend bedrohlicher, wie „Gewitterlicht“, das „lautlos stöhnend wie Asche“ aus der Szenerie emporsteigt. Dies deutet auf den bevorstehenden, unausweichlichen Verlust hin – ein Ertrunkener, dessen Kopf sich „starr“ und „fahl“ aus dem Wasser erhebt. Die detaillierte Schilderung des Gesichts des Ertrunkenen – mit „spitze Wangenknochen“ und „schiefem Auge“ – erzeugt eine stark visuelle Vorstellung von Tod und Verfall. Die tragische und beunruhigende Symbolik wird verstärkt durch die Verbindung von „braunviolettem Haar“ und dem „graugelb“, das den Kopf umgibt.
Der Schwan, der „silbern“ und „reglos“ vorüberzieht, fügt dem Gedicht eine weitere symbolische Ebene hinzu. Der Schwan, oft als Symbol für Reinheit und Schönheit gesehen, erscheint hier als stumm und reglos, fast gleichgültig gegenüber dem tragischen Bild des Ertrunkenen. Die „Reflexe der Wolken“ spiegeln sich ebenso reglos im Wasser, was das Gefühl von Ohnmacht und Stillstand verstärkt. Die Farbkontraste zwischen Blau, Silber und Grau sowie die ständige Wiederholung von Stille und Reglosigkeit verdeutlichen das Thema des Gedichts: die Unvermeidlichkeit des Todes, der in einer Welt von Kälte, Stille und Entfremdung existiert, ohne Trost oder Hoffnung auf Erlösung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.