Ach, es ist so dunkel in des Todes Kammer,
Tönt so traurig, wenn er sich bewegt
Und nun aufhebt seinen schweren Hammer
Und die Stunde schlägt.
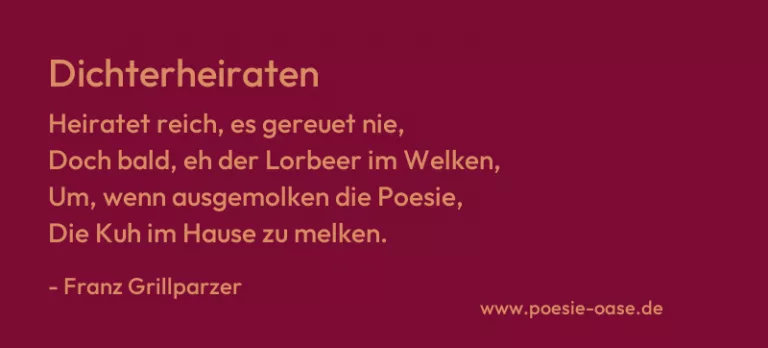
Dichterheiraten
- Gemeinfrei
- Liebe & Romantik
- Tiere
Ach, es ist so dunkel in des Todes Kammer,
Tönt so traurig, wenn er sich bewegt
Und nun aufhebt seinen schweren Hammer
Und die Stunde schlägt.
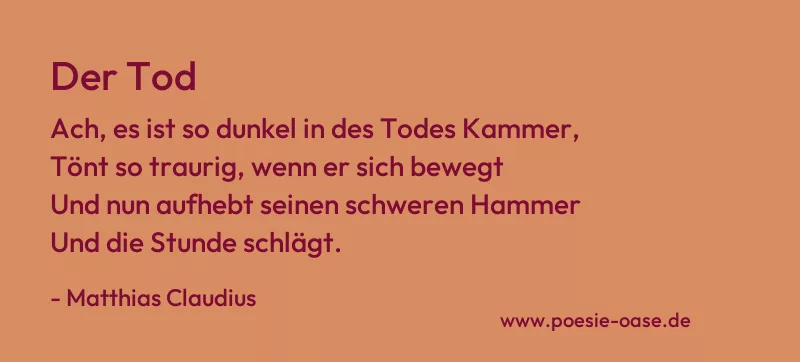
Das Gedicht „Der Tod“ von Matthias Claudius ist eine kurze, aber eindrucksvolle Darstellung des Todes als düstere, gewaltvolle Gestalt. In nur vier Versen gelingt es Claudius, eine beklemmende Atmosphäre zu erzeugen, in der der Tod als unentrinnbare Macht erscheint, die mit unerbittlicher Ruhe und Schwere das Ende des Lebens markiert.
Das Bild der „Todes Kammer“ ist von Dunkelheit und Stille geprägt, was die Isolation und Unausweichlichkeit des Todes symbolisiert. Der Raum des Sterbens ist nicht nur finster im wörtlichen Sinne, sondern auch emotional – er entzieht sich allem Licht, allem Leben. Die Bewegung des Todes wird als traurig klingend beschrieben, was ihm eine gespenstische, fast ritualisierte Dimension verleiht.
Zentral ist die Metapher des Hammers, mit dem der Tod „die Stunde schlägt“. Dieses Bild vereint zwei Bedeutungen: zum einen die Uhrzeit, die letzte Stunde des Lebens, zum anderen den Schlag als physischen Akt der Beendigung. Der Hammer steht hier für die Macht des Todes, die endgültig, gewaltsam und feierlich zugleich ist – wie ein Schicksalsschlag.
Claudius verzichtet auf Trost, Verklärung oder religiöse Hoffnung. Stattdessen liegt der Fokus auf der schlichten, erschütternden Konfrontation mit dem Sterben selbst. Das Gedicht spiegelt damit eine nüchterne, existenzielle Sicht auf den Tod wider, in der Angst, Ernst und Endgültigkeit im Vordergrund stehen. Gerade durch seine Kürze und Bildhaftigkeit wirkt es nachhaltig – ein stilles, klangvolles Memento Mori.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.