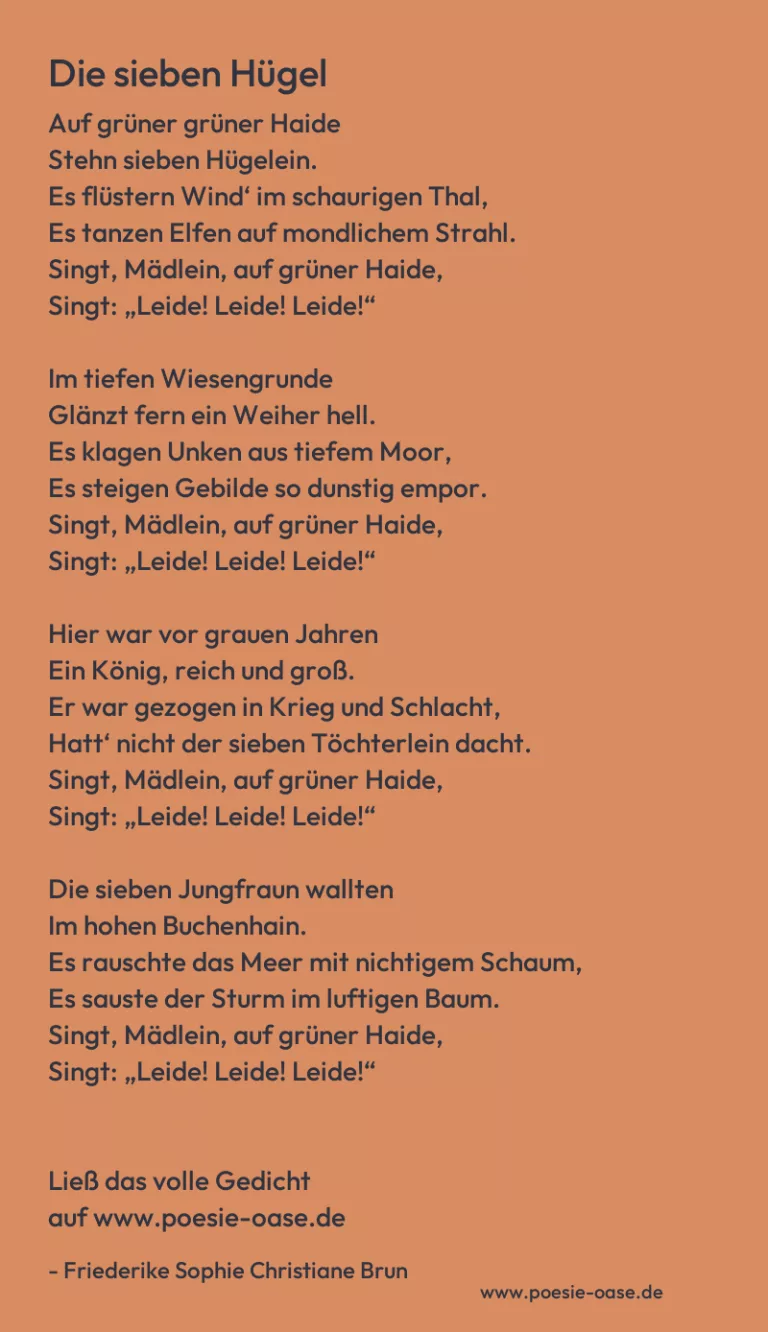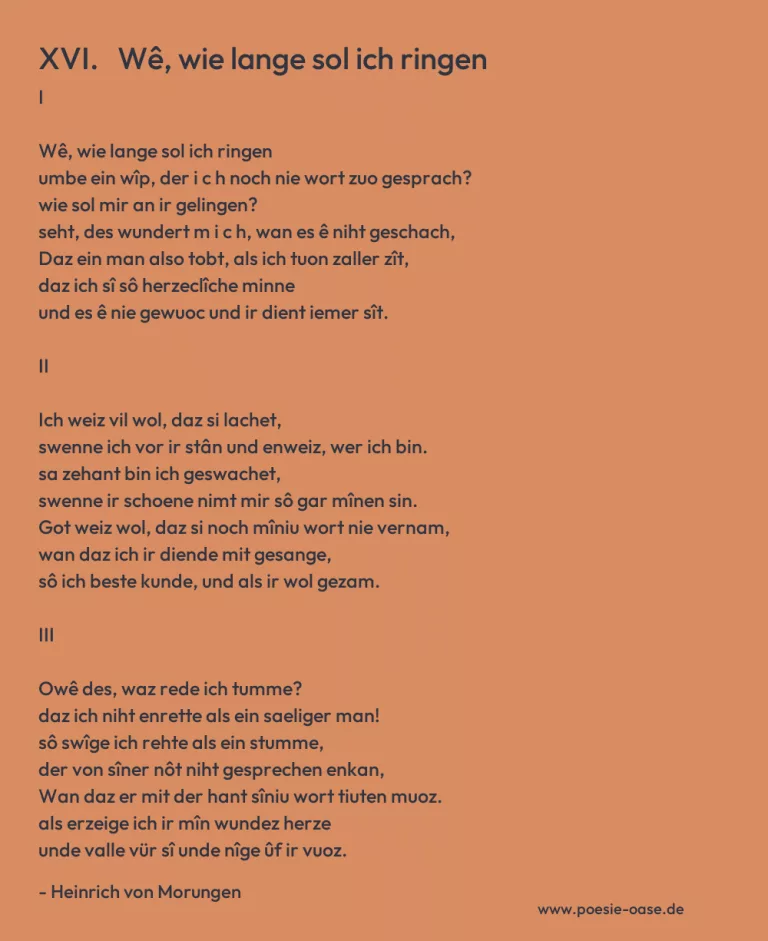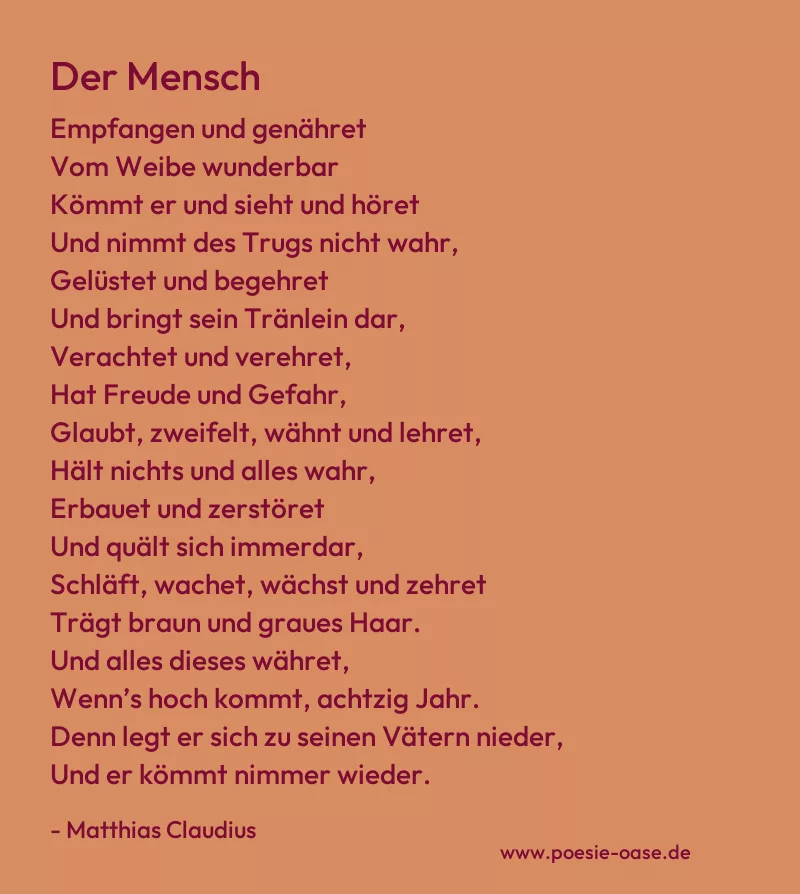Der Mensch
Empfangen und genähret
Vom Weibe wunderbar
Kömmt er und sieht und höret
Und nimmt des Trugs nicht wahr,
Gelüstet und begehret
Und bringt sein Tränlein dar,
Verachtet und verehret,
Hat Freude und Gefahr,
Glaubt, zweifelt, wähnt und lehret,
Hält nichts und alles wahr,
Erbauet und zerstöret
Und quält sich immerdar,
Schläft, wachet, wächst und zehret
Trägt braun und graues Haar.
Und alles dieses währet,
Wenn’s hoch kommt, achtzig Jahr.
Denn legt er sich zu seinen Vätern nieder,
Und er kömmt nimmer wieder.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
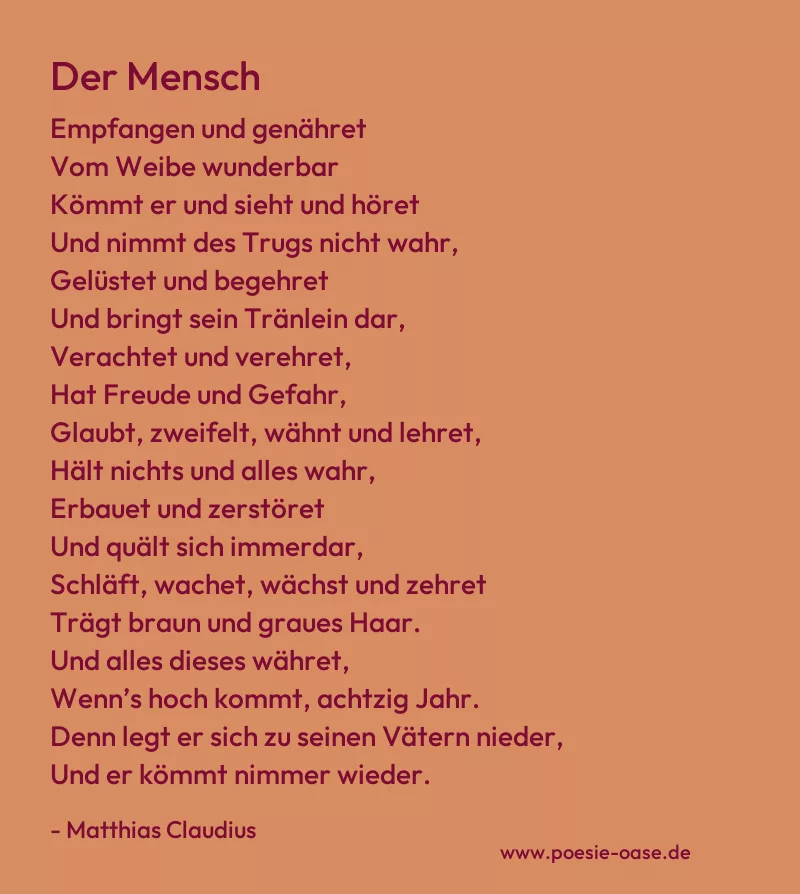
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Mensch“ von Matthias Claudius zeichnet in knapper, pointierter Form das Bild des menschlichen Lebenslaufs. Es beginnt mit der Geburt des Menschen, beschreibt dessen Erfahrungen, Empfindungen und Handlungen im Verlauf des Lebens und endet mit dem unausweichlichen Tod. Der Tonfall ist ruhig, fast resignativ, und spiegelt eine nüchterne Sicht auf das menschliche Dasein wider.
In zwölf Verspaaren werden zentrale Stationen und Zustände menschlicher Existenz benannt: Wahrnehmung, Begehren, Leiden, Freude, Glaube, Zweifel, Tat und Scheitern. Diese werden nicht in zusammenhängender Erzählung, sondern in einer fast aufzählenden Reihung dargeboten. Dabei entsteht ein Eindruck von Vielschichtigkeit und gleichzeitiger Vergänglichkeit. Das Leben erscheint als ein Wechselspiel widersprüchlicher Erfahrungen – der Mensch verehrt und verachtet, baut auf und zerstört, glaubt und zweifelt.
Auffällig ist die syntaktische Einfachheit: Meist bestehen die Verspaare aus kurzen, rhythmisch gesetzten Hauptsätzen. Dadurch wirkt das Gedicht wie ein Lebensresümee – klar, distanziert und ungeschönt. Besonders die letzten Zeilen „Und alles dieses währet, / Wenn’s hoch kommt, achtzig Jahr“ sowie die abschließende Feststellung des Todes verleihen dem Text eine existentielle Tiefe. Sie konfrontieren den Leser mit der Endlichkeit aller Erfahrungen und stellen das gesamte menschliche Streben in ein relativierendes Licht.
Claudius’ Gedicht verknüpft somit anthropologische Beobachtung mit philosophischer Reflexion. Es stellt keine Wertung der menschlichen Taten oder Gefühle in den Vordergrund, sondern lässt sie nebeneinander stehen – als Teil eines größeren Ganzen, das letztlich unaufhaltsam auf den Tod zuläuft. Das Gedicht erinnert an die Begrenztheit des Lebens und ruft zur Demut angesichts der Vergänglichkeit auf.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.