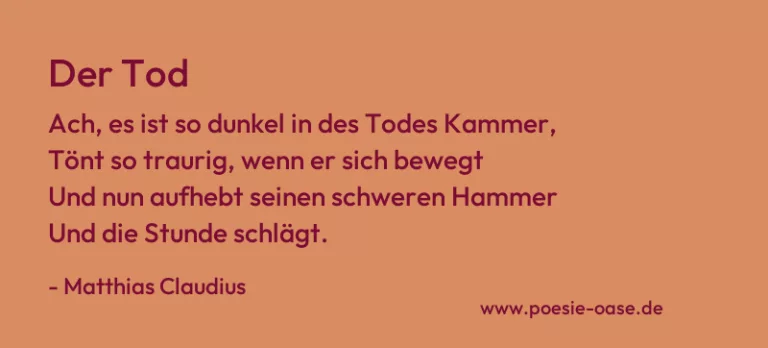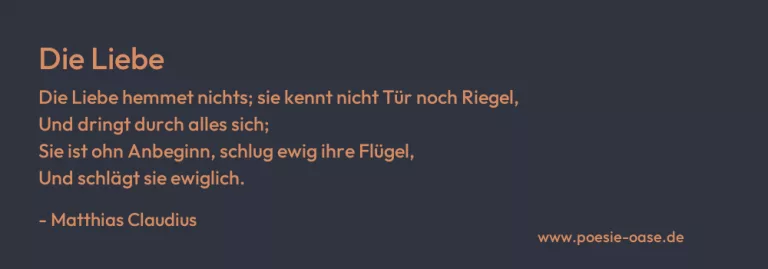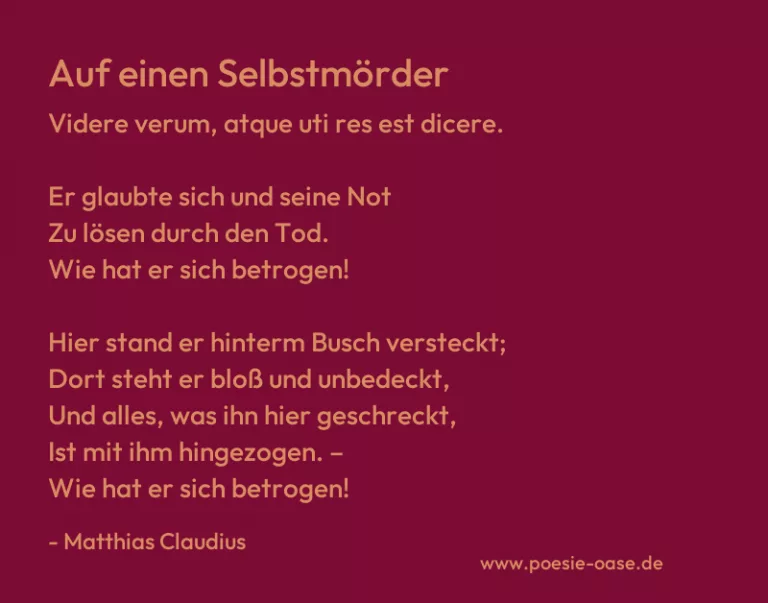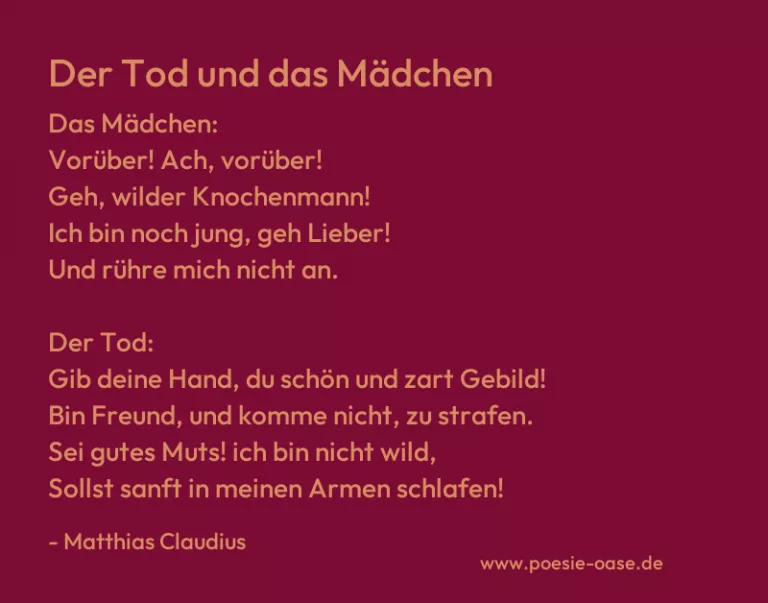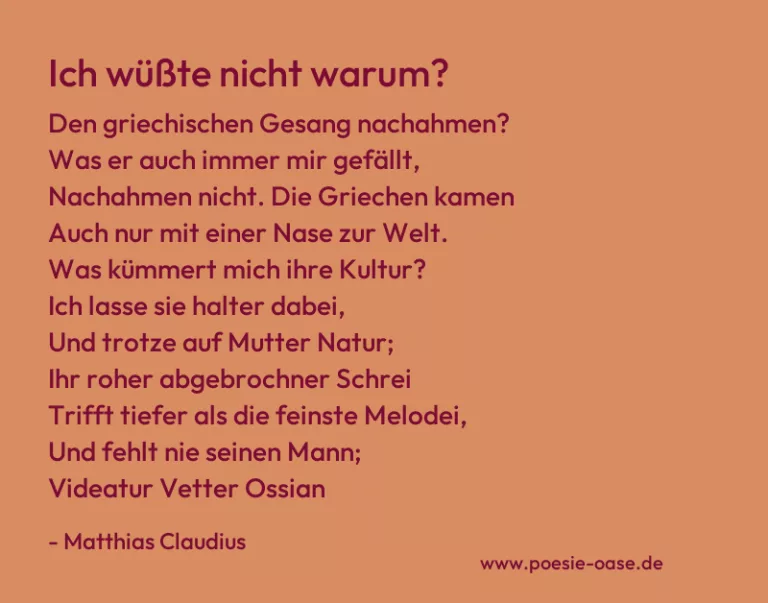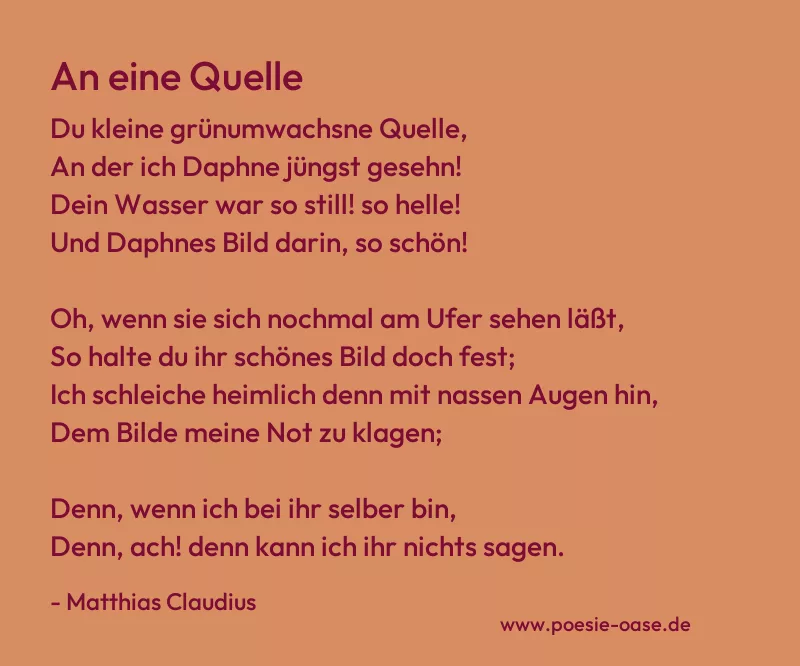An eine Quelle
Du kleine grünumwachsne Quelle,
An der ich Daphne jüngst gesehn!
Dein Wasser war so still! so helle!
Und Daphnes Bild darin, so schön!
Oh, wenn sie sich nochmal am Ufer sehen läßt,
So halte du ihr schönes Bild doch fest;
Ich schleiche heimlich denn mit nassen Augen hin,
Dem Bilde meine Not zu klagen;
Denn, wenn ich bei ihr selber bin,
Denn, ach! denn kann ich ihr nichts sagen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
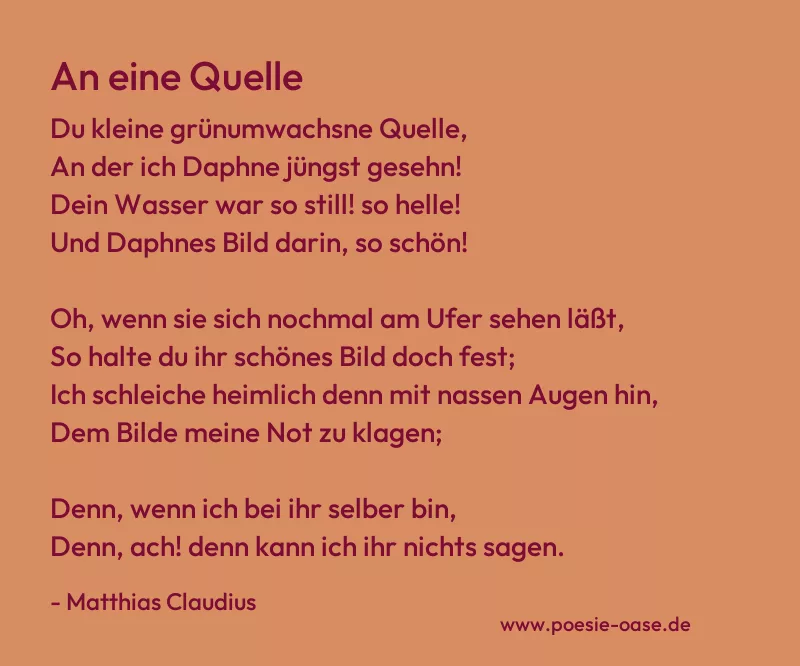
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An eine Quelle“ von Matthias Claudius ist eine zarte lyrische Szene, in der Natur und Gefühl eng miteinander verknüpft sind. Der Sprecher wendet sich an eine Quelle, die für ihn nicht nur ein Ort der Ruhe, sondern auch der Erinnerung und Sehnsucht ist. Im Zentrum steht das Motiv der unerwiderten oder unaussprechlichen Liebe, die durch das Spiegelbild der Geliebten in der Quelle greifbar – und zugleich unendlich fern – wird.
In der ersten Strophe wird die Quelle liebevoll beschrieben: „klein“, „grünumwachsen“, mit „stillem“ und „hellem“ Wasser – ein beinahe ideales Naturbild, das Reinheit und Frieden ausstrahlt. In dieser Idylle hat der Sprecher „Daphne“ gesehen, deren Schönheit sich im Wasser gespiegelt hat. Das Bild der Daphne knüpft an die Mythologie an, doch hier steht weniger der antike Kontext als vielmehr die persönliche Schwärmerei im Vordergrund.
Die zweite Strophe bringt den Wunsch zum Ausdruck, das Bild der Geliebten möge im Wasser bewahrt werden. Die Quelle wird zur Vertrauten, zur stummen Zeugin der inneren Not. Der Sprecher plant, sich heimlich zum Wasser zu schleichen – mit „nassen Augen“, also weinend – um dort dem Spiegelbild seine Gefühle zu offenbaren. Dies unterstreicht die Sprachlosigkeit und innere Hemmung, die den direkten Ausdruck gegenüber der realen Person verhindern.
Die letzte Strophe ist von stiller Verzweiflung geprägt. „Denn, wenn ich bei ihr selber bin, / Denn, ach! denn kann ich ihr nichts sagen.“ Der Schmerz des Sprechers liegt nicht nur in der unerwiderten Liebe, sondern vor allem in der Unfähigkeit, diese Liebe zu äußern. Das Schweigen vor der Geliebten kontrastiert mit dem Reden gegenüber dem bloßen Abbild in der Quelle. Damit wird das Naturbild zum Spiegel innerer Zerrissenheit.
Claudius gelingt es, mit wenigen Versen eine tiefe, melancholische Stimmung zu erzeugen. Die Quelle ist dabei mehr als nur ein Ort – sie wird zur symbolischen Projektionsfläche für Sehnsucht, Erinnerung und stumme Liebe. Das Gedicht ist schlicht und zurückhaltend, aber gerade dadurch anrührend in seiner Darstellung des stillen Liebesschmerzes.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.