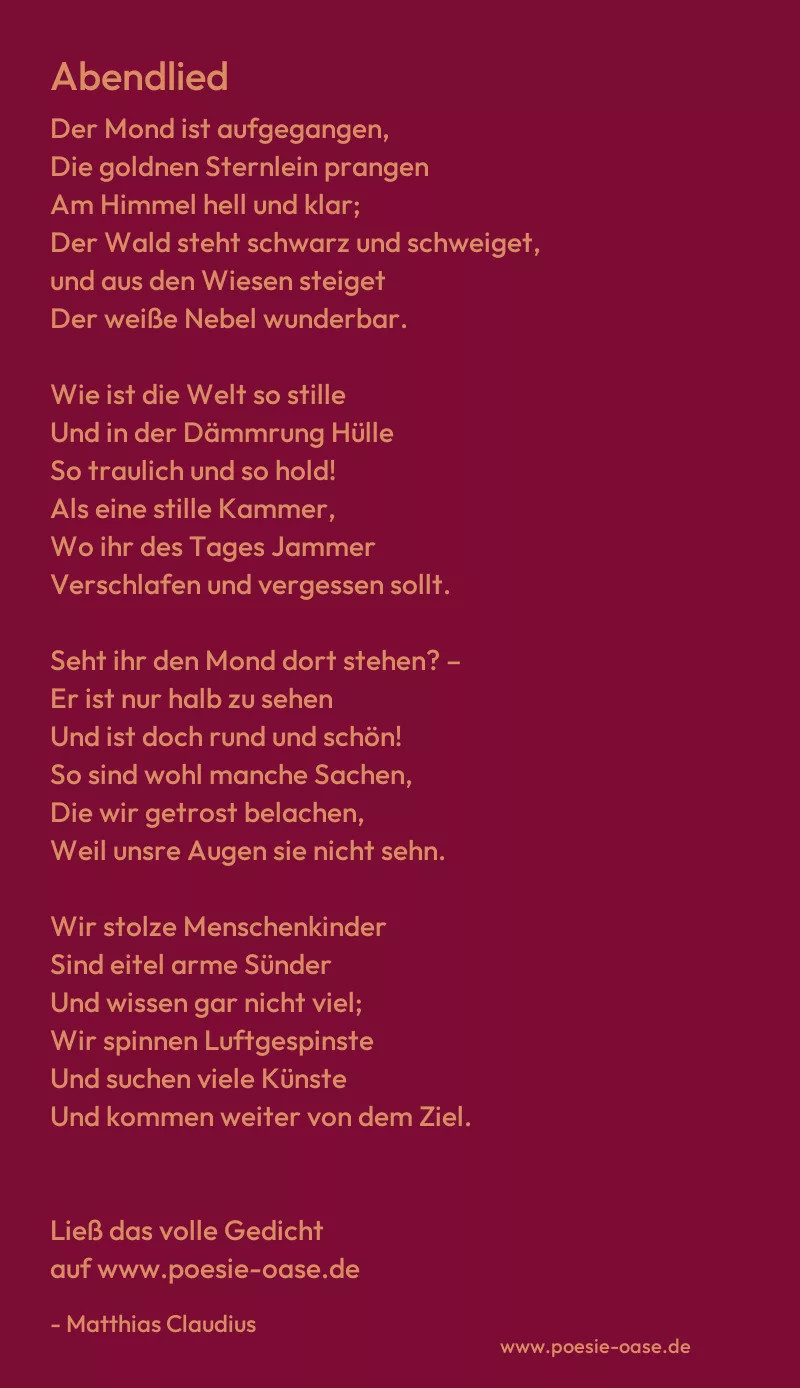Fortschritt, Freiheit & Sehnsucht, Frieden, Gegenwart, Gemeinfrei, Götter, Herbst, Himmel & Wolken, Jahreszeiten, Märchen & Fantasie, Religion, Wissenschaft & Technik
Abendlied
Der Mond ist aufgegangen,
Die goldnen Sternlein prangen
Am Himmel hell und klar;
Der Wald steht schwarz und schweiget,
und aus den Wiesen steiget
Der weiße Nebel wunderbar.
Wie ist die Welt so stille
Und in der Dämmrung Hülle
So traulich und so hold!
Als eine stille Kammer,
Wo ihr des Tages Jammer
Verschlafen und vergessen sollt.
Seht ihr den Mond dort stehen? –
Er ist nur halb zu sehen
Und ist doch rund und schön!
So sind wohl manche Sachen,
Die wir getrost belachen,
Weil unsre Augen sie nicht sehn.
Wir stolze Menschenkinder
Sind eitel arme Sünder
Und wissen gar nicht viel;
Wir spinnen Luftgespinste
Und suchen viele Künste
Und kommen weiter von dem Ziel.
Gott, laß uns dein Heil schauen,
Auf nichts Vergänglichs trauen,
Nicht Eitelkeit uns freun!
Laß uns einfältig werden
Und vor dir hier auf Erden
Wie Kinder fromm und fröhlich sein!
Wollst endlich sonder Grämen
Aus dieser Welt uns nehmen
Durch einen sanften Tod!
Und, wenn du uns genommen,
Laß uns in Himmel kommen,
Du unser Herr und unser Gott!
So legt euch denn, ihr Brüder,
In Gottes Namen nieder;
Kalt ist der Abendhauch.
Verschon uns, Gott! mit Strafen,
Und laß uns ruhig schlafen!
Und unsern kranken Nachbar auch!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
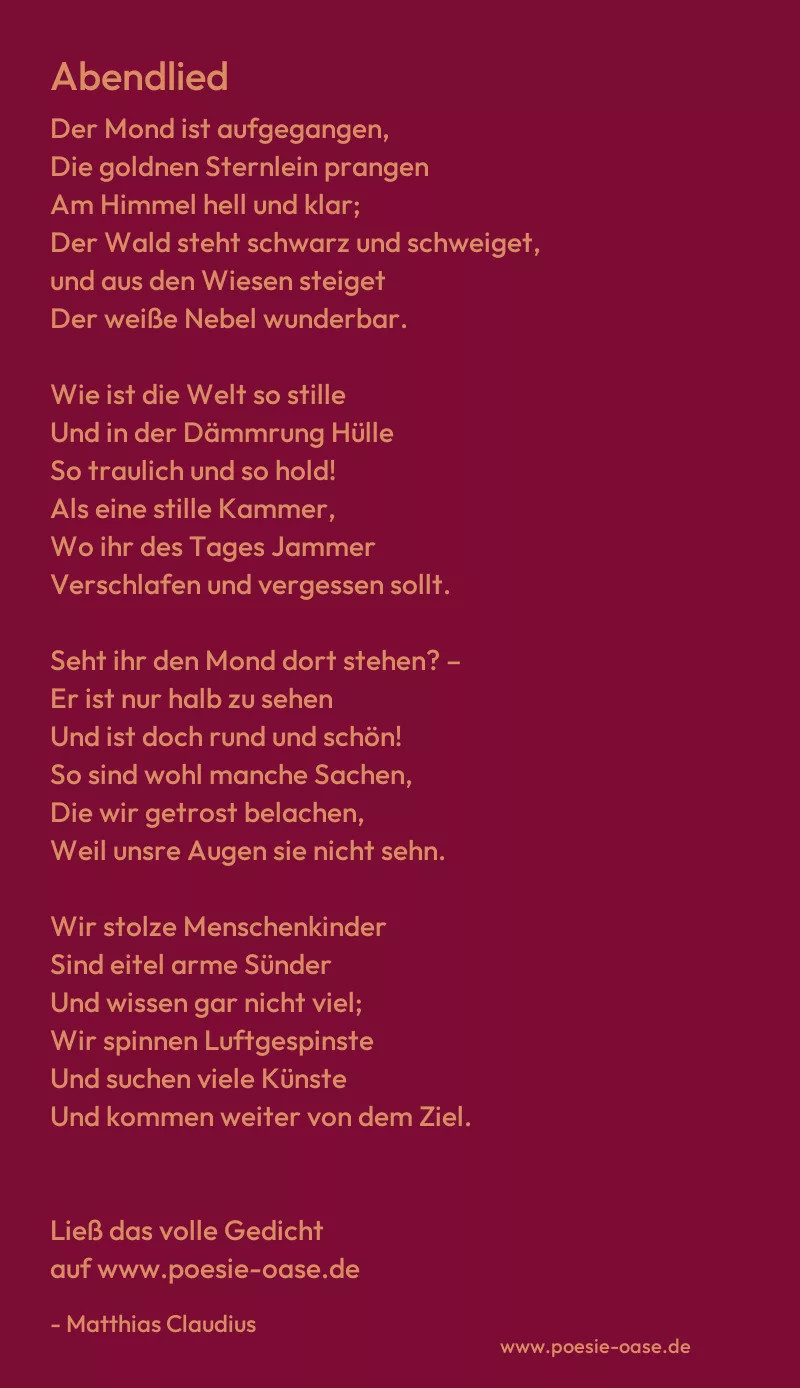
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Abendlied“ von Matthias Claudius ist eines der bekanntesten geistlichen Lieder der deutschen Literatur und verbindet Naturbetrachtung, Nachdenklichkeit und frommes Vertrauen auf eindrucksvolle Weise. Es beginnt mit einer friedlichen Abendstimmung und entwickelt sich zu einem meditativen Gebet über menschliche Begrenztheit, Demut und die Hoffnung auf göttlichen Trost.
Die ersten beiden Strophen schaffen eine ruhige, fast mystische Szenerie: Der aufgehende Mond, die „goldnen Sternlein“, der schweigende Wald und der „weiße Nebel“ zeichnen ein Bild der Welt in der Dämmerung. Diese äußere Stille überträgt sich auf die innere Haltung des lyrischen Ichs. Die Nacht wird nicht nur als Ende des Tages, sondern auch als Raum zur Besinnung verstanden – als „stille Kammer“, in der sich Leid und Sorgen des Tages lösen können.
In der dritten Strophe nutzt Claudius das Bild des Mondes, der nur halb sichtbar, aber dennoch „rund und schön“ ist, als Gleichnis für unsere begrenzte Wahrnehmung. Dinge, die uns unvollständig oder unsinnig erscheinen, haben dennoch ihre Ganzheit und Bedeutung – auch wenn wir sie nicht erkennen. Diese Einsicht führt in den folgenden Strophen zur kritischen Selbstreflexion: Der Mensch, stolz und voller Wissen, ist doch ein „eitel armer Sünder“, der sich in Eitelkeit und unnützem Streben verliert.
Das Gedicht mündet in ein Gebet um göttliche Führung, Einfachheit und kindlichen Glauben. Claudius plädiert für einen Lebensweg in Demut und Vertrauen, abseits von Hochmut und Trug. Dabei wird der Tod nicht gefürchtet, sondern als sanfter Übergang in die göttliche Nähe erbeten – als liebevolle Aufnahme in den Himmel. Die letzte Strophe rundet das Gedicht ab mit einem Abendgruß an die „Brüder“, also alle Mitmenschen, verbunden mit einem schlichten, innigen Wunsch nach Schutz, Ruhe und Fürsorge – auch für den „kranken Nachbar“.
„Abendlied“ ist somit ein Gedicht von großer Schlichtheit und zugleich tiefer geistiger und spiritueller Kraft. Es vereint Naturpoesie mit Lebensweisheit und christlichem Glauben und wird durch seine ruhige Sprache, seine klare Form und seine universelle Botschaft zu einem zeitlosen Trostlied für den Übergang von Tag zu Nacht – und letztlich auch vom Leben zum Tod.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.