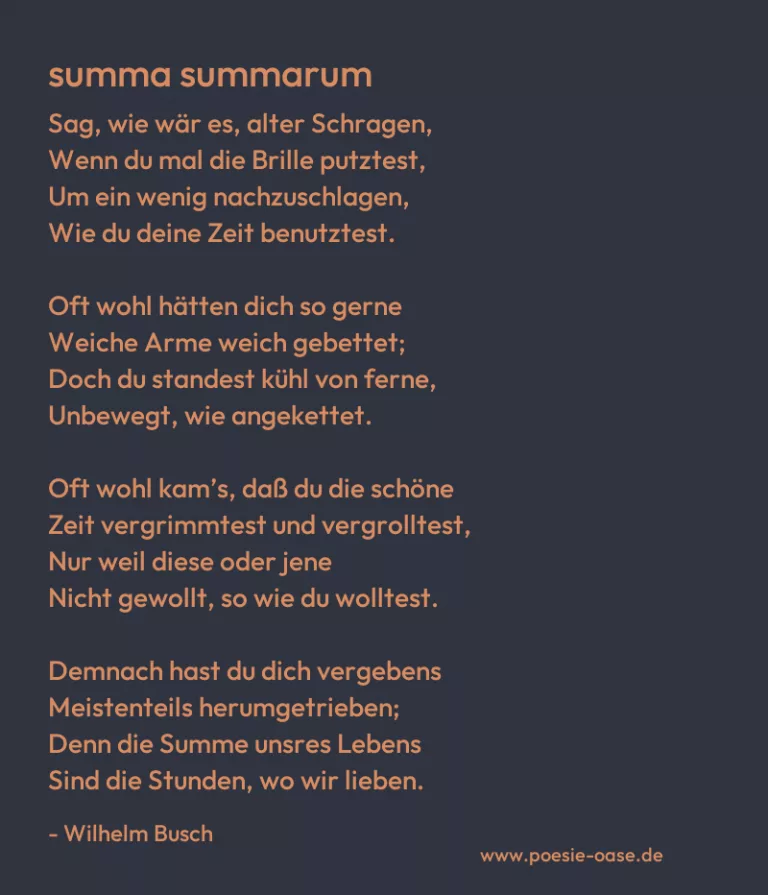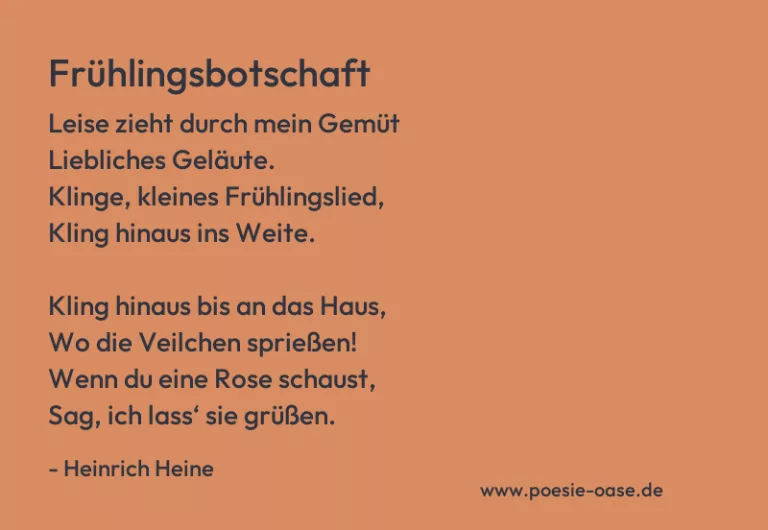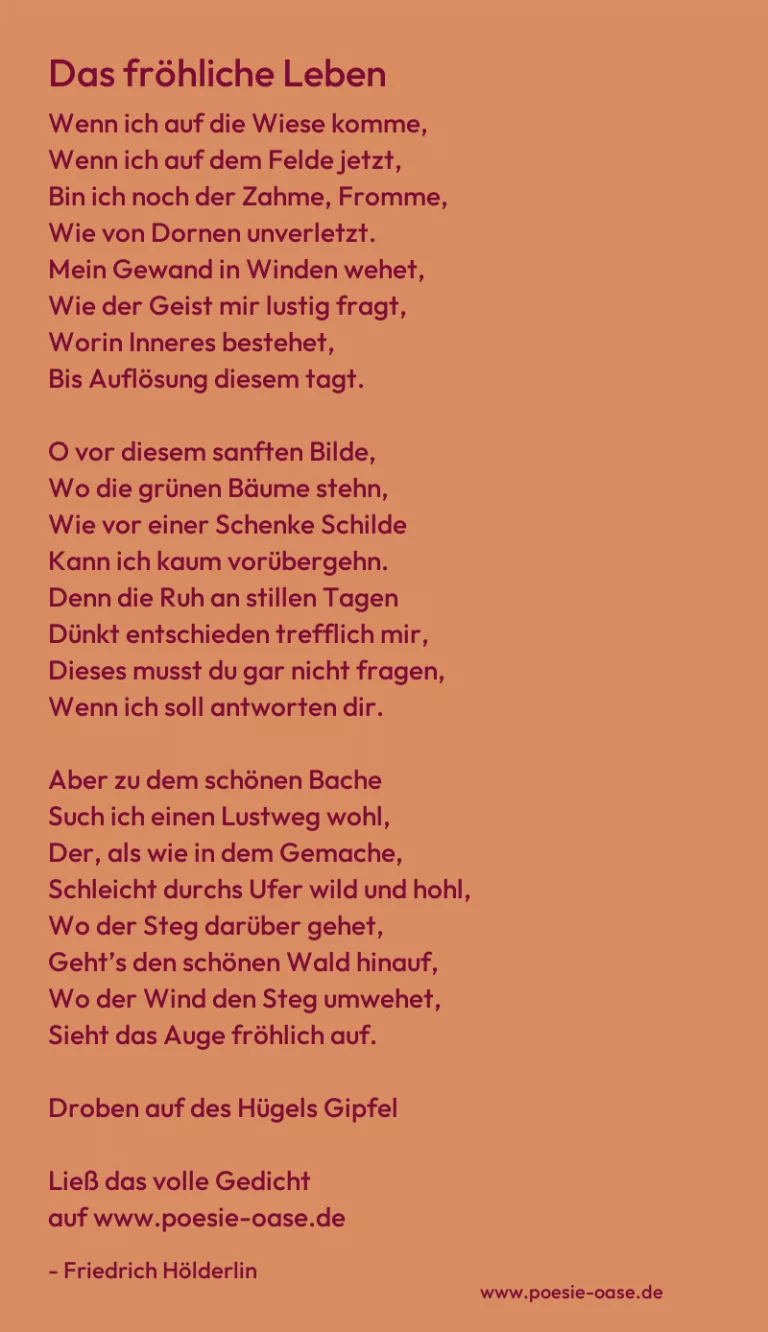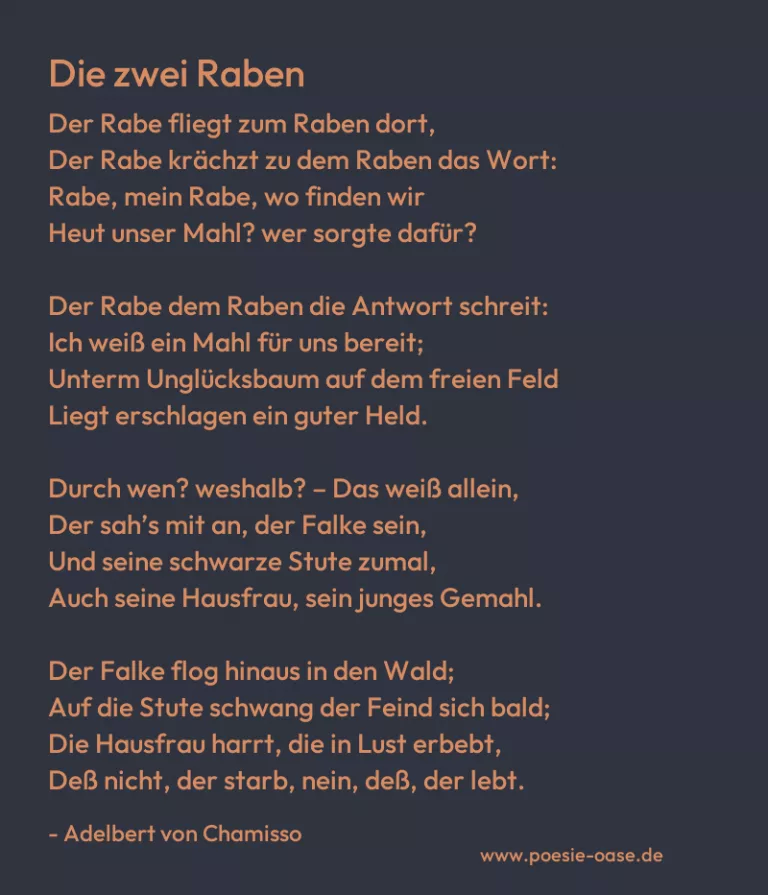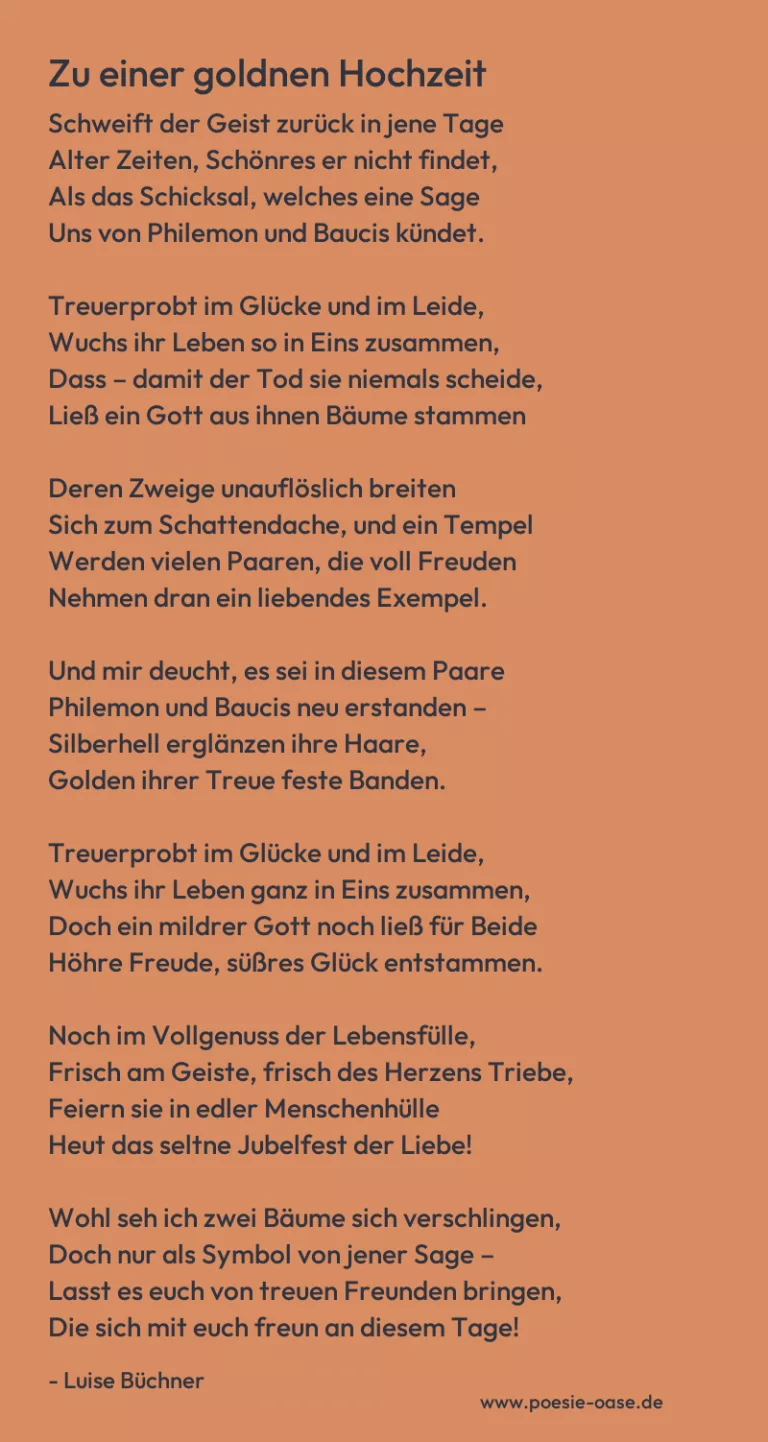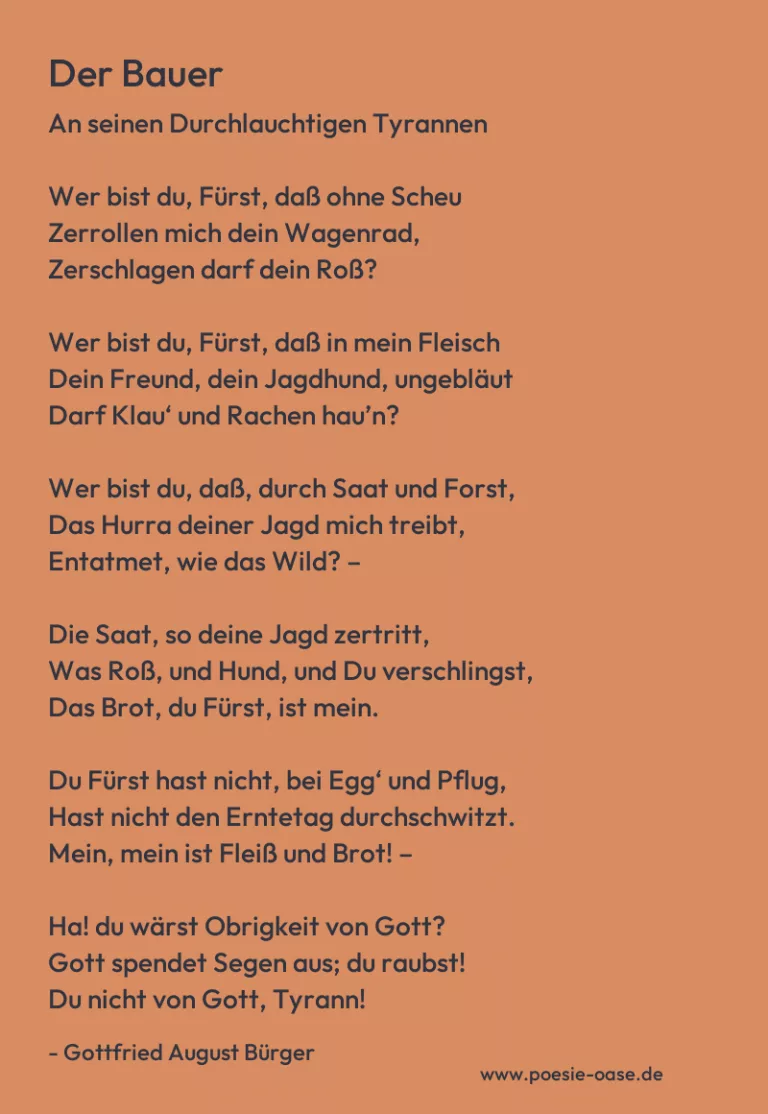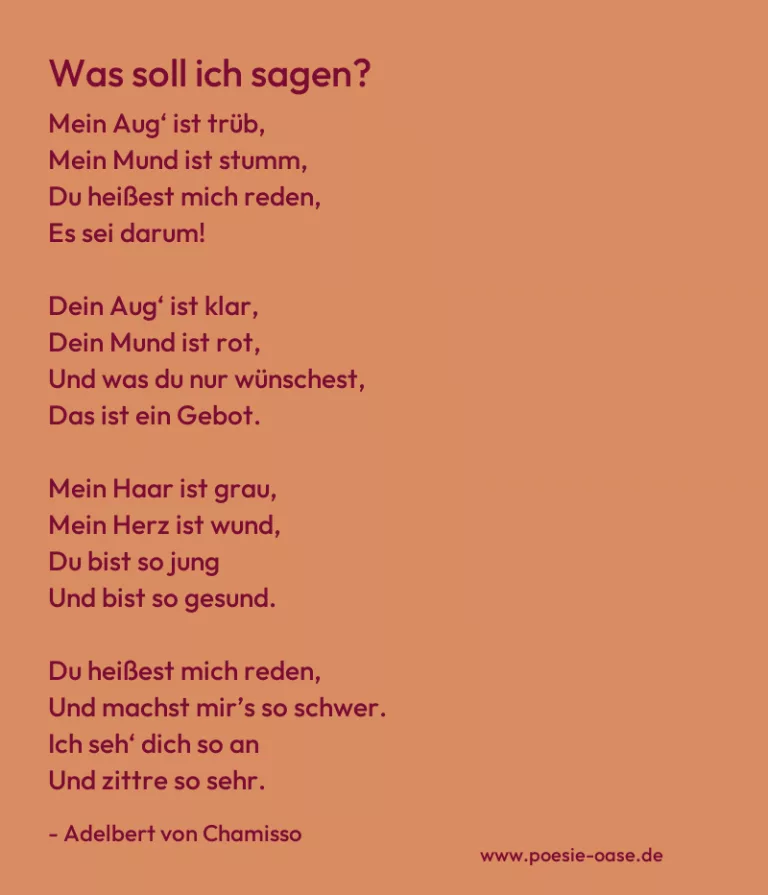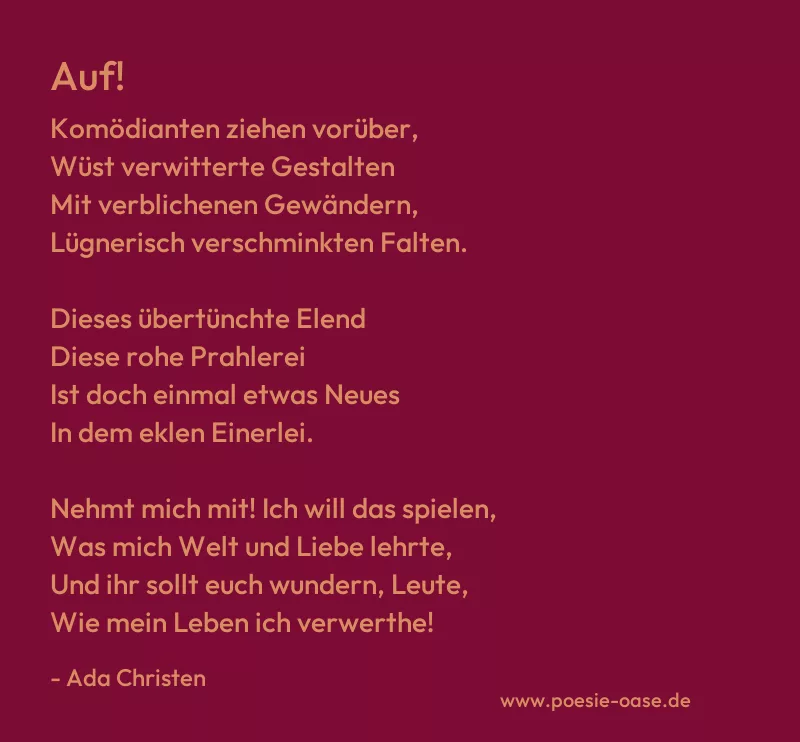Auf!
Komödianten ziehen vorüber,
Wüst verwitterte Gestalten
Mit verblichenen Gewändern,
Lügnerisch verschminkten Falten.
Dieses übertünchte Elend
Diese rohe Prahlerei
Ist doch einmal etwas Neues
In dem eklen Einerlei.
Nehmt mich mit! Ich will das spielen,
Was mich Welt und Liebe lehrte,
Und ihr sollt euch wundern, Leute,
Wie mein Leben ich verwerthe!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
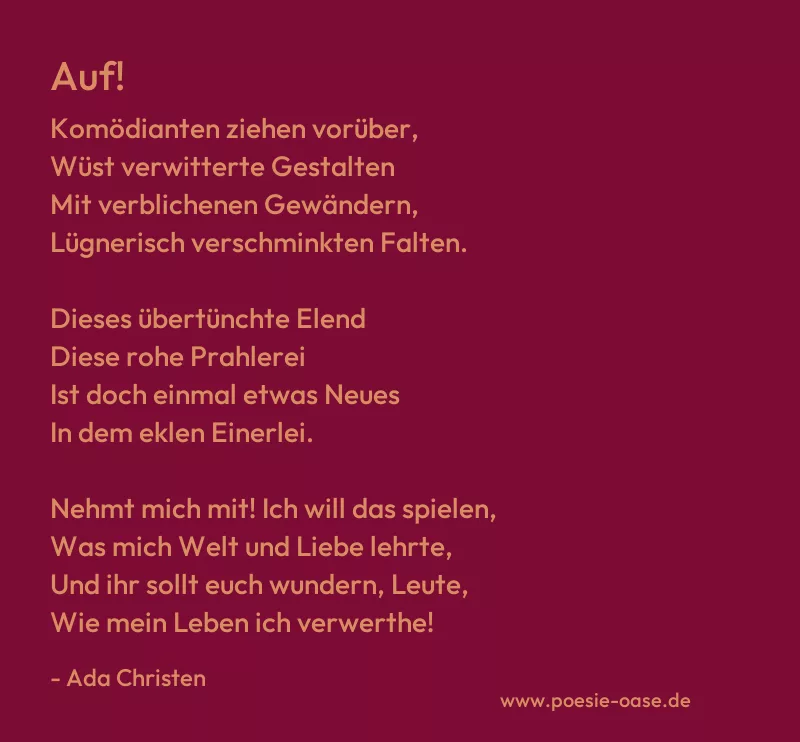
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Auf!“ von Ada Christen greift in kurzer, prägnanter Form das Motiv der Außenseiterexistenz auf und verbindet es mit einem rebellischen, fast triumphalen Ton. Die Komödiantengruppe, an der das lyrische Ich vorbeizieht oder an der es sich anschließen möchte, wird zum Sinnbild einer Lebensform jenseits bürgerlicher Konventionen – zerschlissen, verwittert, aber lebendig und offen für Ausdruck.
Schon in der ersten Strophe werden die „Komödianten“ als Figuren des Elends beschrieben: „wüst verwitterte Gestalten“ mit „verbleichten Gewändern“ und „verschminkten Falten“. Die Maskerade der Bühne wird hier mit der Maskerade des Lebens gleichgesetzt. Es ist eine armselige Truppe – und doch strahlt sie eine Art Anziehungskraft aus. Gerade in ihrer „Lügnerisch[en]“ Erscheinung liegt eine Wahrheit über das Leben, das ebenfalls aus Täuschung, Verschleiß und Masken besteht.
In der zweiten Strophe kontrastiert diese bunte, rohe Erscheinung mit dem „eklen Einerlei“, also der monotonen, erstarrten Alltagswelt. Das scheinbar armselige Schauspiel bietet immerhin noch etwas Neues, Unberechenbares – eine Art Ausbruch aus der Lähmung. Das lyrische Ich empfindet diesen Ausbruch nicht als Flucht, sondern als Möglichkeit zur Selbstverwirklichung.
Die letzte Strophe bringt den Wendepunkt: Das lyrische Ich will Teil dieser fahrenden Welt werden, will „spielen, / Was mich Welt und Liebe lehrte“. Es handelt sich nicht um bloße Fluchtfantasie, sondern um eine bewusste Aneignung des eigenen Schmerzes. Das Leiden soll zur Darstellung gebracht, zum Ausdrucksmittel gemacht werden. Mit fast trotzigem Stolz kündigt das Ich an, sein Leben zu „verwerthe[n]“ – als Kunst, als Spiel, als Befreiung.
Christen gelingt in wenigen Versen die Darstellung einer existenziellen Haltung: Der Schmerz wird nicht verborgen, sondern öffentlich gemacht; das Scheitern wird nicht verdrängt, sondern in kreative Energie verwandelt. Das Gedicht ist ein kraftvolles Bekenntnis zum Ausdruck des Individuums – auch (und gerade) wenn es am Rand der Gesellschaft steht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.