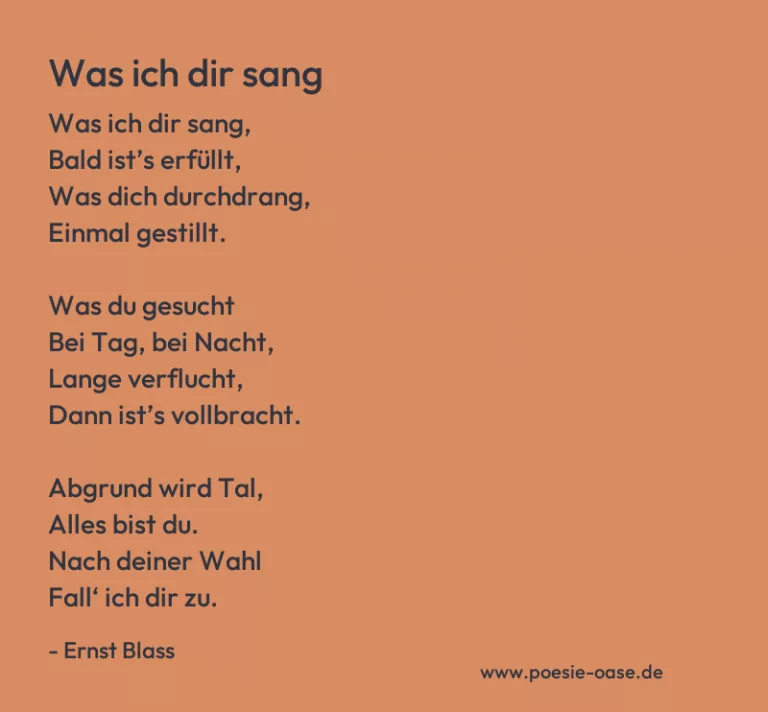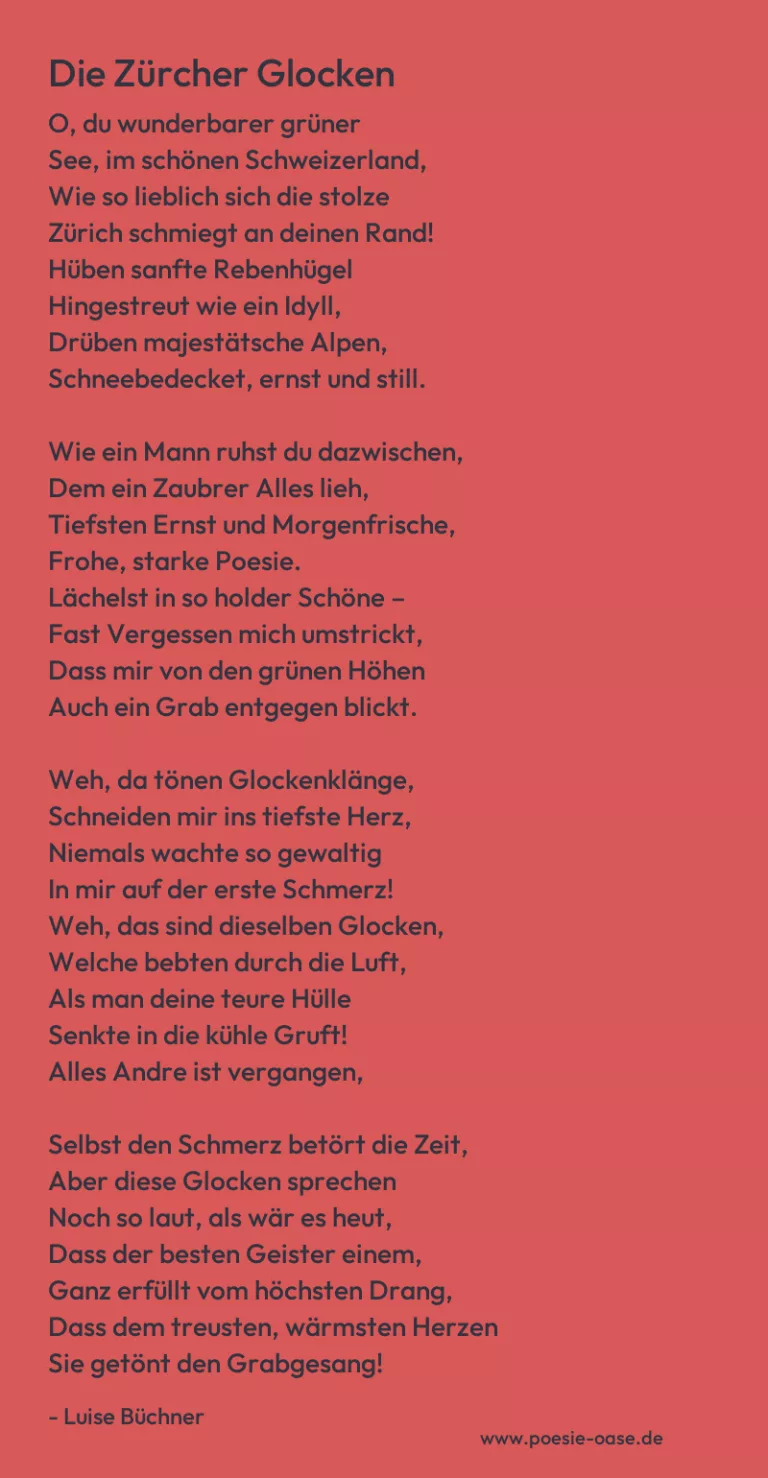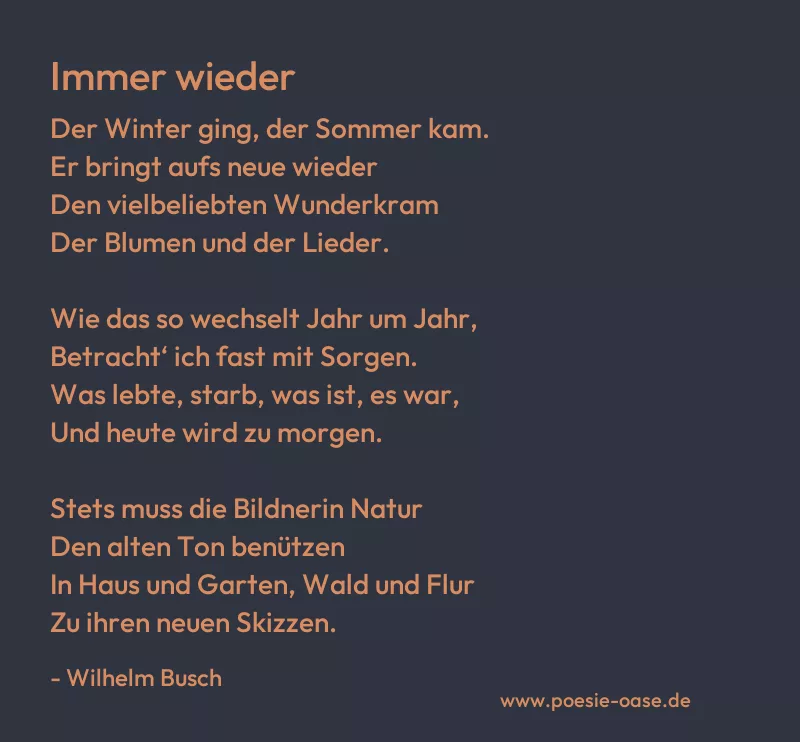Immer wieder
Der Winter ging, der Sommer kam.
Er bringt aufs neue wieder
Den vielbeliebten Wunderkram
Der Blumen und der Lieder.
Wie das so wechselt Jahr um Jahr,
Betracht‘ ich fast mit Sorgen.
Was lebte, starb, was ist, es war,
Und heute wird zu morgen.
Stets muss die Bildnerin Natur
Den alten Ton benützen
In Haus und Garten, Wald und Flur
Zu ihren neuen Skizzen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
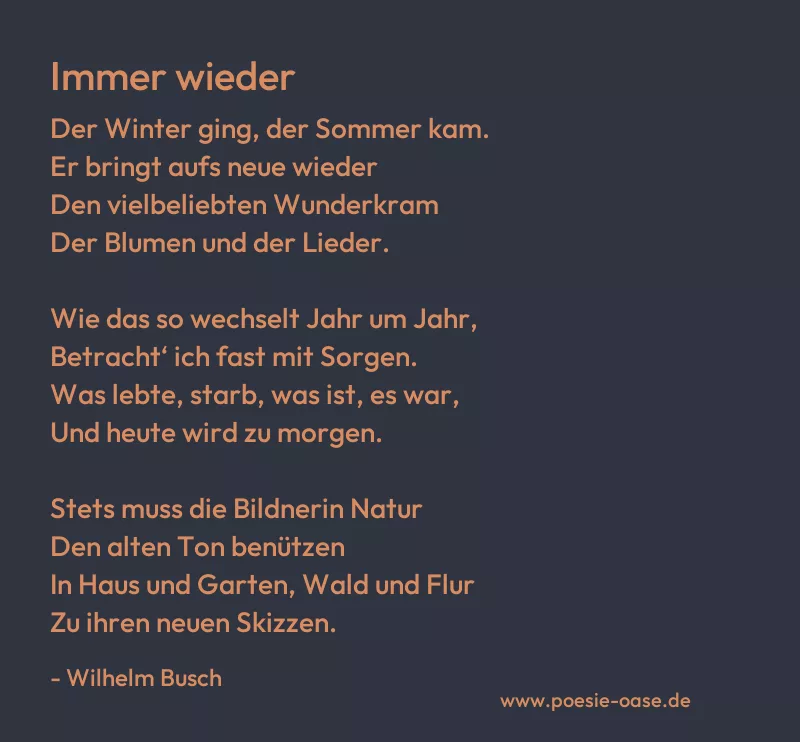
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Immer wieder“ von Wilhelm Busch reflektiert den stetigen Kreislauf der Natur und die Vergänglichkeit des Lebens. Der Wechsel der Jahreszeiten, konkret der Übergang vom Winter zum Sommer, bringt „aufs neue wieder“ die vertrauten Zeichen des Lebens: Blumen und Lieder. Diese Wiederkehr der Naturerscheinungen wird als etwas Wunderbares, aber auch als etwas Unvermeidliches dargestellt.
In der zweiten Strophe nimmt das Gedicht eine nachdenklichere Wendung. Das lyrische Ich erkennt in diesem Wechsel nicht nur die Schönheit der Natur, sondern auch die Vergänglichkeit aller Dinge. Der konstante Wandel führt dazu, dass alles, was existiert, unweigerlich der Vergangenheit angehören wird. Die Zeile „Was lebte, starb, was ist, es war“ bringt diese melancholische Einsicht besonders prägnant zum Ausdruck.
Die letzte Strophe beschreibt die Natur als eine unermüdliche Künstlerin, die stets dieselben Elemente verwendet, um Neues zu erschaffen. Die „Bildnerin Natur“ greift immer wieder auf bekannte Muster zurück, sei es in der Landschaft oder im menschlichen Leben. Dadurch entsteht ein Gefühl von Kontinuität, aber auch von Unvermeidbarkeit. Insgesamt verbindet das Gedicht eine Bewunderung für die Natur mit einer leisen Melancholie über den stetigen Fluss der Zeit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.