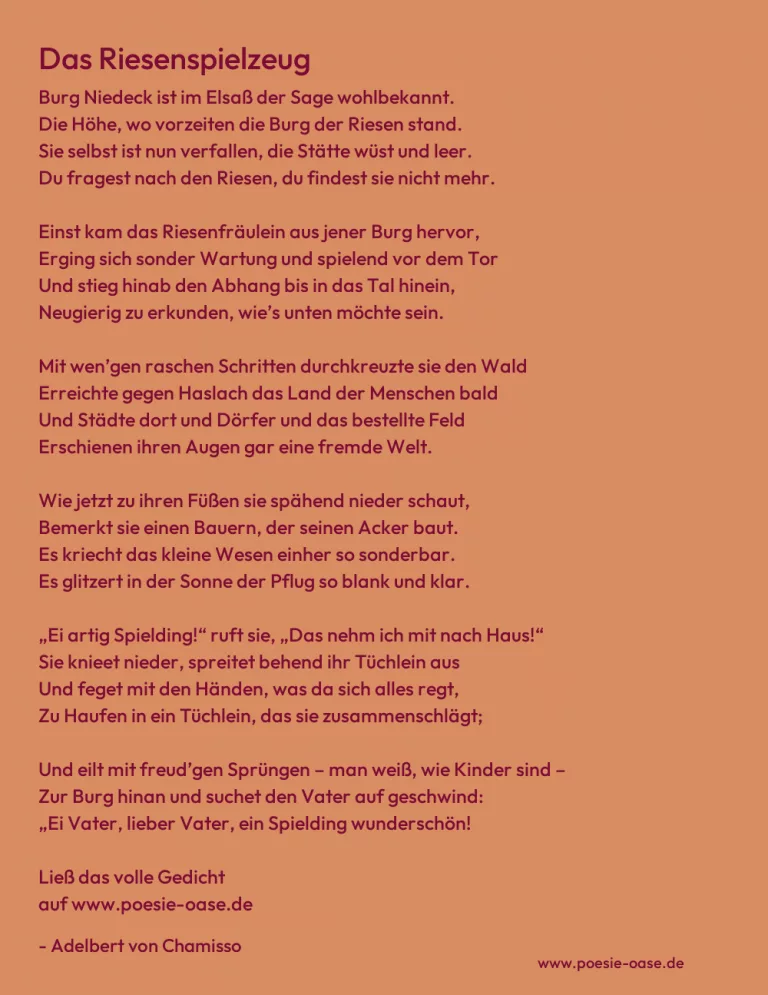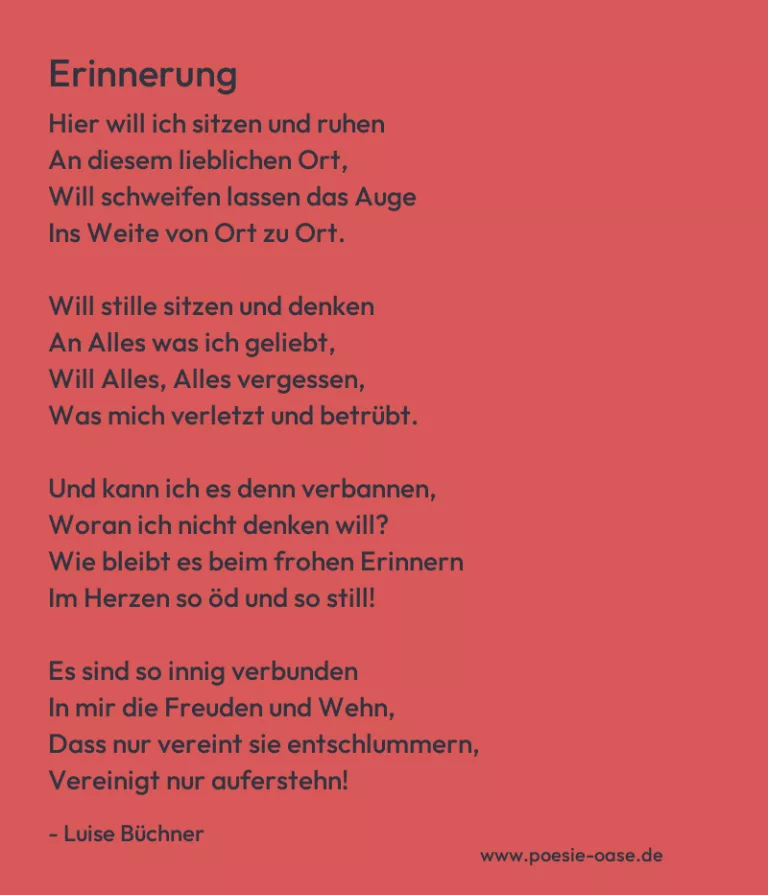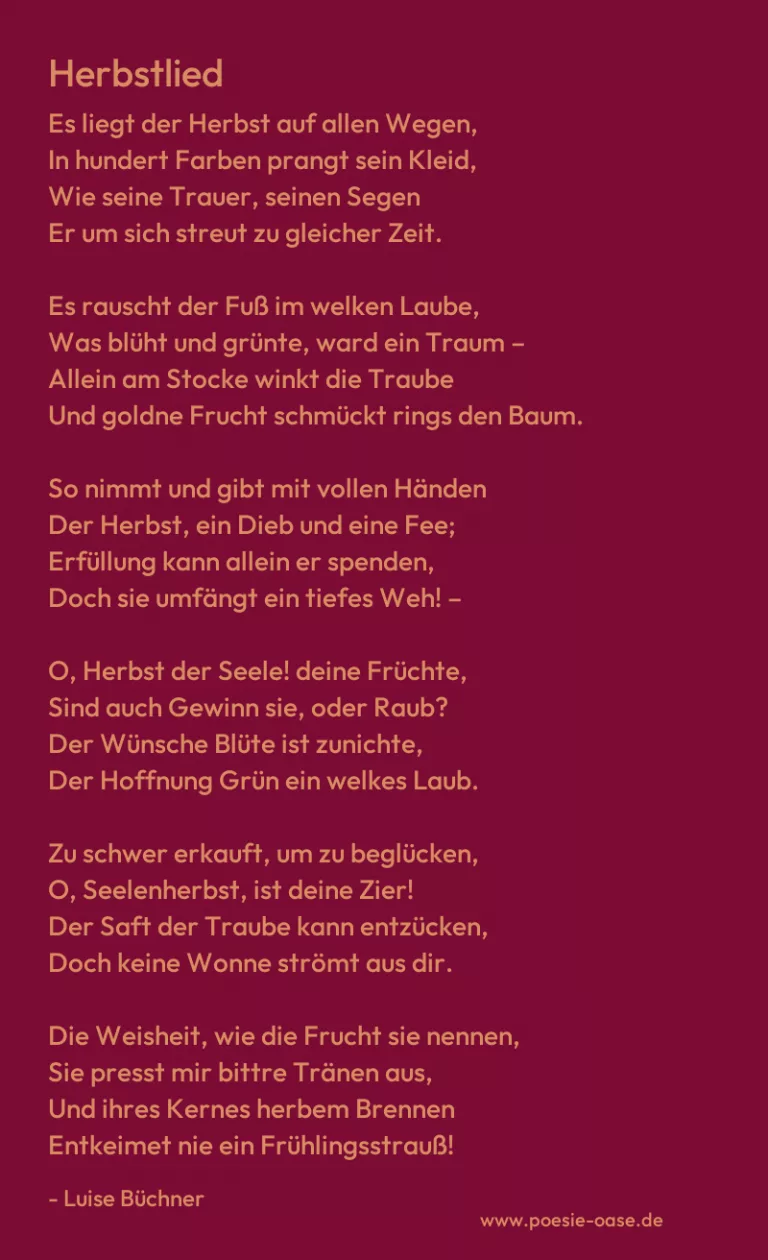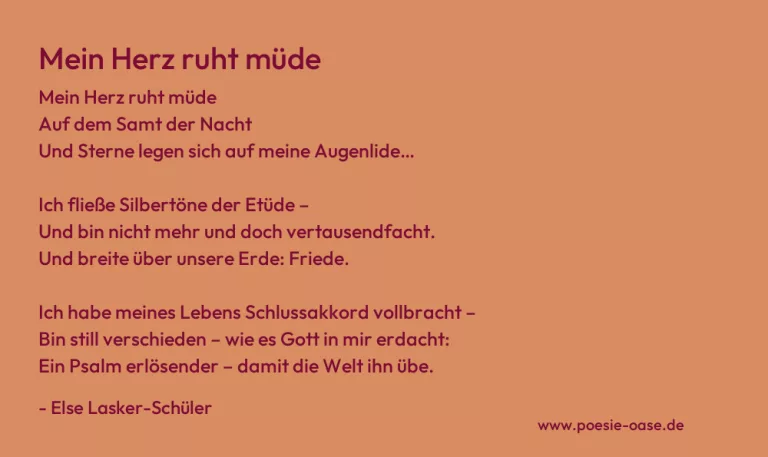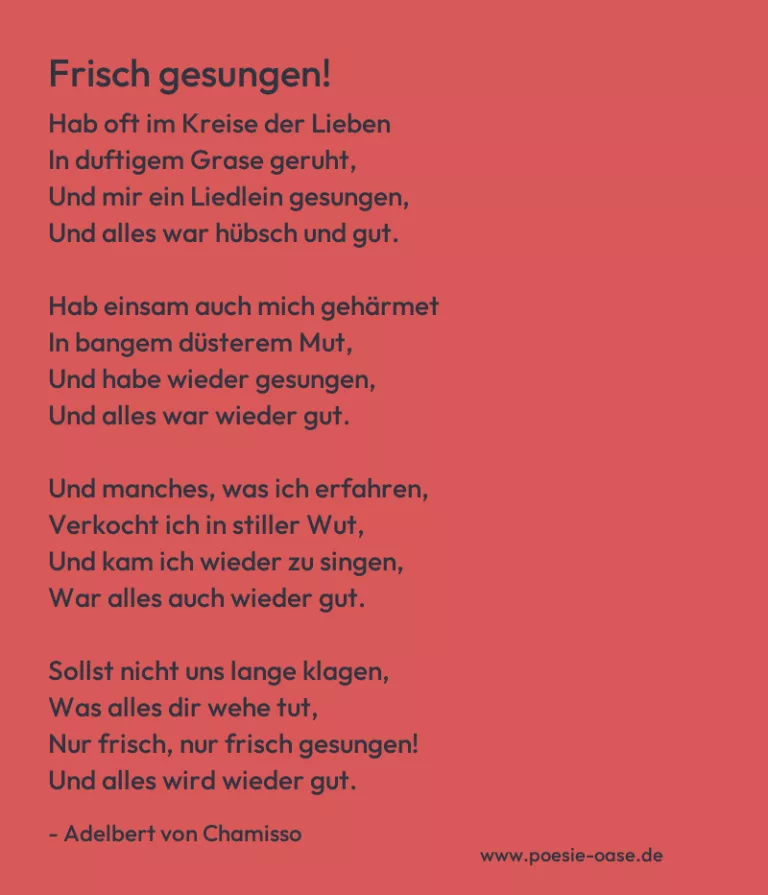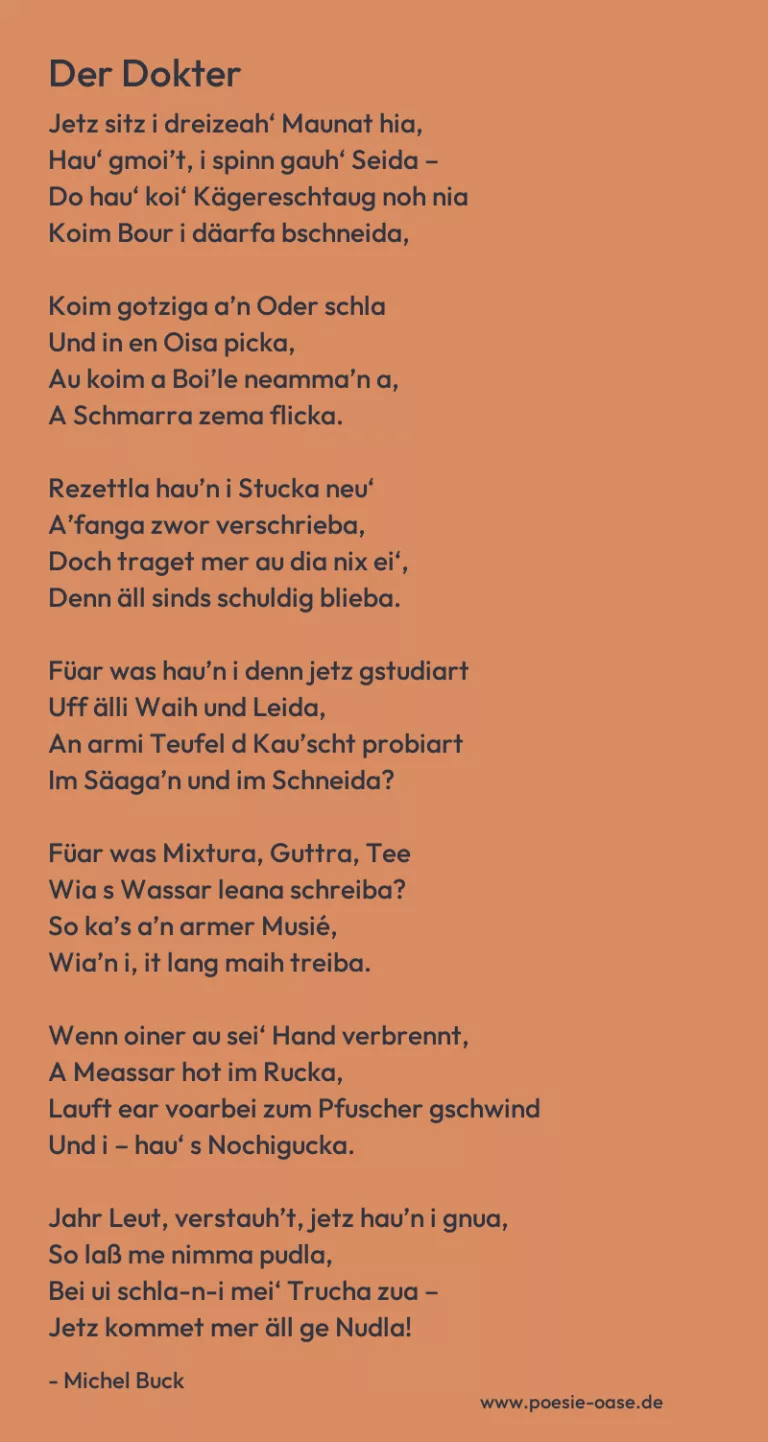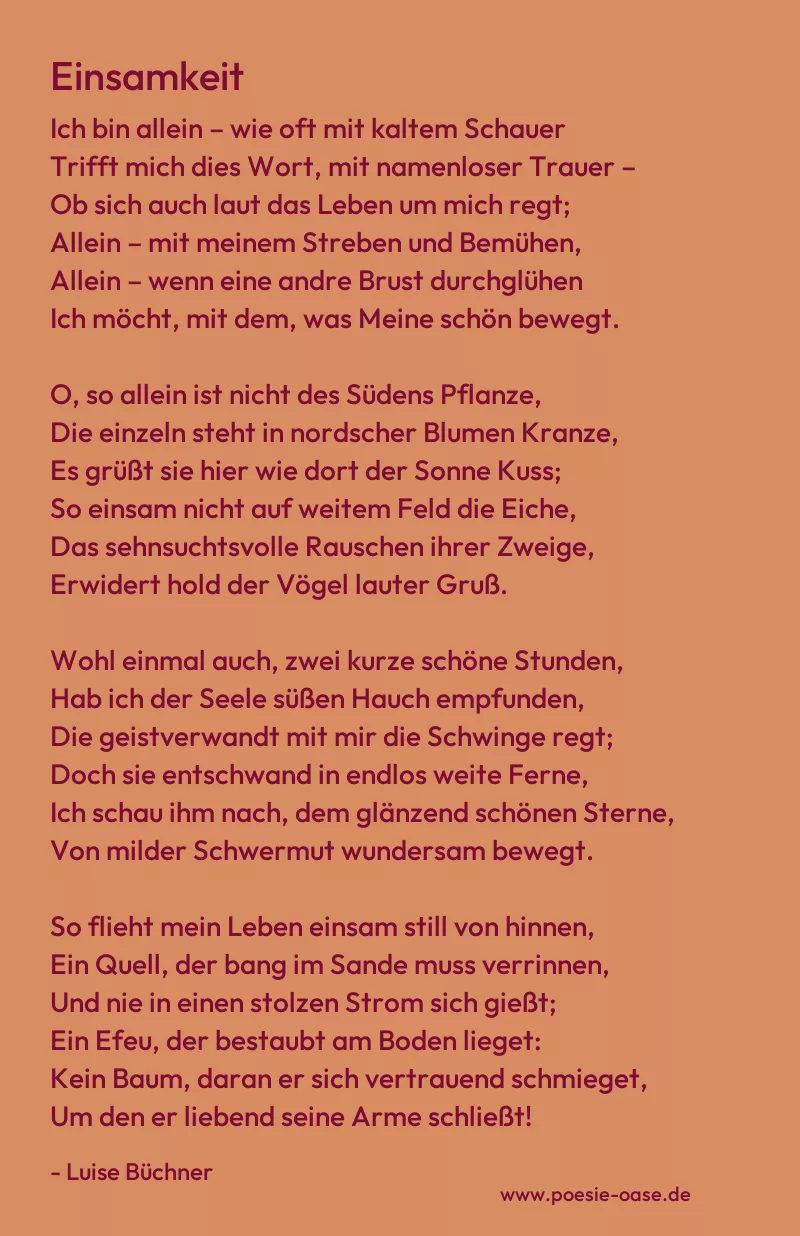Abenteuer & Reisen, Alltag, Einsamkeit, Emotionen & Gefühle, Fleiß, Freiheit & Sehnsucht, Gegenwart, Gemeinfrei, Glaube & Spiritualität, Heimat & Identität, Herzschmerz, Leichtigkeit, Liebe & Romantik, Natur, Sommer, Wälder & Bäume, Weihnachten
Einsamkeit
Ich bin allein – wie oft mit kaltem Schauer
Trifft mich dies Wort, mit namenloser Trauer –
Ob sich auch laut das Leben um mich regt;
Allein – mit meinem Streben und Bemühen,
Allein – wenn eine andre Brust durchglühen
Ich möcht, mit dem, was Meine schön bewegt.
O, so allein ist nicht des Südens Pflanze,
Die einzeln steht in nordscher Blumen Kranze,
Es grüßt sie hier wie dort der Sonne Kuss;
So einsam nicht auf weitem Feld die Eiche,
Das sehnsuchtsvolle Rauschen ihrer Zweige,
Erwidert hold der Vögel lauter Gruß.
Wohl einmal auch, zwei kurze schöne Stunden,
Hab ich der Seele süßen Hauch empfunden,
Die geistverwandt mit mir die Schwinge regt;
Doch sie entschwand in endlos weite Ferne,
Ich schau ihm nach, dem glänzend schönen Sterne,
Von milder Schwermut wundersam bewegt.
So flieht mein Leben einsam still von hinnen,
Ein Quell, der bang im Sande muss verrinnen,
Und nie in einen stolzen Strom sich gießt;
Ein Efeu, der bestaubt am Boden lieget:
Kein Baum, daran er sich vertrauend schmieget,
Um den er liebend seine Arme schließt!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
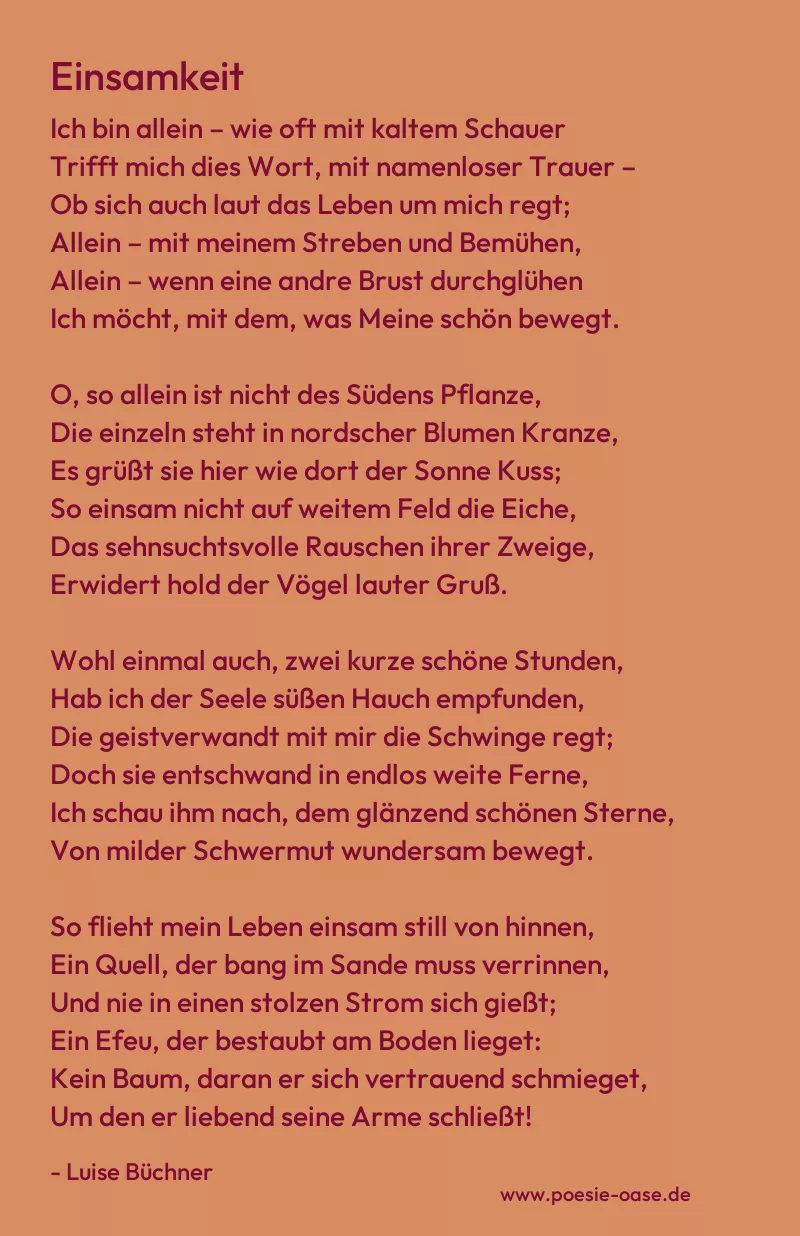
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Einsamkeit“ von Luise Büchner spiegelt die tief empfundene Einsamkeit und die damit verbundene innere Trauer des Sprechers wider. Das Wort „allein“ wird immer wieder wiederholt, was die erdrückende Last der Einsamkeit verstärkt. Obwohl das äußere Leben um den Sprecher herum aktiv ist, bleibt er innerlich isoliert – ein Zustand, den er als unerträglich empfindet. Der Sprecher sehnt sich nach einer Verbindung, einem Miteinander, das ihm jedoch verwehrt bleibt.
Der zweite Teil des Gedichts bringt ein Bild der Natur ins Spiel, das eine Kontrastfigur zur Einsamkeit des Sprechers darstellt. Die „Pflanze“ im Süden und die „Eiche“ auf dem weiten Feld sind Symbole für Lebensräume, in denen ein lebendiger Austausch mit der Umwelt stattfindet. Die Pflanze wird von der Sonne geküsst, und die Eiche erfährt die Freude des „Vogels“ in ihren Zweigen. Diese Bilder stehen für ein Leben, das in Gemeinschaft und Harmonie blüht, während der Sprecher sich nach einer solchen Verbindung sehnt, aber diese nie erreicht.
Das Gedicht beschreibt auch eine kurze Zeit des Trostes, als der Sprecher „der Seele süßen Hauch“ empfand und für kurze Zeit eine „geistverwandte“ Nähe erlebte. Doch diese Erfahrung war nur flüchtig und verschwand ebenso schnell wieder, wie sie gekommen war. Der „glänzend schöne Stern“ symbolisiert diese verpasste Chance auf tiefe Verbundenheit, und der Sprecher bleibt in einer Mischung aus Sehnsucht und Schwermut zurück.
Am Ende des Gedichts wird die Einsamkeit noch einmal dramatisch hervorgehoben. Das Bild des „Quells“, der „im Sande muss verrinnen“, und des „Efeus“, der „am Boden lieget“, verstärkt die Vorstellung vom Verfall und der fehlenden Entfaltungskraft. Der Efeu, der keine Unterstützung findet, bleibt ungenutzt und verliert sich in der Isolation. Diese Symbole des Scheiterns und der Vergeblichkeit verdeutlichen die tiefe Verzweiflung des Sprechers, der in seiner Einsamkeit gefangen bleibt und keine Möglichkeit sieht, daraus zu entkommen.
Das Gedicht behandelt die existenzielle Frage nach Verbindung und Gemeinschaft und zeigt die emotionale Wunde der Einsamkeit als einen Zustand, der nicht nur äußere, sondern auch innere Leere erzeugt. Es wird die Sehnsucht nach einem „anderen“ als seelischer Erfüllung ausgedrückt, doch gleichzeitig wird die Unmöglichkeit dieser Erfüllung betont.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.