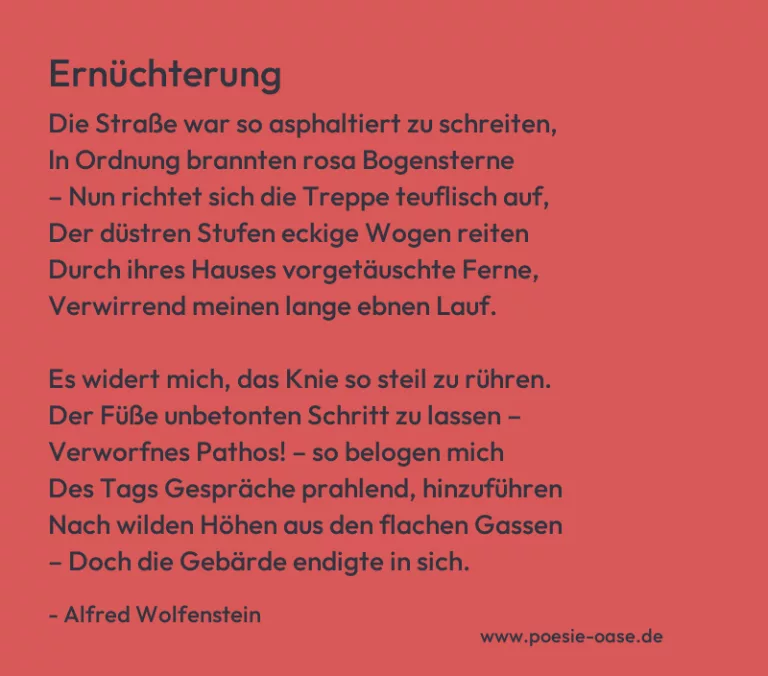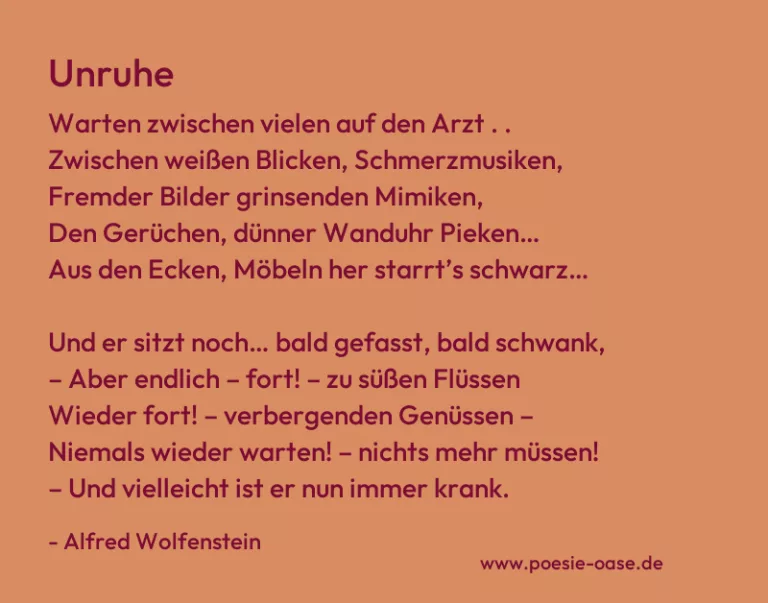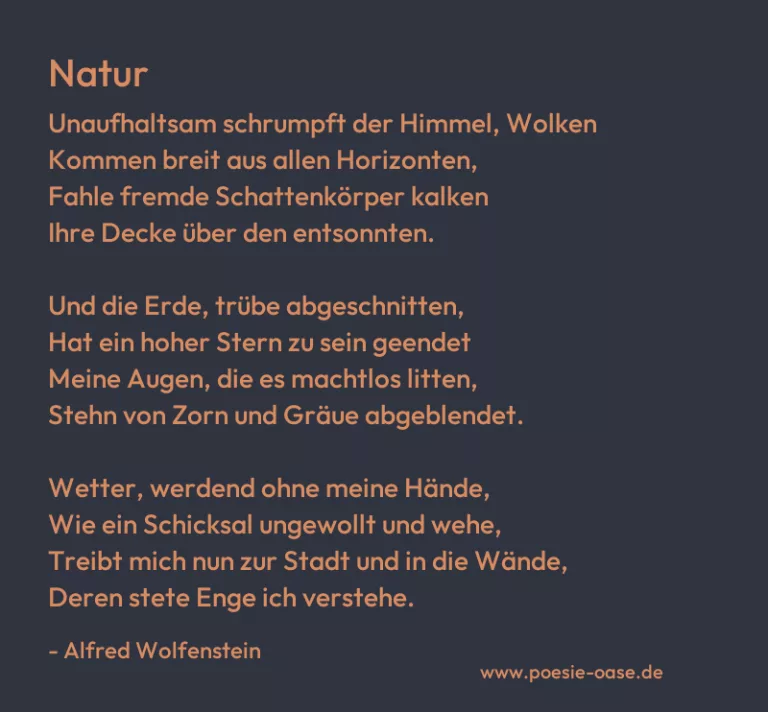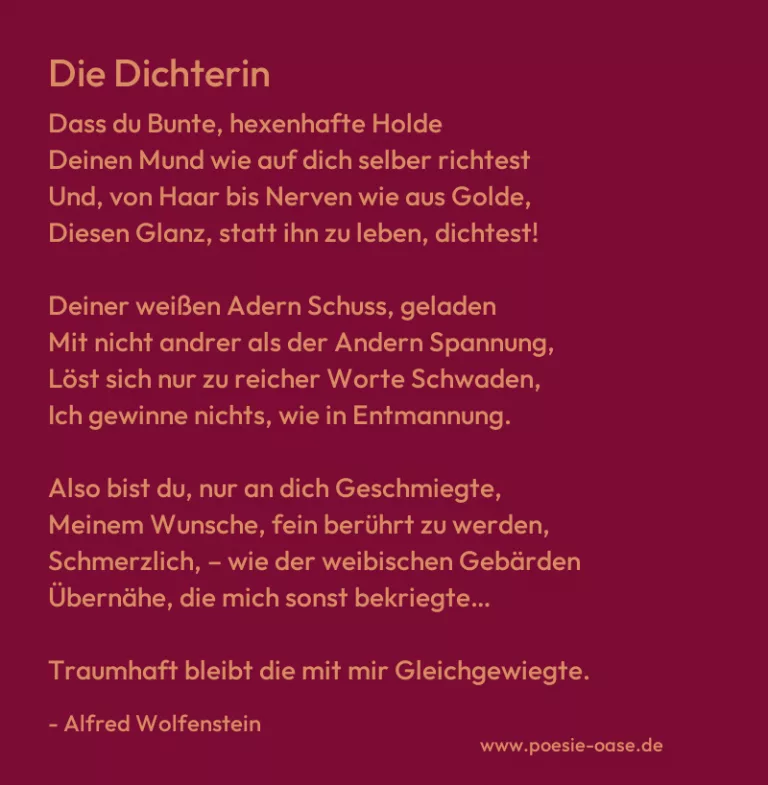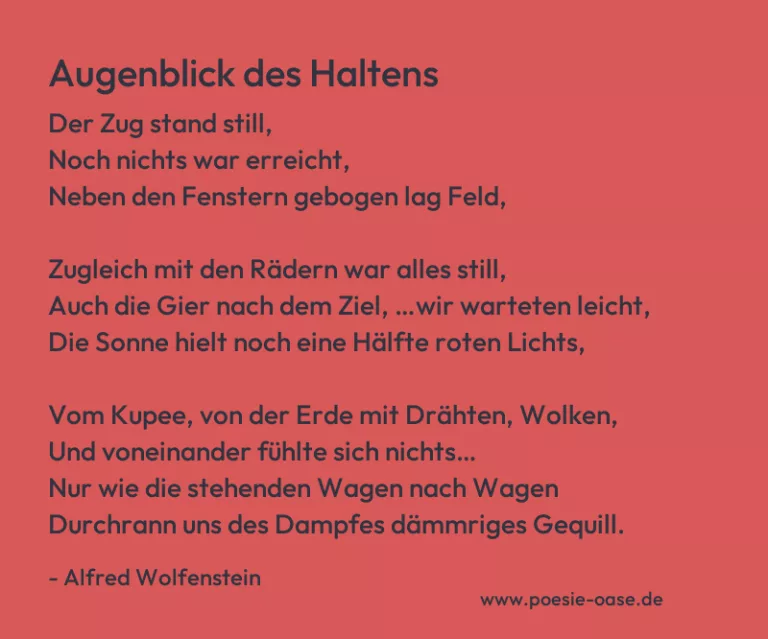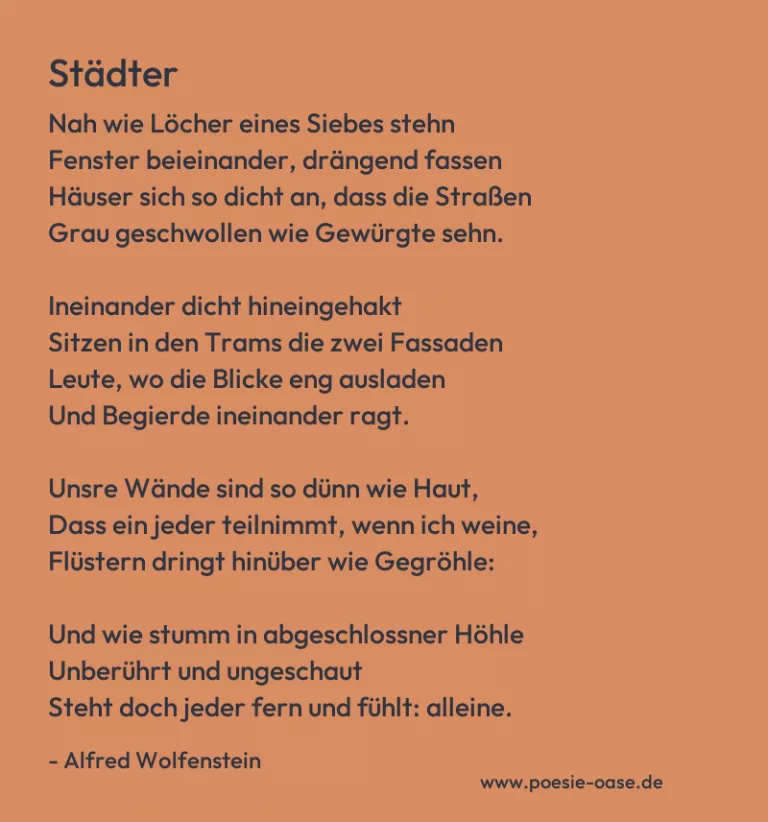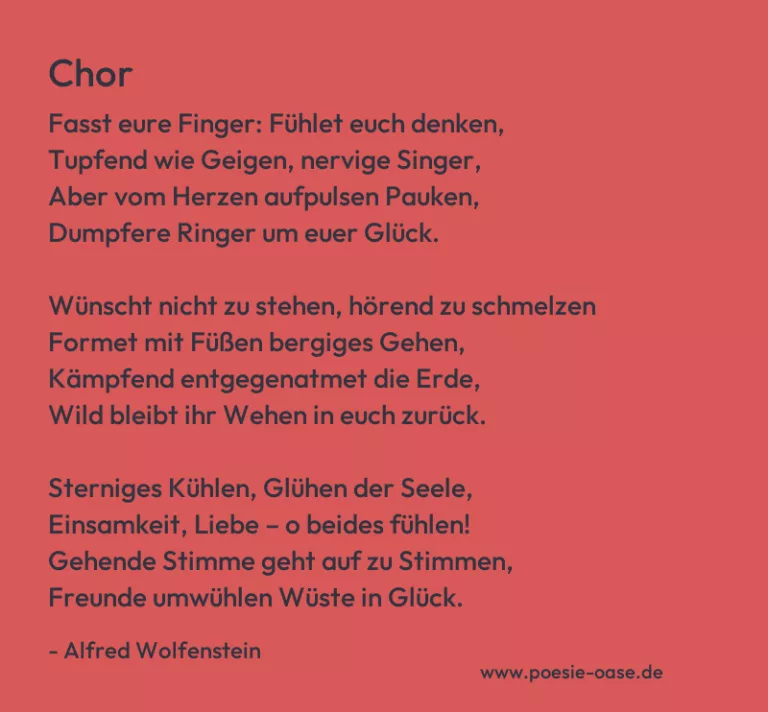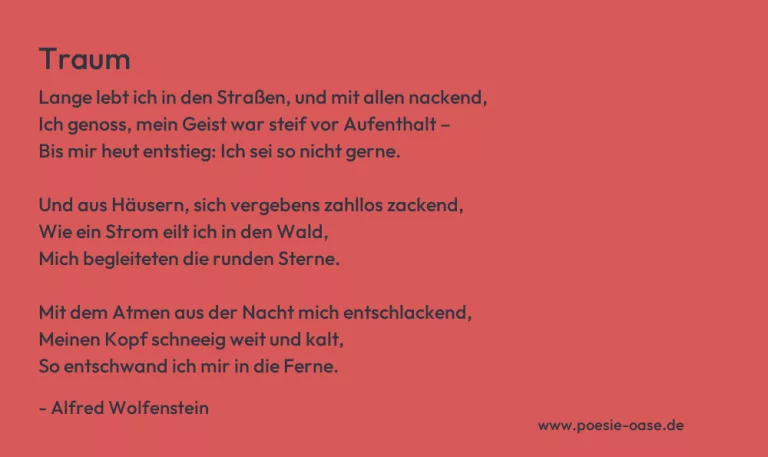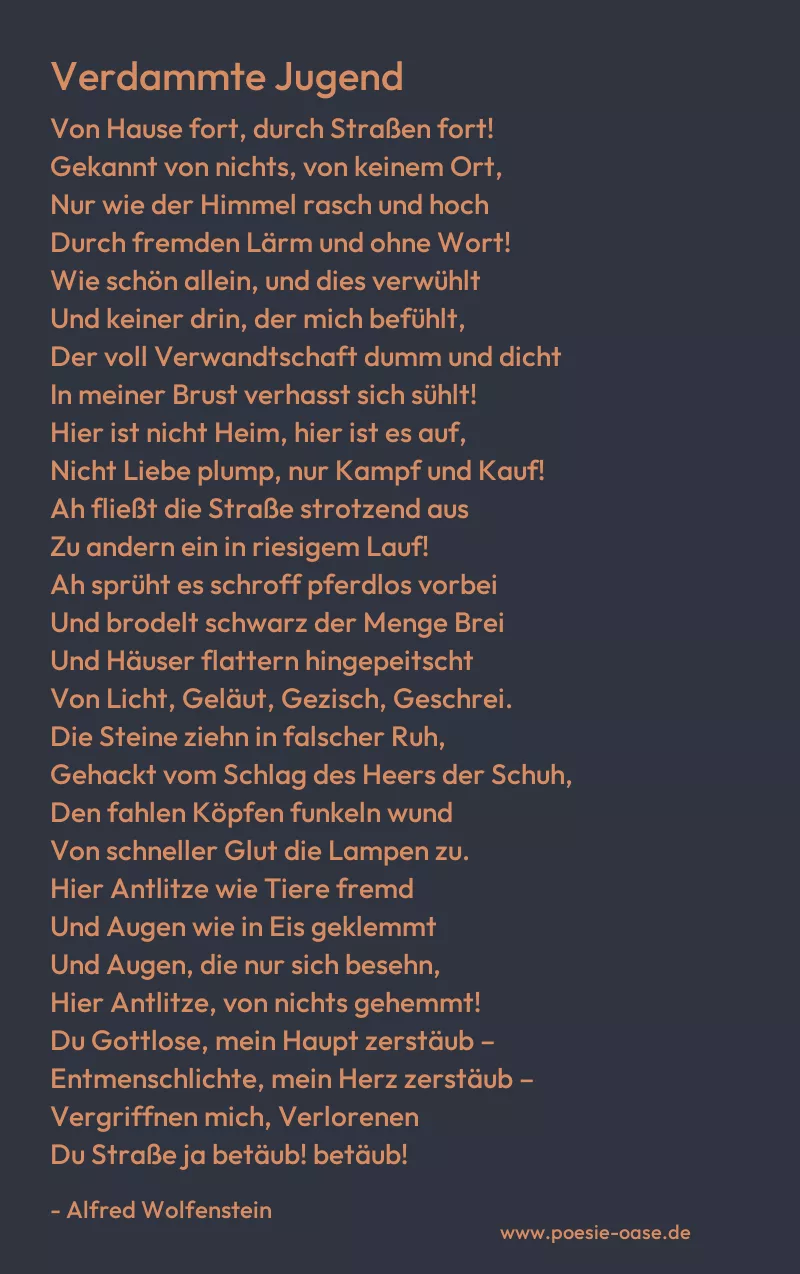Angst, Emotionen & Gefühle, Gegenwart, Gemeinfrei, Götter, Helden & Prinzessinnen, Krieg, Natur, Unschuld, Winter, Wut
Verdammte Jugend
Von Hause fort, durch Straßen fort!
Gekannt von nichts, von keinem Ort,
Nur wie der Himmel rasch und hoch
Durch fremden Lärm und ohne Wort!
Wie schön allein, und dies verwühlt
Und keiner drin, der mich befühlt,
Der voll Verwandtschaft dumm und dicht
In meiner Brust verhasst sich sühlt!
Hier ist nicht Heim, hier ist es auf,
Nicht Liebe plump, nur Kampf und Kauf!
Ah fließt die Straße strotzend aus
Zu andern ein in riesigem Lauf!
Ah sprüht es schroff pferdlos vorbei
Und brodelt schwarz der Menge Brei
Und Häuser flattern hingepeitscht
Von Licht, Geläut, Gezisch, Geschrei.
Die Steine ziehn in falscher Ruh,
Gehackt vom Schlag des Heers der Schuh,
Den fahlen Köpfen funkeln wund
Von schneller Glut die Lampen zu.
Hier Antlitze wie Tiere fremd
Und Augen wie in Eis geklemmt
Und Augen, die nur sich besehn,
Hier Antlitze, von nichts gehemmt!
Du Gottlose, mein Haupt zerstäub –
Entmenschlichte, mein Herz zerstäub –
Vergriffnen mich, Verlorenen
Du Straße ja betäub! betäub!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
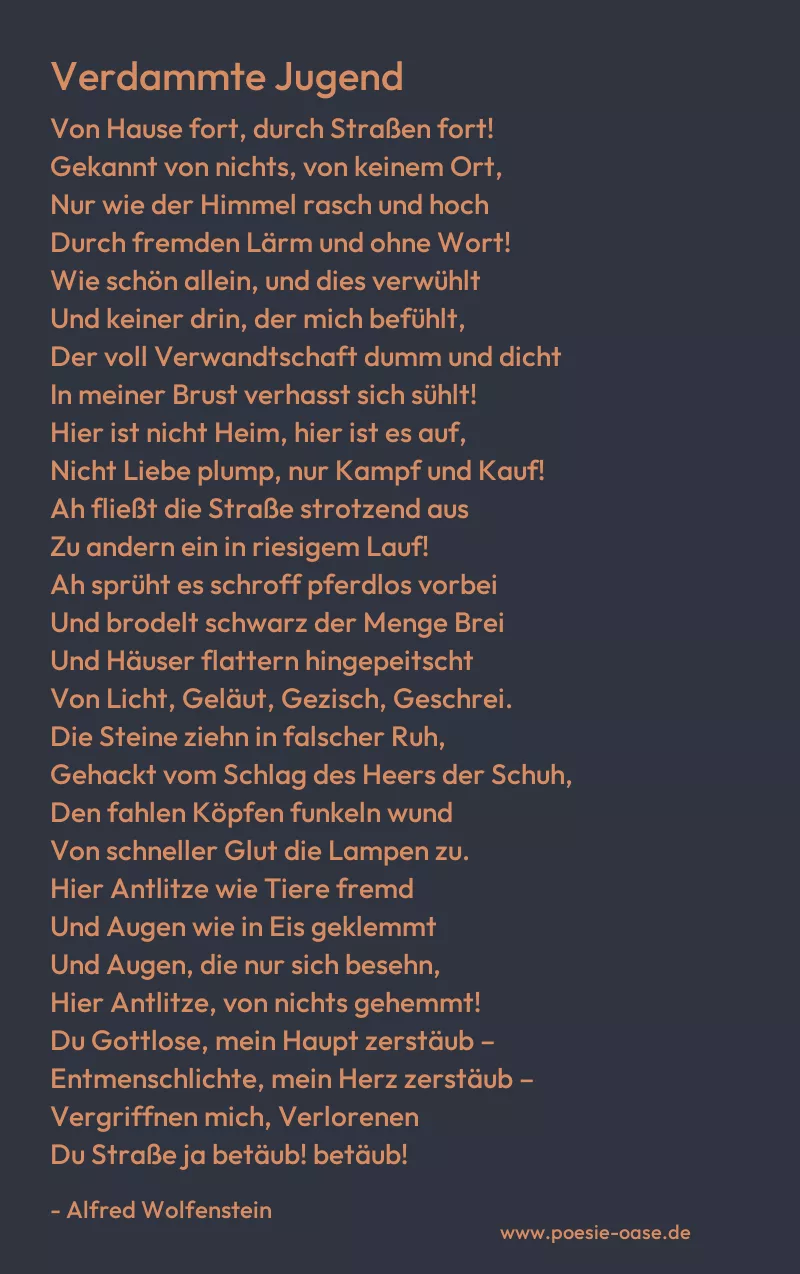
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Verdammte Jugend“ von Alfred Wolfenstein beschreibt in kraftvollen, teils chaotischen Bildern die Entfremdung und Verwirrung, die der Sprecher in der modernen, städtischen Welt empfindet. Der Beginn, „Von Hause fort, durch Straßen fort!“, signalisiert einen Drang zur Flucht und einen Bruch mit der Vergangenheit. Die Stadt, ein Ort der Unbekanntheit und des Lärms, wird als fremd und isolierend dargestellt. Die Worte „Nur wie der Himmel rasch und hoch / Durch fremden Lärm und ohne Wort!“ verdeutlichen das Gefühl der Entwurzelung und den Mangel an echten, tiefen Verbindungen zu anderen Menschen.
Der Sprecher erlebt die Stadt als einen Ort der Entfremdung, in dem er sich weder zugehörig fühlt noch in irgendeiner Weise verstanden wird. „Wie schön allein, und dies verwühlt“ drückt eine bittere Einsamkeit aus, die mit der Unmittelbarkeit der urbanen Welt kollidiert. Es gibt keinen Platz für echte Liebe oder Zugehörigkeit, sondern nur für „Kampf und Kauf“, was die Oberflächlichkeit und das Streben nach materiellen Dingen in der modernen Gesellschaft kritisiert. Diese Welt erscheint als ein unaufhörlicher Strom von Bewegung, der den Sprecher eher entmenschlicht als ihm eine Form von Erfüllung zu bieten.
Die zweite Strophe intensiviert das Bild der Stadt als einen Ort der Entfremdung und Gewalt. Der „riesige Lauf“ der Straße, der „schroff pferdlos vorbei“ sprühende Strom und das „brodelnde, schwarze Brei“ der Menschenmasse vermitteln das Gefühl eines unaufhaltsamen, chaotischen Flusses, der den Einzelnen verschlingt. Der Sprecher sieht die Menschen als „Antlitze wie Tiere fremd“ und „Augen wie in Eis geklemmt“, was auf eine tiefgehende Entmenschlichung und das Fehlen echter Kommunikation und Empathie hinweist. Die Menschen sind für ihn nur noch entfernte, unnahbare Wesen.
In den letzten Versen wird die Entfremdung noch stärker betont, als der Sprecher sich von der Stadt und den Menschen vollständig zerrissen fühlt. Die Worte „Du Gottlose, mein Haupt zerstäub – / Entmenschlichte, mein Herz zerstäub“ spiegeln den Schmerz und die Verzweiflung wider, die aus der Wahrnehmung einer Welt ohne Sinn und ohne Mitgefühl hervorgehen. Die Stadt wird hier als betäubend und zerstörerisch dargestellt, ein Ort, der den Sprecher sowohl körperlich als auch seelisch erdrückt. Wolfenstein kritisiert in diesem Gedicht nicht nur die gesellschaftlichen Zustände, sondern zeigt auch die Zerrissenheit und das innere Chaos der modernen Jugend, die sich in einer Welt der Entfremdung und der Oberflächlichkeit verliert.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.