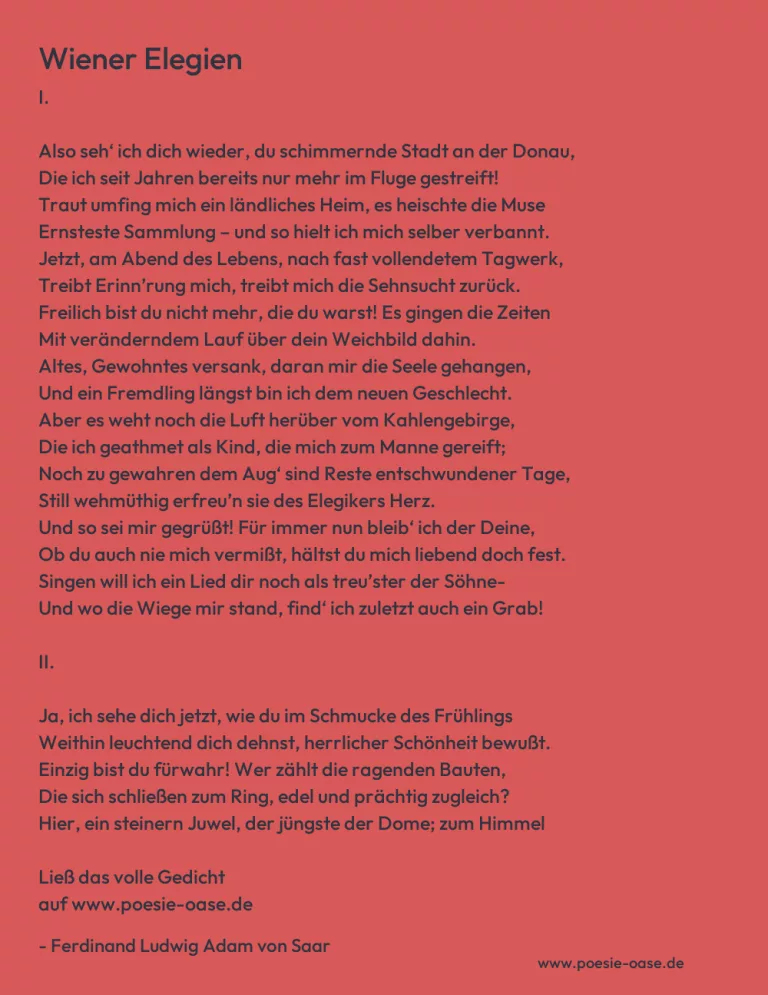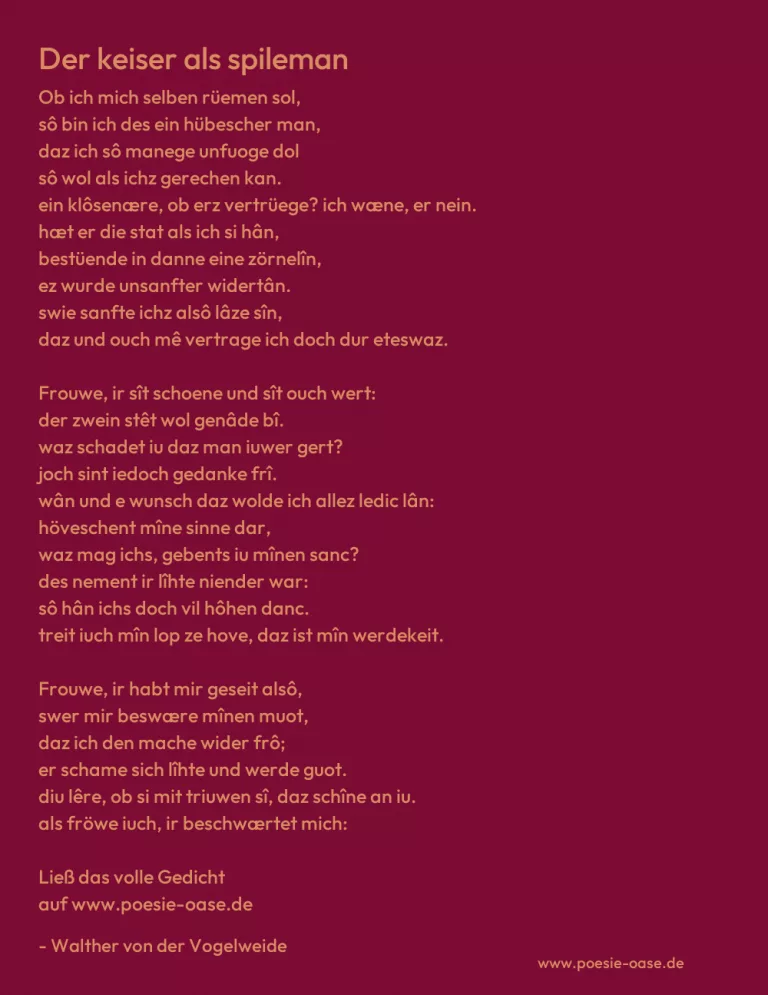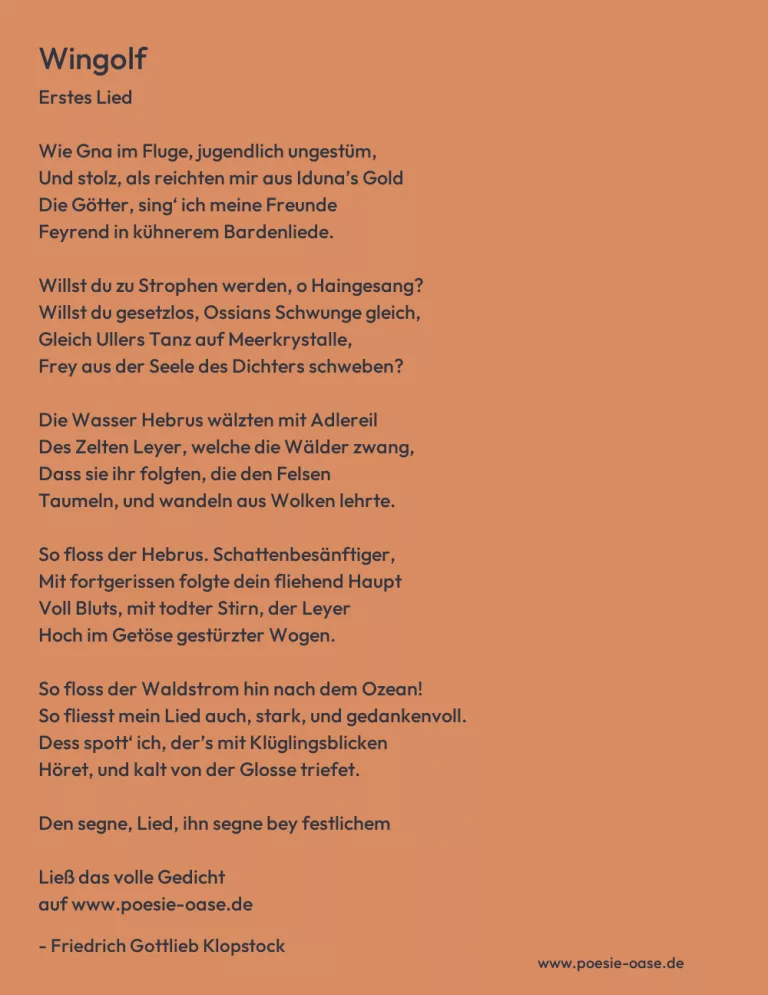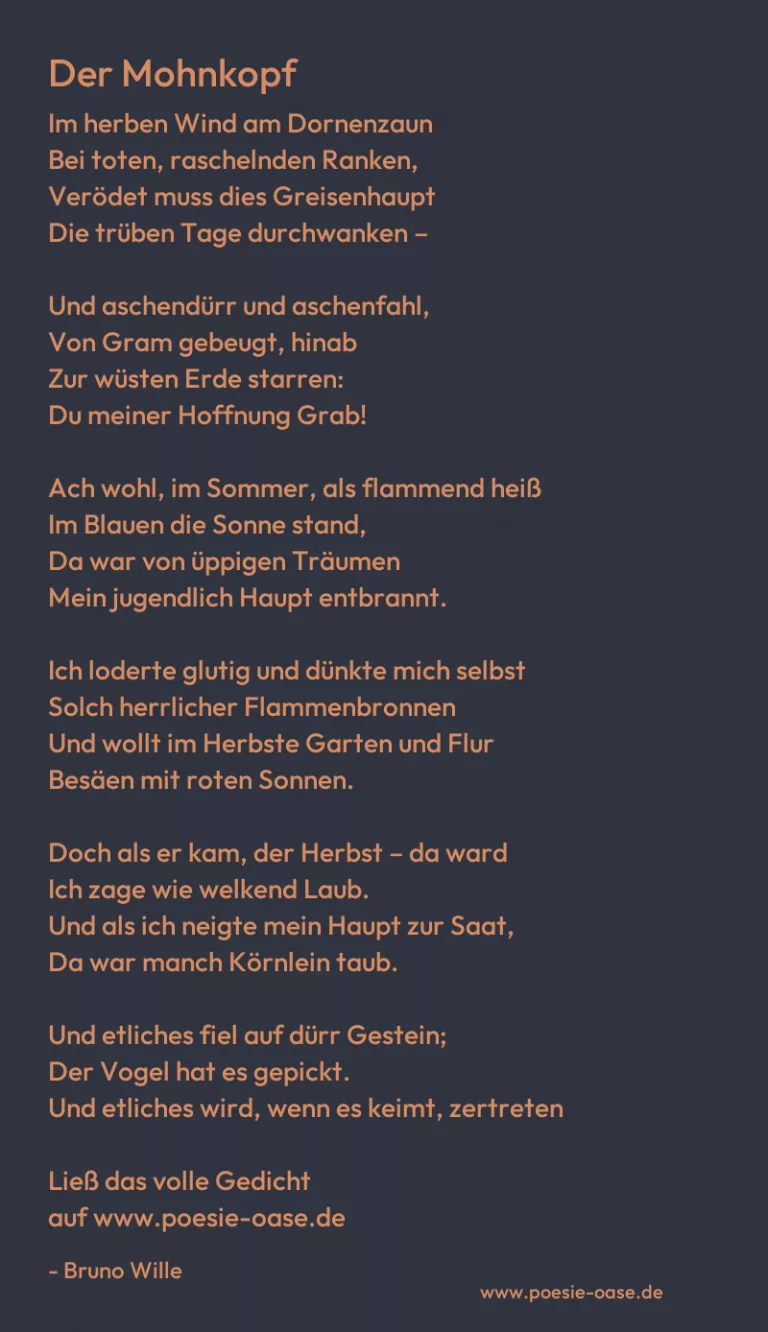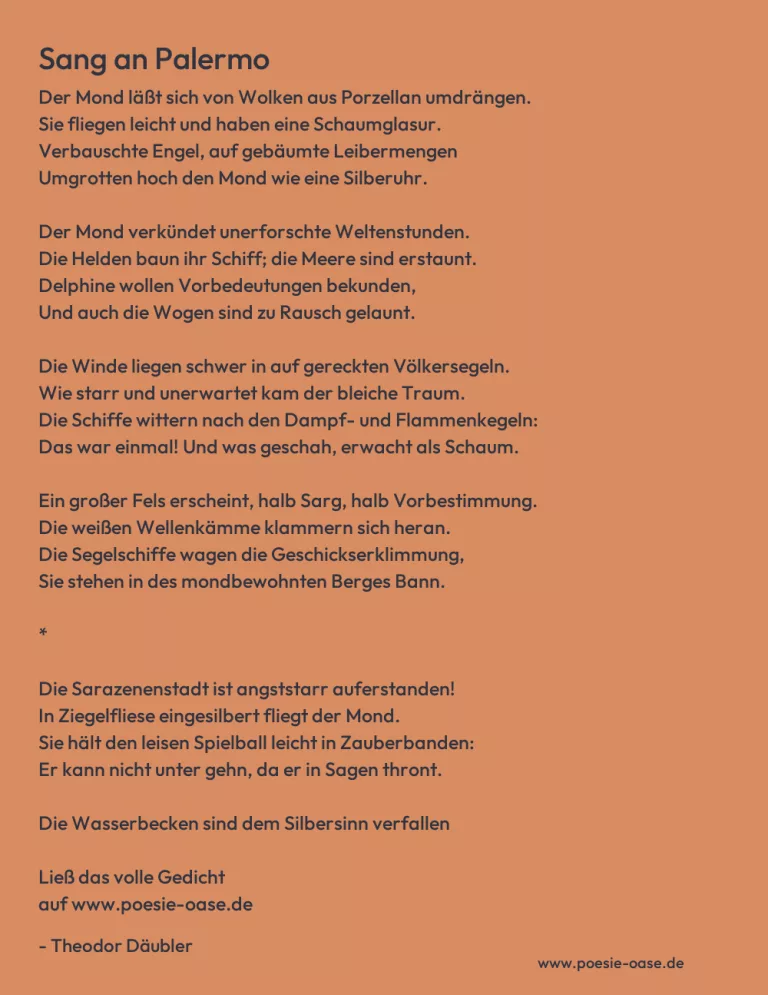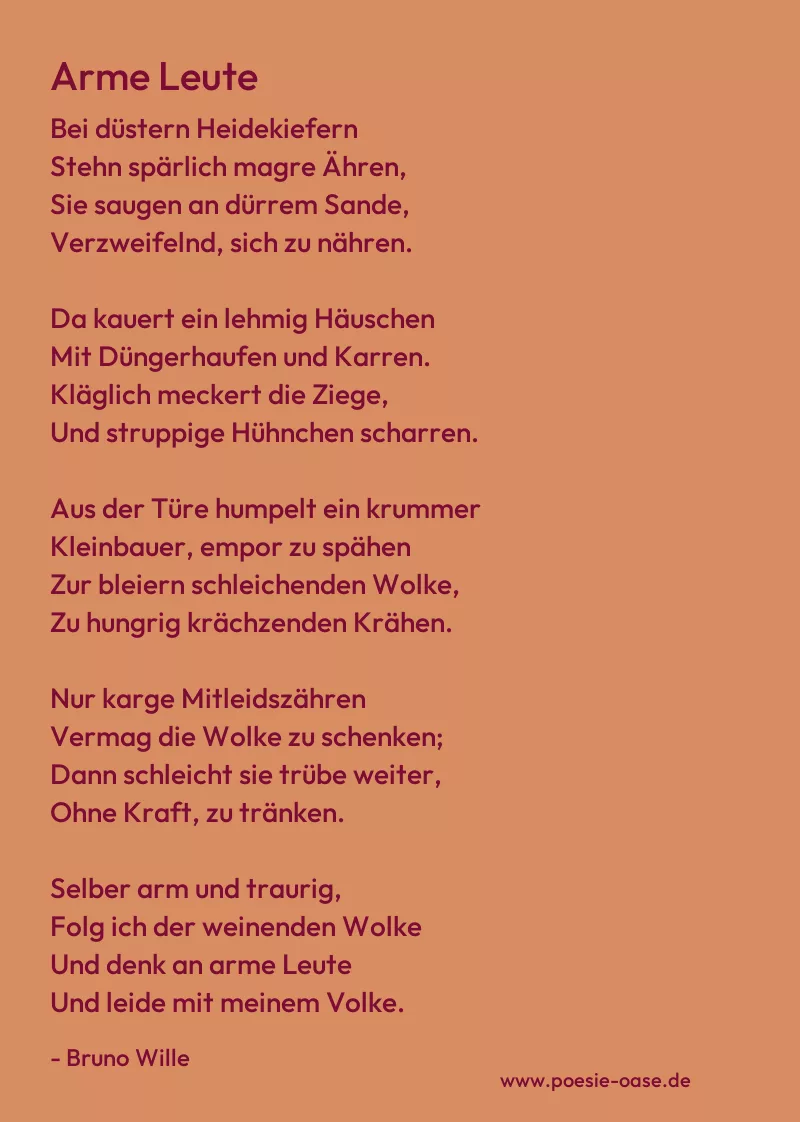Arme Leute
Bei düstern Heidekiefern
Stehn spärlich magre Ähren,
Sie saugen an dürrem Sande,
Verzweifelnd, sich zu nähren.
Da kauert ein lehmig Häuschen
Mit Düngerhaufen und Karren.
Kläglich meckert die Ziege,
Und struppige Hühnchen scharren.
Aus der Türe humpelt ein krummer
Kleinbauer, empor zu spähen
Zur bleiern schleichenden Wolke,
Zu hungrig krächzenden Krähen.
Nur karge Mitleidszähren
Vermag die Wolke zu schenken;
Dann schleicht sie trübe weiter,
Ohne Kraft, zu tränken.
Selber arm und traurig,
Folg ich der weinenden Wolke
Und denk an arme Leute
Und leide mit meinem Volke.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
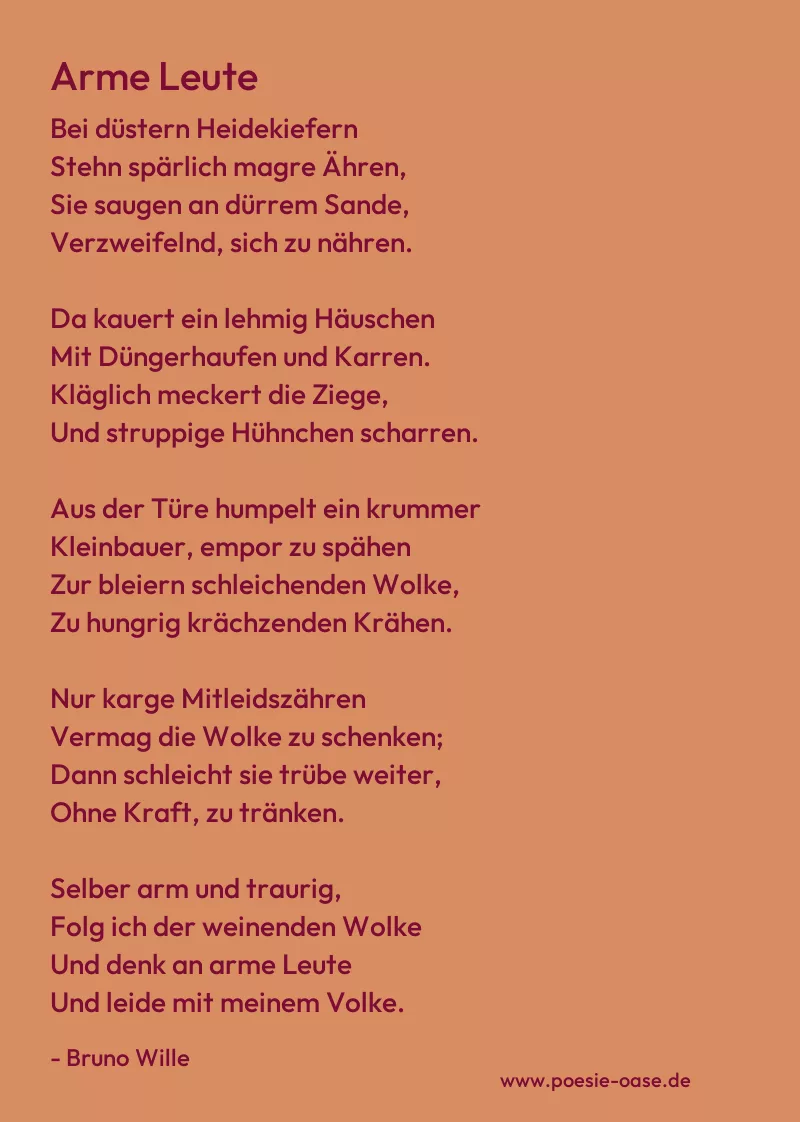
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Arme Leute“ von Bruno Wille beschreibt in eindrucksvoller Weise das harte Leben der ärmsten Schichten und die düstere, trostlose Welt, in der sie sich bewegen. Die „düsteren Heidekiefern“ und die „magre Ähren“ stehen für eine karge, von Entbehrung geprägte Landschaft. Die Natur erscheint hier nicht als Quelle des Lebens, sondern als Ort der Härte, an dem „dürrem Sande“ und kargen „Ähren“ die Not der Menschen symbolisiert wird. Diese Bilder unterstreichen die Strenge und den Mangel, den die Menschen erleben, und das verzweifelte Bemühen, auch unter extremen Bedingungen zu überleben.
Das Bild des „lehmigen Häuschens“ mit „Düngerhaufen und Karren“ verstärkt diese Vorstellung von Armut. Die Ziege, die „kläglich meckert“, und die „struppigen Hühnchen“, die scharren, zeigen die kümmerliche Existenz der Menschen, die in dieser entbehrungsreichen Welt leben. Die Tiere, die für die Bewohner einen Lebensunterhalt sichern sollen, erscheinen schwach und krank, was auf die generelle Verarmung der Umwelt und des Lebensumfeldes hinweist. Diese Darstellung des Alltags ist von einem Gefühl der Trostlosigkeit und des Verlusts geprägt.
Der „krumme Kleinbauer“, der aus der Tür humpelt und zu „bleiern schleichenden Wolken“ und „hungrig krächzenden Krähen“ aufblickt, verkörpert die Härte des Lebens und das ständige Streben nach Hoffnung, das dennoch unerfüllt bleibt. Die „bleierne“ Wolke und die „krächzenden Krähen“ symbolisieren den unerbittlichen Lauf der Natur und des Lebens, die den Bauern mit ihren Sorgen und Ängsten konfrontieren. Das Bild der Wolke, die „karge Mitleidszähren“ schenkt, verstärkt das Gefühl der Hilflosigkeit und die Vorstellung, dass die Natur zwar mitfühlend, aber letztlich kraftlos ist, um echte Veränderung zu bringen.
Am Ende des Gedichts tritt der Sprecher in den Vordergrund und identifiziert sich mit den „armen Leuten“ und ihrem Leid. Der Blick auf die „weinende Wolke“ und das Mitfühlen mit dem „Volke“ verdeutlichen den emotionalen Beistand und die Solidarität des lyrischen Ichs mit den sozial Benachteiligten. Die „weinende Wolke“ wird hier zu einem Symbol für das geteilte Leid und die kollektive Trauer. Der Sprecher sieht sich selbst als Teil dieses Volkes und leidet mit den Armen, was die Verbundenheit und das gemeinsame Schicksal unterstreicht. Das Gedicht endet mit einer starken sozialen Botschaft, die das Mitgefühl und die Anteilnahme an den weniger privilegierten Menschen in den Vordergrund stellt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.