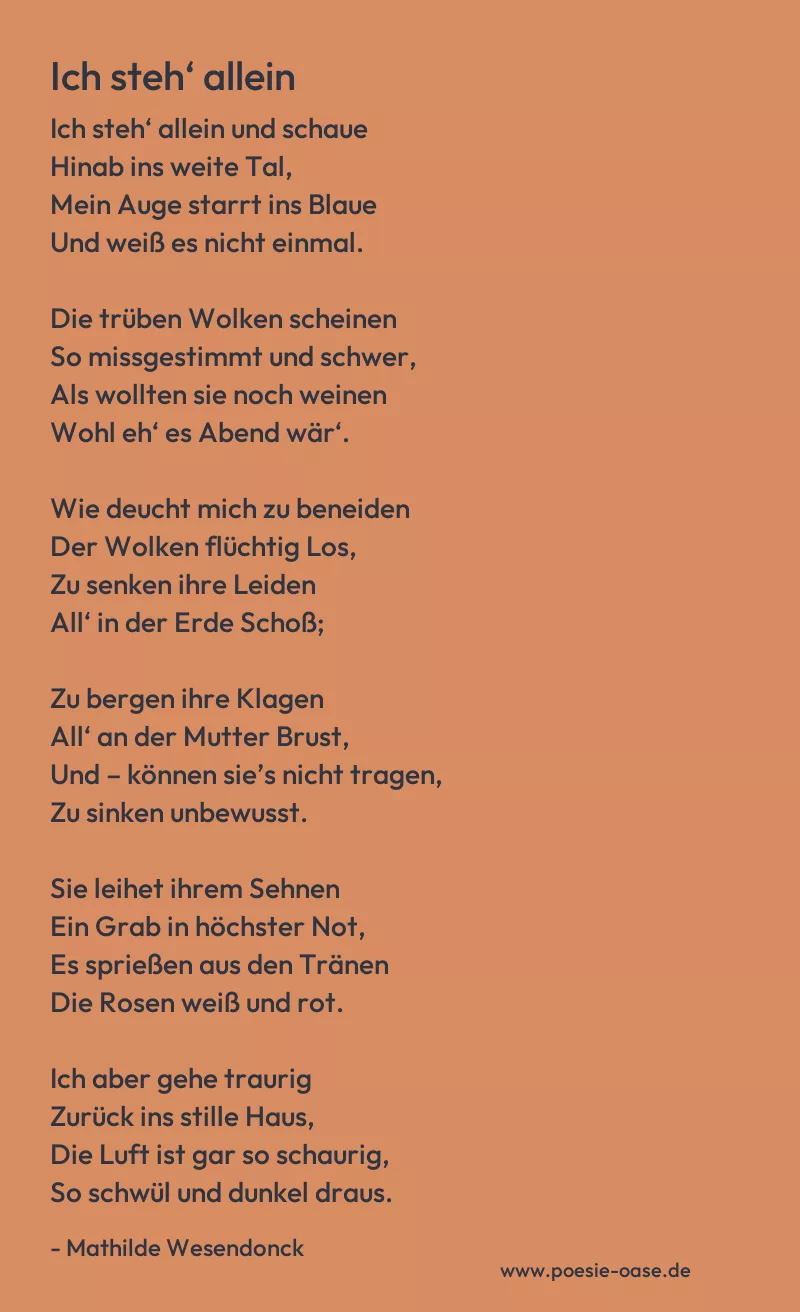Ich steh‘ allein
Ich steh‘ allein und schaue
Hinab ins weite Tal,
Mein Auge starrt ins Blaue
Und weiß es nicht einmal.
Die trüben Wolken scheinen
So missgestimmt und schwer,
Als wollten sie noch weinen
Wohl eh‘ es Abend wär‘.
Wie deucht mich zu beneiden
Der Wolken flüchtig Los,
Zu senken ihre Leiden
All‘ in der Erde Schoß;
Zu bergen ihre Klagen
All‘ an der Mutter Brust,
Und – können sie’s nicht tragen,
Zu sinken unbewusst.
Sie leihet ihrem Sehnen
Ein Grab in höchster Not,
Es sprießen aus den Tränen
Die Rosen weiß und rot.
Ich aber gehe traurig
Zurück ins stille Haus,
Die Luft ist gar so schaurig,
So schwül und dunkel draus.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
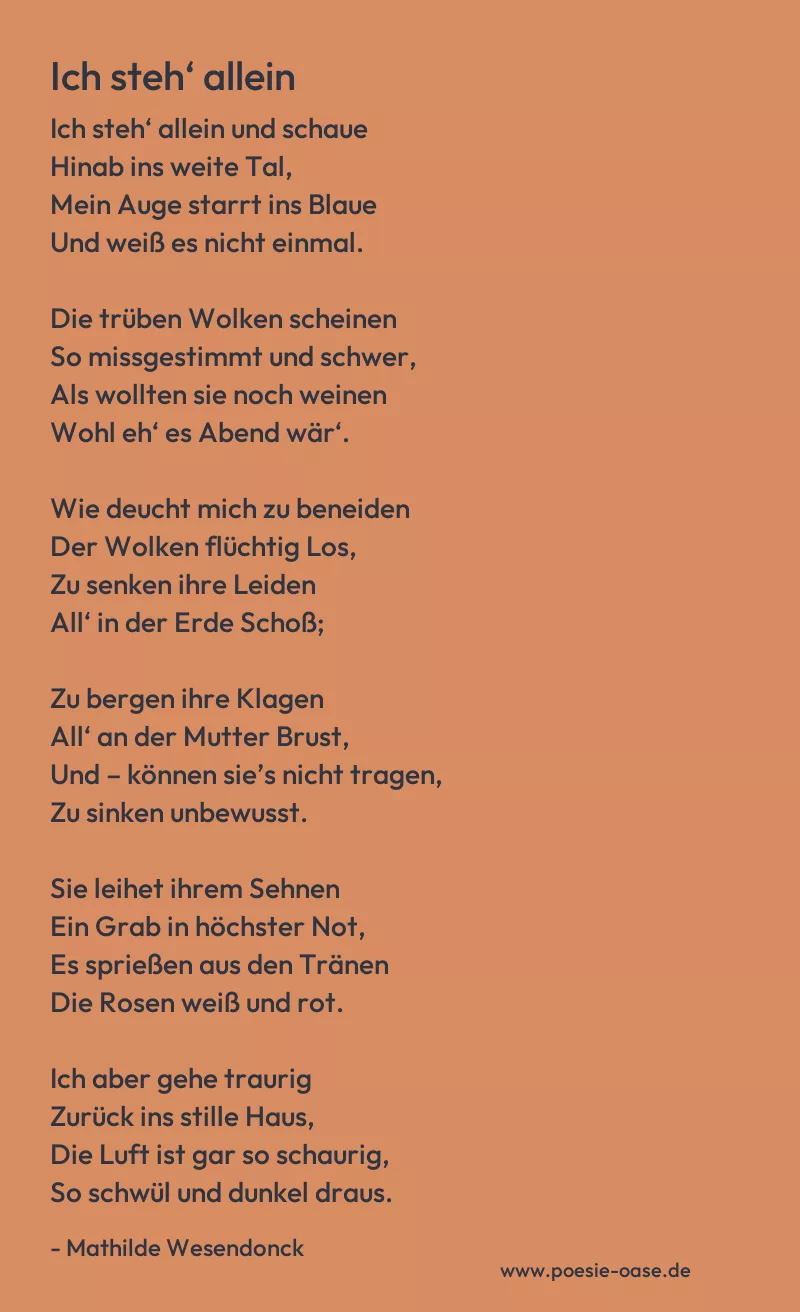
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ich steh‘ allein“ von Mathilde Wesendonck spiegelt eine tiefe Melancholie und existenzielle Einsamkeit wider. Die Sprecherin steht allein und blickt ins weite Tal, ihr Blick verharrt „ins Blaue“, ohne wirklich zu wissen, was sie sieht. Dies deutet auf eine innere Leere hin, die sich in der Unklarheit ihres Blickes widerspiegelt. Der weite Ausblick könnte eine Metapher für die Unendlichkeit der Gedanken oder Gefühle der Sprecherin sein, die sich in ihrer Einsamkeit verloren fühlt.
Die trüben Wolken, die „missgestimmt und schwer“ erscheinen, symbolisieren die innere Traurigkeit und Schwere, die die Sprecherin empfindet. Diese Wolken scheinen bald „weinen“ zu wollen, was darauf hindeutet, dass die Emotionen der Sprecherin in einem Zustand des Aufstaus sind – die Wolken als Symbol für ungestillte Trauer und den Wunsch, diese Last endlich loszulassen. Die Vorstellung, dass die Wolken ihre „Leiden in der Erde Schoß“ senken, verstärkt den Wunsch nach Erleichterung und innerem Frieden.
Der Gedichtsteil, in dem die Sprecherin die Wolken „beneidet“, spricht von einem tiefen inneren Konflikt. Sie wünscht sich, ihre eigenen Qualen so einfach wie die Wolken zu verbergen oder zu verarbeiten – in der Erde zu versinken und „unbewusst“ zu „sinken“, um ihre Last zu beenden. Diese Vorstellung von einem endgültigen, unbewussten Übergang in die Ruhe ist ein Ausdruck des Wunsches, die eigene Trauer zu beenden und mit dem eigenen Schmerz in Einklang zu kommen. Es zeigt die Sehnsucht nach einer Lösung, die in der Natur, die die Wolken symbolisieren, zu finden scheint.
Am Ende des Gedichts kehrt die Sprecherin jedoch in das „stille Haus“ zurück, das für sie eine Quelle der Traurigkeit und Unruhe darstellt. Die „schaurige“ und „schwüle“ Luft verstärkt das Gefühl der inneren Beklemmung, das die Sprecherin erfasst. Sie ist noch immer von der Dunkelheit und Schwüle der Welt um sie herum erdrückt, was ihre Unfähigkeit, Frieden zu finden, unterstreicht. Wesendonck verdeutlicht hier die Unmöglichkeit der Sprecherin, sich von ihrer Traurigkeit zu befreien – ein tiefer Ausdruck der Melancholie und des Schmerzes, die in ihrer Seele wohnen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.